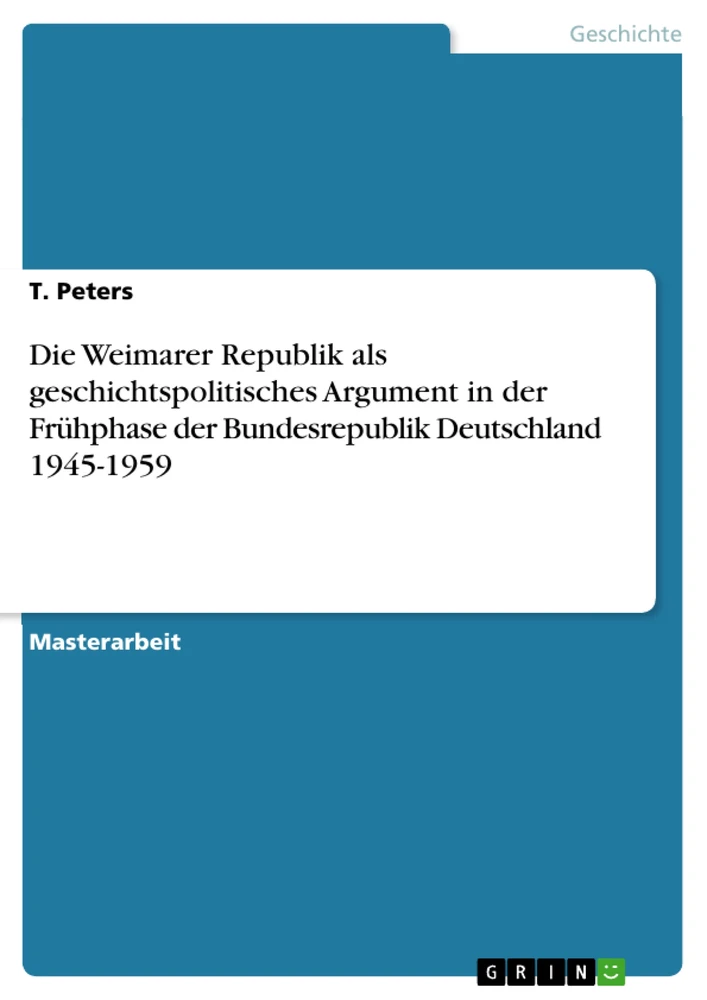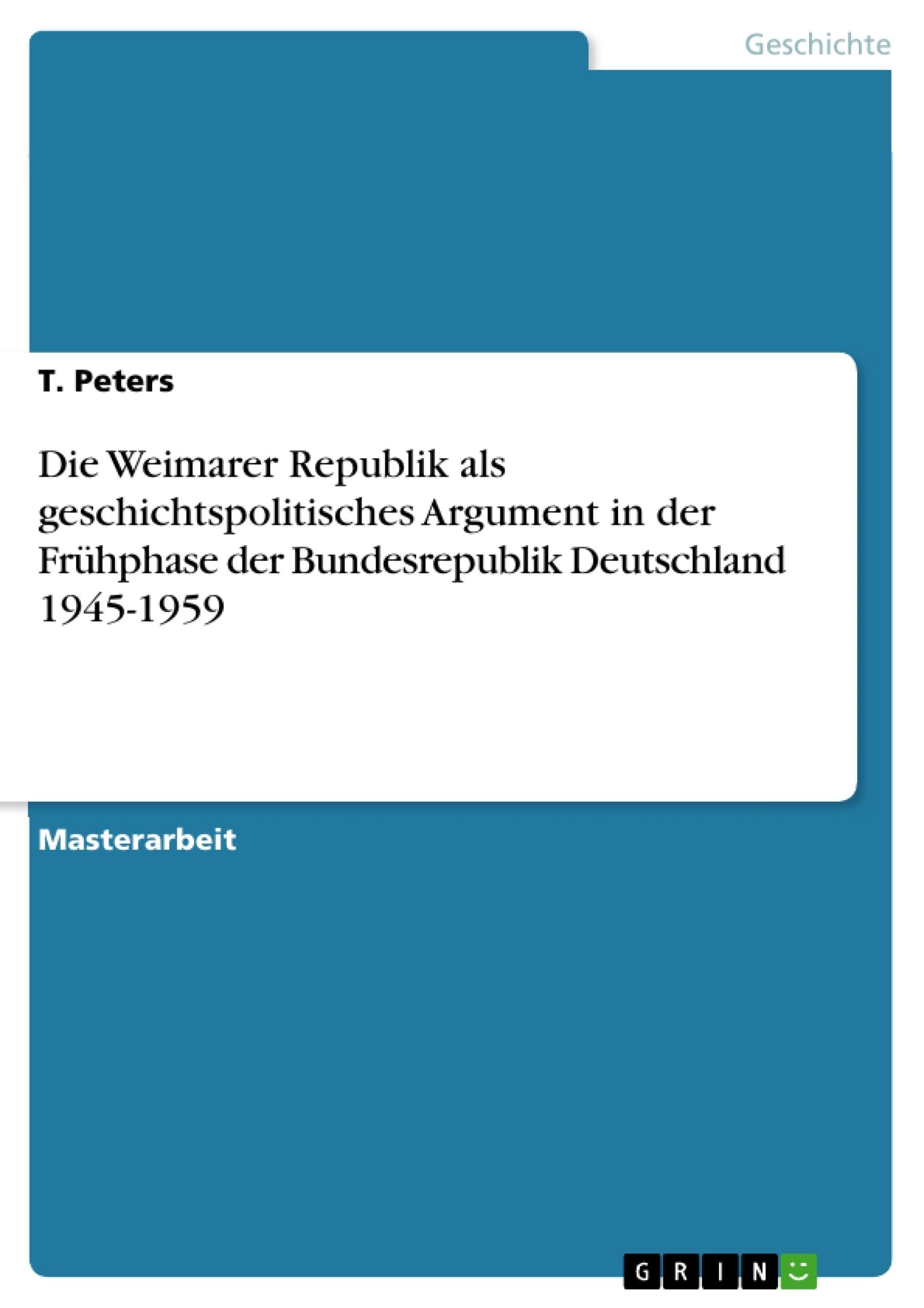Wie sind die Bezugnahmen auf die Weimarer Republik - auch hundert Jahre nach ihrer Gründung - in den politischen Debatten der Gegenwart zu erklären? Gerade da diese Vergleiche teilweise berechtigte Sorgen darstellen, teilweise jedoch mehr der rhetorischen Zuspitzung und der Erregung der öffentlichen Aufmerksamkeit dienen dürften, als dass sie reale Entwicklungsoptionen der deutschen Demokratie beschreiben? Woher kommt dieser teils obsessive Weimarbezug? Ist diese Bezugnahme damals wie heute identisch oder hat die Verwendung des Arguments „Weimar“ mit der Zeit einen Wandel vollzogen? Falls ja, wie hat dieser Funktionswandel ausgesehen? Warum kann das Argument „Weimar“ je nach Perspektive auf die eine oder andere Art ausgelegt werden?
All dies sind Fragen, auf die die nachfolgende Untersuchung mögliche Antworten liefern soll. Konkret soll die historische Frage gestellt werden, wie sich die westdeutsche Gesellschaft im Kontext des politischen Wiederaufbaus zur gescheiterten ersten deutschen Demokratie positionierte, wie sie die Geschichte der Weimarer Republik interpretierte und auf welche Art und Weise sich der Weimarbezug auf die junge Bonner Demokratie auswirkte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Präsentation des Themas
- 1.2 Theoretische Vorbemerkungen
- 1.3 Forschungsstand
- 2. Das Bild der Weimarer Republik in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- 2.1 Die Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung
- 2.2 Die Weimarer Republik in der öffentlichen Auseinandersetzung
- 3. Die Weimarer Republik im öffentlichen Kampf um die historisch-moralische Legitimität
- 3.1 Die Einordnung Weimars in den unterschiedlichen Deutungsmustern
- 3.2 Weimar und der Einfluss der Alliierten beim politischen Wiederaufbau
- 3.3 Der Weimarbezug im geschichtspolitischen Streit der Parteien
- 3.3.1 Die Auseinandersetzung zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten
- 3.3.2 Der Streit zwischen Sozialdemokraten und bürgerlichen Parteien
- 4. Die „Lehren aus Weimar“ im Bonner Grundgesetz und ihre Vorbedingungen
- 4.1 Die Weimarer Republik in den westzonalen Länderverfassungsdebatten
- 4.2 Der Vorwurf der Restauration in der Publizistik
- 4.3 Von der ,,Bizone“ zum Parlamentarischen Rat
- 4.4 Die Bedeutung der ersten deutschen Demokratie im Parlamentarischen Rat
- 5. Das Gründungsjahrzehnt der Bundesrepublik 1949-1959
- 5.1 Die Gründungskrise der BRD und die Angst vor der Wiederholung Weimars
- 5.2 Der Bundestagswahlkampf 1949 und die Angst vor einer Rückkehr zum Weimarer „Parteiengezänk“
- 5.3 Die Frage der Wirtschaftspolitik. Weimar und die Angst vor einer erneuten Wirtschaftskrise
- 5.4 Die Frage der wehrhaften Demokratie. Weimar und die Angst vor Verfassungsfeinden
- 5.5 Die Frage der Funktionsfähigkeit des politischen Systems. Weimar und die Angst vor einem erneuten Versagen des parlamentarischen Parteienstaates
- 5.6,,Bonn ist nicht Weimar“. Der Funktionswandel des Weimarbezugs seit Mitte der 1950er Jahre
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Rezeption der Weimarer Republik in der Frühphase der Bundesrepublik Deutschland (1945-1959). Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der Weimarer Republik als geschichtspolitisches Argument in den politischen Debatten der Zeit. Die Arbeit untersucht, wie die Erinnerung an die gescheiterte erste deutsche Demokratie die politische Kultur der jungen Bundesrepublik beeinflusst hat.
- Die Wahrnehmung der Weimarer Republik in der deutschen Bevölkerung
- Die Einordnung Weimars in unterschiedliche Deutungsmuster
- Der Einfluss der Weimarer Republik auf die deutsche Verfassungsdebatte
- Der Gebrauch des „Weimar-Arguments“ in politischen Debatten der frühen Bundesrepublik
- Der Funktionswandel des „Weimar-Komplexes“ im Laufe der 1950er Jahre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Arbeit vorstellt und den theoretischen Rahmen für die Analyse absteckt. Anschließend wird das Bild der Weimarer Republik in der unmittelbaren Nachkriegszeit untersucht, wobei sowohl die Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung als auch die öffentliche Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik betrachtet werden.
Kapitel 3 widmet sich der Rolle der Weimarer Republik im öffentlichen Kampf um die historisch-moralische Legitimität der Bundesrepublik. Hierbei werden die Einordnung Weimars in unterschiedliche Deutungsmuster, der Einfluss der Alliierten auf den politischen Wiederaufbau und der Einsatz des „Weimar-Arguments“ im geschichtspolitischen Streit der Parteien behandelt.
Kapitel 4 untersucht die Bedeutung der „Lehren aus Weimar“ im Bonner Grundgesetz und deren Vorbedingungen. Es werden die Debatten um die Verfassung in den westzonalen Ländern, der Vorwurf der Restauration in der Publizistik sowie die Rolle der Weimarer Republik im Parlamentarischen Rat betrachtet.
Kapitel 5 beleuchtet das Gründungsjahrzehnt der Bundesrepublik Deutschland (1949-1959) und die anhaltende Präsenz des „Weimar-Komplexes“ in den politischen Debatten dieser Zeit. Hierbei werden die Gründungskrise der BRD, der Bundestagswahlkampf von 1949, die Frage der Wirtschaftspolitik, die Frage der wehrhaften Demokratie und die Frage der Funktionsfähigkeit des politischen Systems analysiert.
Schlüsselwörter
Weimarer Republik, Bundesrepublik Deutschland, Geschichtspolitik, Politische Kultur, „Weimar-Komplex“, „Lehren aus Weimar“, Gründungskrise, Parteienlandschaft, Verfassungsdebatte, Demokratie, Geschichtsschreibung, Selbstverständnis, Historische Parallelen, Bundesrepublik, „Bonn ist nicht Weimar“
- Quote paper
- T. Peters (Author), 2021, Die Weimarer Republik als geschichtspolitisches Argument in der Frühphase der Bundesrepublik Deutschland 1945-1959, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474072