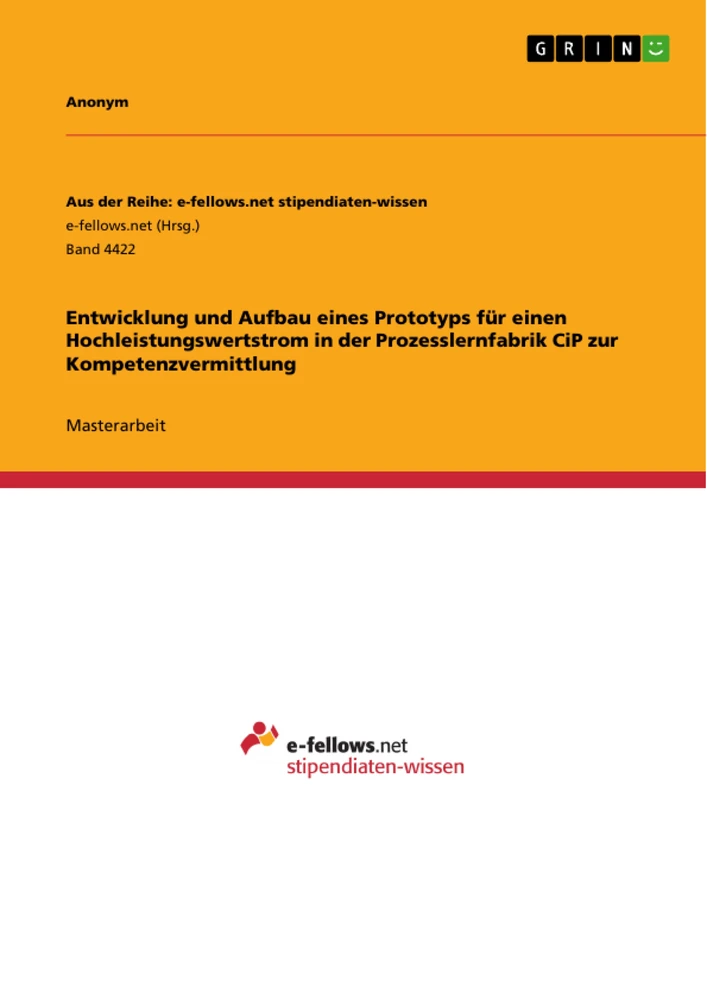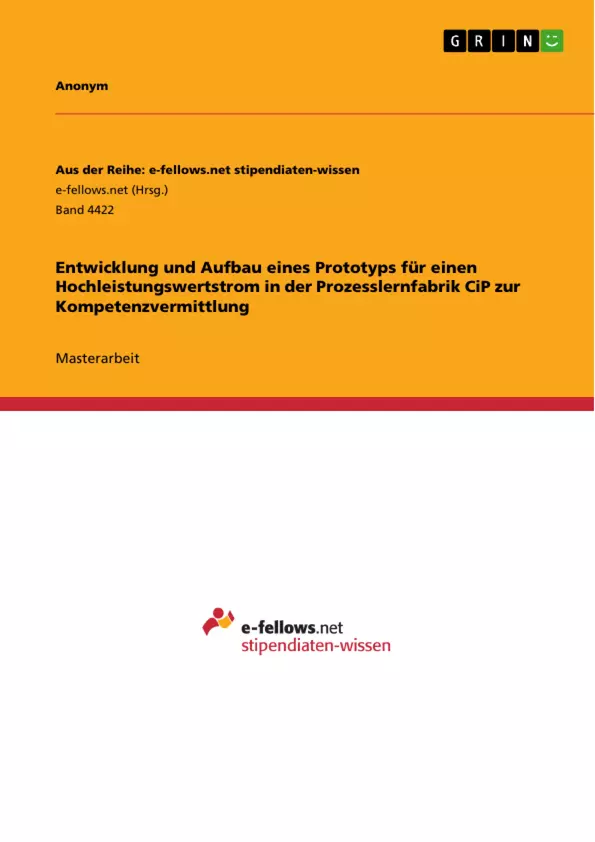Diese Arbeit behandelt die Herausforderungen der modernen kundenindividuellen Produktion und bietet eine Lösung durch die Entwicklung eines Lernmoduls zum Hochleistungswertstrom. Das Ziel ist es, die Vorteile der Massenproduktion mit der Flexibilität des Engineer-to-Order-Prinzips zu kombinieren. Dazu werden in der Prozesslernfabrik CiP zwei Demonstrationswertströme erstellt: eine typische kundenindividuelle Auftragsabwicklung und ein Hochleistungswertstrom. Diese dienen als Grundlage für praktische Handlungsaufgaben im Lernmodul und ermöglichen den Vergleich der Leistungsfähigkeit beider Ansätze. Die Arbeit zeigt, dass der Hochleistungswertstrom durch hohe Digitalisierung und geringe Speichermedien die Durchlaufzeit reduziert und den wertschöpfenden Zeitanteil erhöht.
Die Arbeit zielt darauf ab, ein Lernmodul zum Thema „Hochleistungswertstrom“ zu entwickeln, das die praxisnahe Kompetenzvermittlung unterstützt. Dazu werden typische Abläufe in einer mittelständischen kundenindividuellen Auftragsabwicklung in der Prozesslernfabrik CiP analysiert und als Referenz abgebildet. Anschließend wird ein Prototyp eines Hochleistungswertstroms aufgebaut, um die Leistungsfähigkeit beider Ansätze zu vergleichen und den Lernfortschritt zu evaluieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Herausforderungen der modernen Produktion
- Zeit, Kosten, Qualität
- Individualitätswunsch der Kunden
- Konzept des Hochleistungswertstroms
- Co-Creation
- Quick Response Manufacturing
- Lean Production
- Auftragsabwicklung in einem Hochleistungswertstrom
- Wertstrommethode 4.0
- Verschwendung im indirekten Bereich
- Wertstromanalyse 4.0
- Wertstromdesign 4.0
- Modernes Lernen
- Kompetenzorientierung und der Wissensbegriff
- Lernfabriken und Lernmodule
- Bedarf für die Entwicklung eines Lernmoduls zum Thema Hochleistungswertstrom
- Entwicklung eines Lernmoduls „Hochleistungswertstrom“
- Beschreibung des Entwicklungsansatzes
- Ansätze zur Gestaltung von Lernmodulen
- Beschreibung des Darmstädter Ansatzes
- Definition der Rahmenbedingungen des Lernmoduls
- Kompetenztransformation
- Intendierte Kompetenz K1: Analyse des Ist-Zustands
- Intendierte Kompetenz K2: Gestaltung eines Hochleistungswertstroms als Soll-Zustand
- Intendierte Kompetenz K3: Anwendungsspektrum des Hochleistungswertstroms
- Intendierte Kompetenz K4: Umsetzung des Hochleistungswertstroms
- Sequenzierung
- Grobsequenzierung und Relevanzbewertung der Lernziele
- Bedarf für die Erweiterung der soziotechnischen Infrastruktur
- Entwicklung und Aufbau von Demonstratoren
- Definition des Betrachtungsumfangs
- Tätigkeiten im Auftragsabwicklungsprozess für kundenindividuelle Produktion
- Betrachtungsrahmen der Demonstratoren
- Auswahl eines Produkts
- Gestaltung und Umsetzung des Wertstroms
- Typische Schwachstellen in der Auftragsabwicklung
- Gestaltung und Umsetzung des Wertstroms
- Entwicklung und Umsetzung des Hochleistungswertstrom-Demonstrators
- Gestaltungszone 1: Front-End und Konfigurator
- Gestaltungszone 2: Auftragsabwicklungsprozess
- Gestaltungszone 3: Produktionssteuerung und Statusanzeige
- Gestaltungszone 4: Produktionsprozess
- Zusammenfassung des Auftragsabwicklungsprozesses
- Erweiterung der Beschreibung des Konzepts Hochleistungswertstrom
- Einflusskategorien auf die Anwendbarkeit eines Hochleistungswertstroms
- Merkmalsschema zur Charakterisierung von Auftragsabwicklungsprozessen
- Vergleich der Leistungsfähigkeit beider Demonstratoren
- Herausforderungen der kundenindividuellen Produktion
- Konzept des Hochleistungswertstroms
- Wertstrommethode 4.0
- Kompetenzorientierung im Lernprozess
- Gestaltung von Lernmodulen im Kontext von Lernfabriken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Lernmoduls zum Thema Hochleistungswertstrom, um den Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis zu ermöglichen und für eine vermehrte Anwendung des Konzepts zu sorgen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Herausforderungen der modernen Produktion, insbesondere die steigende Kundennachfrage nach individualisierten Produkten. Anschließend wird das Konzept des Hochleistungswertstroms als mögliche Lösung vorgestellt und in den Kontext bekannter Produktionskonzepte wie Lean Production und Quick Response Manufacturing eingeordnet. Die Wertstrommethode 4.0 als Werkzeug zur Analyse und Gestaltung von Produktionsprozessen wird erläutert. Abschließend wird der Bedarf für die Entwicklung eines Lernmoduls zum Thema Hochleistungswertstrom zusammengefasst.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Entwicklung des Lernmoduls. Zuerst wird der Darmstädter Ansatz als Grundlage für die Gestaltung des Moduls vorgestellt. Die Rahmenbedingungen des Lernmoduls werden definiert, die übergeordnete Kompetenz operationalisiert und in verschiedene intendierte Kompetenzen untergliedert. Diese werden jeweils mit einer Handlung und den notwendigen Wissenselementen verknüpft.
Kapitel 4 erläutert die Erweiterung der soziotechnischen Infrastruktur der Prozesslernfabrik CiP. Zwei Demonstrationswertströme werden entwickelt und umgesetzt: ein Wertstrom für die typische kundenindividuelle Produktion und ein Prototyp eines Hochleistungswertstroms.
Kapitel 5 beschreibt die Gestaltung der Lernaktivitäten innerhalb des Lernmoduls. Die einzelnen Sequenzen und Lernsituationen werden detailliert ausgearbeitet und mit geeigneten Aufgaben und Materialien ausgestattet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Produktionsmanagement, Lernmodulentwicklung, kundenindividuelle Produktion, Hochleistungswertstrom, Wertstrommethode 4.0, Lean Production, Quick Response Manufacturing, Digitalisierung, Kompetenzentwicklung, Lernfabrik und Co-Creation.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2023, Entwicklung und Aufbau eines Prototyps für einen Hochleistungswertstrom in der Prozesslernfabrik CiP zur Kompetenzvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474203