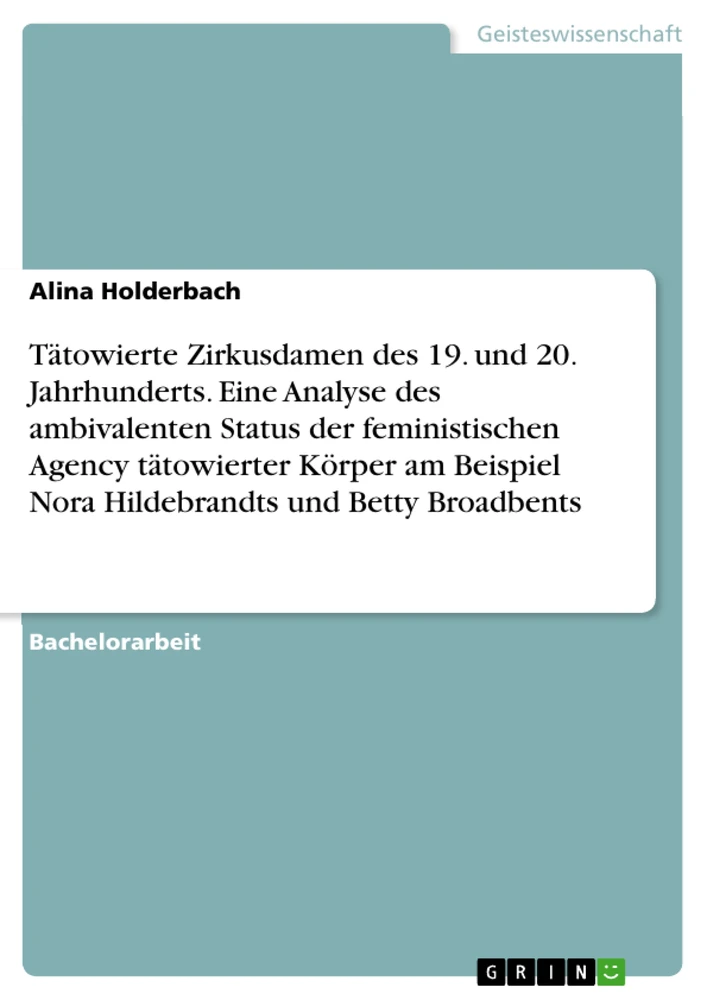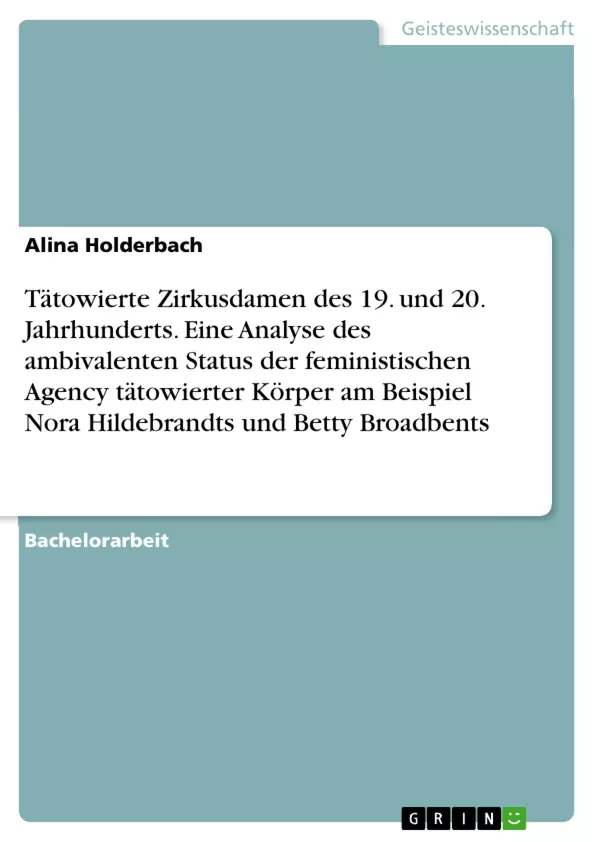Tätowierte Zirkusdamen in den USA und Europa des 19. und 20. Jahrhunderts widersetzten sich der patriarchalen Beschränkung und stellten ihre Körper selbstständig in den Mittelpunkt. Sie ließen sie zu wortwörtlichen Shows werden, indem sie in Zirkussen ihre fast gänzlich tätowierte Haut auf Bühnen präsentierten. Durch die Betrachtung des Lebens und der Arbeit zweier solcher tätowierten Zirkusdamen, namens Nora Hildebrandt und Betty Broadbent, soll analysiert werden, auf welchen Weisen ihrer tätowierten Haut eine feministische Agency innewohnt, und inwiefern sie mittels der Gestaltung ihrer Haut geltende Machtverhältnisse übergehen. Als feministische Agency werden im Rahmen dieser Arbeit diejenigen Aspekte verstanden, welche den Weiblich Gelesenen Körper mithilfe von Tätowierungen als den Eigenen markieren, der sich dem Status des Objektes patriarchaler Projektionen eines normativ weiblichen Körpers widersetzt.
Durch einen Vergleich der Selbstdarstellung dieser beiden Frauen und der Vermarktung ihrer Show-Acts soll außerdem auf die Ambivalenz dieser Agency aufmerksam gemacht werden. Wie sich bei der Betrachtung von Zirkusshow-Acts dieser Zeit nämlich zeigen wird, gibt es für das angenommene subversive Potenzial der Tattoos auch hemmende Elemente. Einerseits, da die von ihnen erzählten Entstehungsgeschichten der Tattoos auf kolonialen Vorstellungen gegenüber tätowierten Menschen of Color beruhen, wodurch eine Hierarchisierung zwischen ihren und „anderen“ Körpern stattfindet. Zudem wurden dieserart Geschichten dafür verwendet, ihre Tattoos nicht mehr nur als selbstbestimmte Akte körperlicher Transformationen zu konstruieren, sondern diese ihnen vielmehr „angetan“ wurden. Hierdurch geht die Agency, die ihre Tattoos auszudrücken vermögen, verloren, beziehungsweise scheint nicht mehr so deutlich zu fassen zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- 1. Zum Körper
- I. Corporeal Feminism/ Körperlicher Feminismus
- II. Spezifika der Haut
- III. Feministisches Potenzial von Tattoos
- 2. Tattooed Ladies
- I. Hintergründe
- II. Nora Hildebrandt
- III. Betty Broadbent
- 3. Status der Agency
- I. Feministisches Potenzial der Tattoos der Zirkusdamen
- II. Hemmer des feministischen Potenzials
- Ausklang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem ambivalenten Status der feministischen Agency tätowierter Zirkusdamen des 19. und 20. Jahrhunderts, anhand der Beispiele Nora Hildebrandt und Betty Broadbent. Sie analysiert, auf welche Weise die tätowierte Haut dieser Frauen als Mittel der Selbstdarstellung und als Ausdruck von Agency diente, und welche Faktoren gleichzeitig die Ausübung dieser Agency begrenzten. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen dem Körper und seiner sozialen Konstruktion im Kontext des Feminismus und untersucht, wie Tätowierungen eine Herausforderung für normative Körperbilder und patriarchalische Strukturen darstellen können.
- Körperlicher Feminismus und die Konstruktion des weiblichen Körpers
- Die Bedeutung der Haut als Ort der Inskription und der Darstellung von Identität
- Das subversive Potenzial von Tätowierungen als Mittel der Selbstbestimmung und Rebellion gegen patriarchalische Normen
- Die ambivalenten Aspekte der Agency von tätowierten Zirkusdamen, einschließlich der Rolle von Kolonialismus und der Konstruktion von Geschichten, die die Agency der Frauen infrage stellen
- Die Bedeutung der Selbstdarstellung und der Vermarktung von Show-Acts im Kontext der Agency der Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
- Hinführung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Zusammenhang zwischen Tätowierungen und dem ambivalenten Status der Agency von tätowierten Zirkusdamen. Die Arbeit untersucht, inwiefern diese Frauen durch die Gestaltung ihrer Haut bestehende Machtverhältnisse in Frage stellen konnten, und wie sich diese Agency durch die Art der Darstellung ihrer Shows und die narrative Konstruktion ihrer Tätowierungen äußert.
- 1. Zum Körper: Dieses Kapitel beleuchtet den Körper als Ort der sozialen Konstruktion und analysiert die Rolle des Körpers im Kontext des Feminismus. Es werden Theorien des „Körperlichen Feminismus“ von Elisabeth Grosz vorgestellt und die Bedeutung der Haut als Ort der Inskription und der Darstellung von Identität diskutiert. Abschließend wird das subversive Potenzial von Tattoos auf weiblich gelesener Haut erörtert und die Suche nach einer alternativen, monströsen, weiblichen Ästhetik beleuchtet.
- 2. Tattooed Ladies: Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe des Phänomens der tätowierten Zirkusdamen und stellt die Lebensläufe und Arbeit von Nora Hildebrandt und Betty Broadbent vor. Es untersucht, wie diese Frauen die kulturellen Vorstellungen des normativ weiblichen Körpers des 19. und 20. Jahrhunderts durch ihre tätowierte Haut in Frage stellten, und welche Strategien sie verwendeten, um gleichzeitig im Rahmen dieser Normen zu bleiben.
- 3. Status der Agency: Dieses Kapitel analysiert die feministischen Potenziale der Tattoos der Zirkusdamen und untersucht, inwiefern diese als Ausdruck von Selbstbestimmung und Widerstand gegen patriarchalische Strukturen interpretiert werden können. Zudem werden Hemmnisfaktoren für die Agency der Frauen beleuchtet, wie beispielsweise die Konstruktion von Geschichten, die ihre Tattoos als „angetan“ darstellen und die selbstbestimmte Gestaltung ihrer Körper in Frage stellen.
Schlüsselwörter
Körperlicher Feminismus, Tätowierung, feministische Agency, Zirkus, Show, Selbstdarstellung, Nora Hildebrandt, Betty Broadbent, koloniale Vorstellungen, subversive Ästhetik, normativer weiblicher Körper, soziale Konstruktion, Machtverhältnisse.
- Citation du texte
- Alina Holderbach (Auteur), 2023, Tätowierte Zirkusdamen des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Analyse des ambivalenten Status der feministischen Agency tätowierter Körper am Beispiel Nora Hildebrandts und Betty Broadbents, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474346