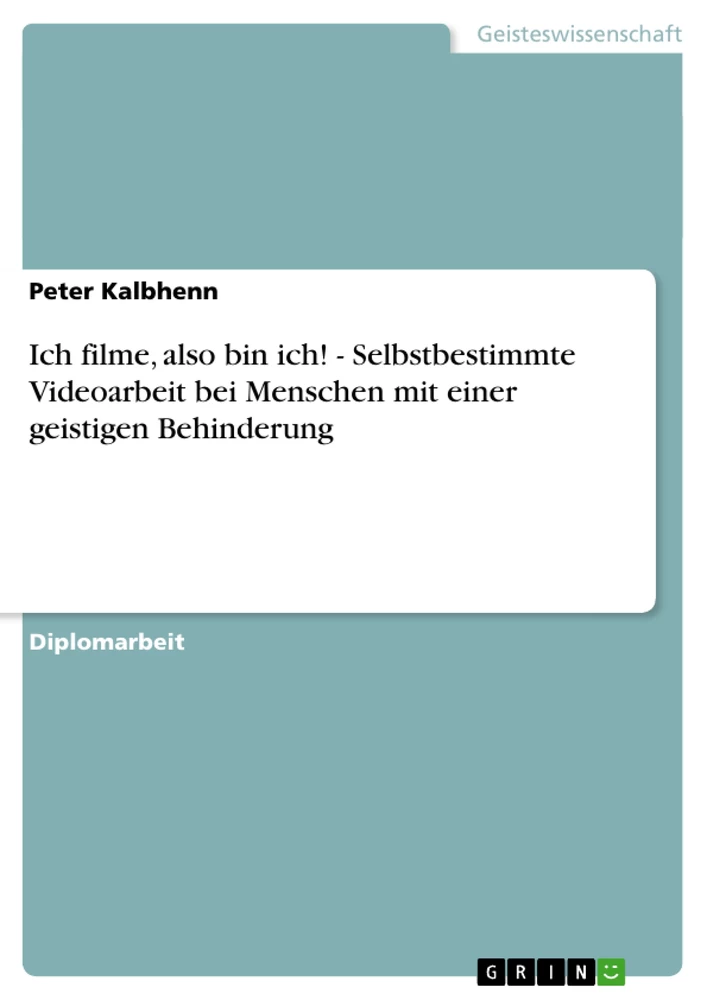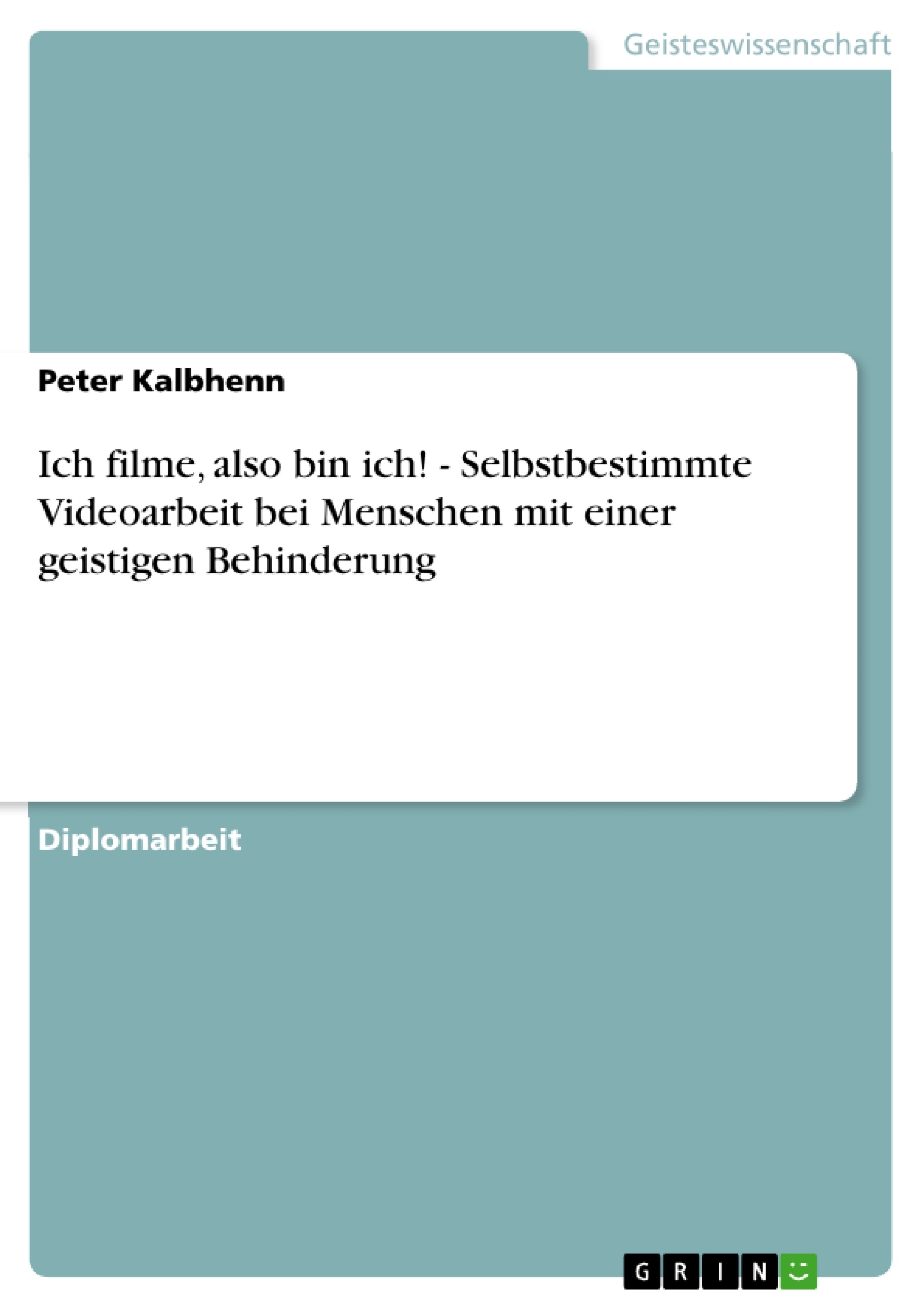Die Idee zu dieser Diplomarbeit führt zu großen Teilen auf ein Seminar zurück, an dem ich im Rahmen meines Studiums teilgenommen habe. An der Fachhochschule Fulda fand im Sommersemester 2002 eine integrative Lehrveranstaltung mit dem Titel „Video machen! – Integrative Medienarbeit mit Video“ statt. Das Seminar lief als „Experiment“ im Rahmen einer Diplomarbeit ab. Die Leitung lag bei Prof. Dr. G.G. und dem Diplomanten T.G. Teilnehmer waren drei Menschen mit Lernschwierigkeiten und sieben StudentInnen. Integrative Lehrveranstaltung bedeutet, dass an zwei Wochenenden die TeilnehmerInnen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam mit den StudentInnen lernten, wie man mit Kamera und einem Effektmischpult (Audio-Video-Effekt-Mischer, kurz AVE-Mischer) umgeht. Außerdem wurden kleine Filme erstellt. Die StudentInnen wurden zu Assistenten für die Menschen mit Lernschwierigkeiten. Bei der Bedienung der Geräte standen sie den Nutzern (den TeilnehmerInnen mit Lernschwierigkeiten) zur Seite. Die StudentInnen setzten dadurch kurz vorher erworbenes grundlegendes Wissen, wie zum Beispiel Kameraoperationen, Einstellungsgrößen und Perspektiven, sofort in die Praxis um. Die Arbeitsprozesse fanden meist in Kleingruppen statt.
Die zwei Hauptmerkmale dieses Seminars waren zum einen die Videoarbeit und zum anderen die Autonomie der TeilnehmerInnen. Sinn des Seminars sollte sein, dass Menschen mit einer Lernbehinderung (gemeinsam mit den StudentInnen) lernen mit dem Medium Video zu arbeiten, um dann möglichst autonom einen Film drehen zu können.
Nach diesen beiden Wochenenden hatte ich allerdings das Gefühl, dass die Kurzfilme der TeilnehmerInnen nicht von ihnen sondern von den StudentInnen und der Seminarleitung gedreht und bearbeitet wurden. Die Ideen zu den Beiträgen kamen zwar von den TeilnehmerInnen, aber die Umsetzung erfolgte zu großen Teilen durch die Begleiter. Man muss allerdings festhalten, dass einige Vorhaben der Seminarleitung, wie z.B. das Erlernen vom „Film schneiden“, der knapp bemessenen Zeit zum Opfer fielen.
Trotzdem konnte die Autonomie der TeilnehmerInnen nur teilweise erreicht werden. Die Integrative Lehrveranstaltung war ein Schritt in Richtung Videoarbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber meiner Meinung nach konnten die TeilnehmerInnen nicht selbstbestimmt filmen. Daraus entwickelte sich dann bei mir der Gedanke dieser Diplomarbeit: Selbstbestimmte Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Inhaltsverzeichnis
- Persönliche Vorbemerkung
- Einleitung
- Selbstbestimmung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Die geschichtliche Entwicklung der Behindertenhilfe, von der Reformpädagogik bis hin zur Selbstbestimmung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Vorbetrachtung
- Die Zeit nach 1945
- Der Beginn des Umdenkens
- Selbstbestimmung
- Möglichkeiten des Selbstbestimmten Lernens bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Selbstbestimmtes Lernen trotz Unterstützung
- Die Methode der leicht zurückweisbaren Angebote
- Das Konvergenzmodell
- Selbstbestimmte Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Ästhetik in der Erziehung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Ästhetik im Film
- Ein Konzept zur Selbstbestimmten Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Selbstbestimmtes Lernen in der Videoarbeit trotz Unterstützung
- Das Vertonen eines Filmes bei „Sprachschwierigkeiten“
- Das Schneiden eines Filmes
- Die Rolle des Begleiters
- Die verschiedenen Funktionen der Videoaufnahmen des Begleiters
- Selbstbestimmte Videoarbeit in der sozialpädagogischen Praxis
- Praxisbericht
- Erstes Treffen: Interview mit Christian – 01.11.2002
- Zweites Treffen: „Erste“ eigene Aufnahmen von Christian – 04.11.2002
- Die Zirkustiere
- Christians Oma und Opa
- Drittes Treffen: Christians Umgebung – 15.11.2002
- Der Kiosk
- Die Kirche
- Der Spielplatz
- Viertes Treffen: „,Modenschau\" - 22.11.2002
- Fünftes Treffen: Die Weihnachtsfeier der Lebenshilfe – 08.12.2002
- Sechstes Treffen: Studio - 03.01.2003
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie Selbstbestimmung in der Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung gefördert werden kann. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Behindertenhilfe und die Bedeutung von Selbstbestimmung in diesem Kontext. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze und Methoden des selbstbestimmten Lernens vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit in der Videoarbeit übertragen.
- Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe
- Selbstbestimmtes Lernen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Videoarbeit als Mittel zur Förderung von Selbstbestimmung
- Praktische Umsetzung eines Konzepts zur selbstbestimmten Videoarbeit
- Bedeutung von Ästhetik und Kreativität in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer persönlichen Vorbemerkung, die den Entstehungsprozess der Diplomarbeit schildert. In der Einleitung wird die Thematik der Selbstbestimmten Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eingeführt und die Relevanz der Thematik für die sozialpädagogische Praxis hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Behindertenhilfe und die damit verbundenen Veränderungen im Verständnis von Selbstbestimmung. Die Entwicklung von der Reformpädagogik bis hin zur heutigen Forderung nach Selbstbestimmung wird anhand wichtiger Meilensteine und Reformbewegungen dargestellt.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Möglichkeiten des selbstbestimmten Lernens bei Menschen mit einer geistigen Behinderung vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet dabei die Methode der leicht zurückweisbaren Angebote sowie das Konvergenzmodell und erläutert deren Bedeutung für die Förderung von Selbstbestimmung im Lernprozess.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Konzept der selbstbestimmten Videoarbeit. Die Arbeit analysiert die Rolle von Ästhetik und Kreativität in der Erziehung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und stellt einen Ansatz zur Umsetzung selbstbestimmter Videoarbeit vor. Dabei werden verschiedene Aspekte wie das Vertonen von Filmen, das Schneiden von Filmen und die Rolle des Begleiters in der Videoarbeit beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der praktischen Umsetzung des Konzepts der selbstbestimmten Videoarbeit in der sozialpädagogischen Praxis. Anhand eines Praxisberichts wird die Arbeit mit einem jungen Mann mit einer geistigen Behinderung, Christian, dokumentiert. Die Arbeit beschreibt die einzelnen Arbeitsschritte und die Herausforderungen, die sich im Verlauf der Videoarbeit ergeben haben.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, Videoarbeit, Menschen mit einer geistigen Behinderung, Selbstbestimmtes Lernen, Inklusion, Behindertenhilfe, Ästhetik, Kreativität, Sozialpädagogische Praxis, Praxisbericht
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel selbstbestimmter Videoarbeit?
Menschen mit geistiger Behinderung sollen befähigt werden, das Medium Video autonom zu nutzen, um eigene Ideen auszudrücken, anstatt nur Anweisungen von Assistenten auszuführen.
Welche Rolle spielt der Begleiter bei dieser Arbeit?
Der Begleiter fungiert als Assistent, der technische Unterstützung bietet, aber die inhaltliche Kontrolle und kreative Entscheidung beim behinderten Nutzer lässt.
Was ist die Methode der "leicht zurückweisbaren Angebote"?
Es ist ein pädagogischer Ansatz, bei dem Unterstützung so angeboten wird, dass der Lernende sie ohne sozialen Druck ablehnen kann, um seine Autonomie zu wahren.
Wie können Filme bei Sprachschwierigkeiten vertont werden?
Das Konzept sieht vor, alternative Ausdrucksformen wie Musik, Geräusche oder visuelle Symbole zu nutzen, um die Intention des Filmemachers auch ohne Lautsprache zu vermitteln.
Welche Bedeutung hat Ästhetik in der Behindertenhilfe?
Ästhetik ermöglicht kreative Selbstentfaltung und stärkt das Selbstwertgefühl, da der Fokus auf dem Schaffen eines Werkes und nicht auf Defiziten liegt.
Was zeigt der Praxisbericht über "Christian"?
Der Bericht dokumentiert, wie Christian durch Videoaufnahmen seine Umgebung (Kiosk, Kirche, Zirkus) erkundet und durch den Prozess des Filmens eigene Perspektiven entwickelt.
- Citar trabajo
- Peter Kalbhenn (Autor), 2003, Ich filme, also bin ich! - Selbstbestimmte Videoarbeit bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147478