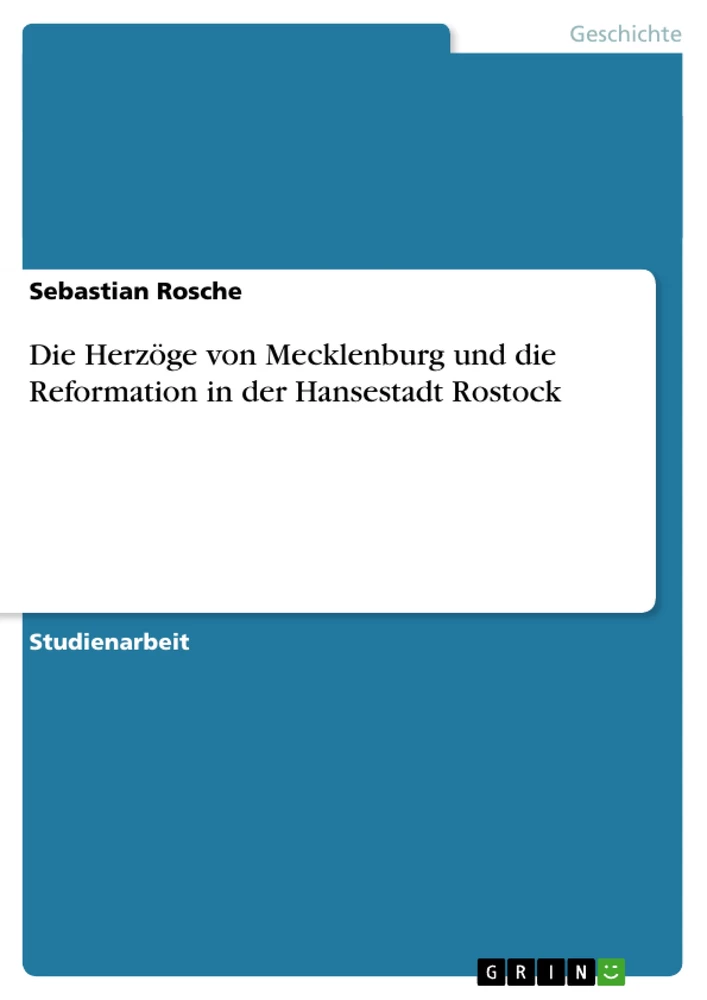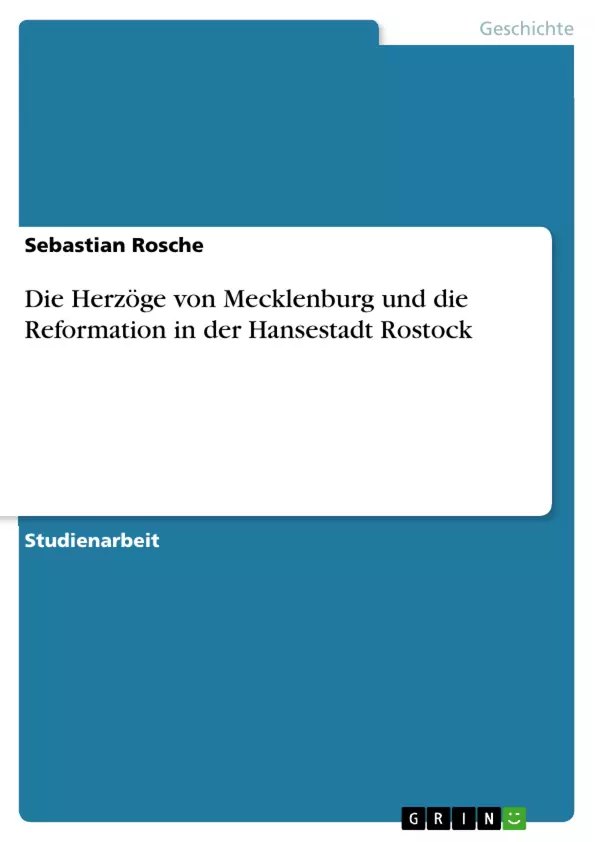Heinz Schilling führt in zwei Aufsätzen, in denen er die politische Elite der nordwestdeutschen Hansestädte zur Zeit der Reformation beschreibt, den Begriff der Hansestadtreformation ein. Er bezeichnet damit einen besonderen Typus der Reformation, welcher nur auf bestimmte Mitgliedsstädte der Hanse anwendbar sei. Die Hansestadtreformation unterscheide sich im Vergleich zu den Reichsstädten nicht durch „municipal structures and affairs. [...] The differences [...] arose out of the Hanseatic Cities’ place as provincial towns in cultural, political and social systems of their respective territories. [...] the problem of reformation in the Hanseatic Cities was closely bound to the rise of the early modern territorial state.“
Der vorliegende Aufsatz hat die Reformation in der Hansestadt Rostock zum Thema. Die Rostocker Religionskämpfe sind wegen ihrer territorial- und kirchenpolitischen Voraussetzungen von besonderem Interesse. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte Heinrich V. (1503-1552) die Herrschaft des Herzogtums von seinem Vater Magnus II. (1477-1503) übernommen und blieb für mehrere Jahre darin unangefochten. Bald darauf aber forderte sein Bruder Albrecht VII. (1503-1547) den zeitgenössischen Erbrechtsvorstellungen entsprechend einen Anteil an der Regierung in Mecklenburg. Nach langjährigem Streit einigte man sich im Neubrandenburger Hausvertrag von 1520 darauf, die Einheit des Landes zu bewahren, indem man das Gebiet gleichmäßig aufteilte, aber die Prälaten, den Adel und die zwölf wichtigsten Städte (darunter auch Rostock) einer gemeinschaftlichen Regierung der Herzöge unterstellte.
Die Rolle der Herzöge und ihre Einflußnahme auf den Rostocker Reformationsprozeß sollen deshalb einen der Schwerpunkte dieser Arbeit bilden, wobei sich die Untersuchung auf den durch die historischen Ereignisse bis 1540 gesteckten zeitlichen Rahmen konzentrieren wird. Zuerst wird die politische Situation in Mecklenburg am Vorabend der Reformation dargestellt, danach deren Ablauf nachgezeichnet und anschließend anhand von einzelnen Beispielen die tatsächliche Einflußnahme der Herzöge auf wichtige Ereignisse der Rostocker Reformationsgeschichte untersucht werden. Die Ergebnisse werden zu einer Überprüfung herangezogen, ob der von Heinz Schilling für die nordwestdeutschen Hansestädte eingeführte Typus der Hansestadtreformation auch auf Rostock anwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Herzogtum Mecklenburg
- Der frühneuzeitliche Staat
- Das Verhältnis der Herzöge zur Stadt Rostock
- Die Fürstenfamilie
- Die Rostocker Reformation
- Eine chronologische Darstellung der Reformationsereignisse
- Die Einflussnahme der Herzöge auf die Reformation
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Reformation in der Hansestadt Rostock und untersucht insbesondere die Rolle der mecklenburgischen Herzöge und deren Einfluss auf den Rostocker Reformationsprozess. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ereignisse bis 1540 und analysiert die politische Situation in Mecklenburg am Vorabend der Reformation, den Verlauf der Reformation in Rostock sowie die tatsächliche Einflussnahme der Herzöge auf wichtige Ereignisse. Ziel ist es, zu überprüfen, ob der von Heinz Schilling für die nordwestdeutschen Hansestädte eingeführte Typus der Hansestadtreformation auch auf Rostock anwendbar ist oder ob nicht aufgrund differenzierter Voraussetzungen die Reformation in Rostock Muster offenbart, die eine andere Kategorisierung erfordern.
- Die politische Situation in Mecklenburg am Vorabend der Reformation
- Der Verlauf der Reformation in Rostock
- Die tatsächliche Einflussnahme der Herzöge auf die Reformation
- Die Anwendbarkeit des Typs der Hansestadtreformation auf Rostock
- Die Relevanz der Rostocker Reformation im Kontext der territorial- und kirchenpolitischen Voraussetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Begriff der Hansestadtreformation vor, welcher von Heinz Schilling geprägt wurde, um einen besonderen Typus der Reformation in bestimmten Hansestädten zu beschreiben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Reformation in Rostock, die aufgrund ihrer territorial- und kirchenpolitischen Voraussetzungen von besonderem Interesse ist. Die politische Situation in Mecklenburg zu Beginn des 16. Jahrhunderts wird erläutert, wobei die Bedeutung der geteilten Herrschaft zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. für den Verlauf der Reformation hervorgehoben wird.
2. Das Herzogtum Mecklenburg
2.1 Der frühneuzeitliche Staat
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausbildung des frühneuzeitlichen Territorialstaates in Mecklenburg und die damit verbundenen Reformen unter Herzog Magnus II. Die Zentralisationsbestrebungen Magnus II. zielten darauf ab, die Macht der mecklenburgischen Fürsten zu stärken und die städtische Selbständigkeit, den Adel und die Reichsunmittelbarkeit der Klöster einzuschränken. Die Reformen umfassten die Neuordnung der herzoglichen Verwaltung, die Einführung der Landbede, die Durchsetzung der herzoglichen Gerichtsbarkeit und die Stärkung des Einflusses auf die Geistlichkeit und die Bistümer.
3. Die Rostocker Reformation
Dieses Kapitel wird sich mit der Reformation in Rostock befassen und die chronologische Darstellung der Reformationsereignisse sowie die Einflussnahme der Herzöge auf die Reformation analysieren. Die Arbeit wird anhand von einzelnen Beispielen die tatsächliche Einflussnahme der Herzöge auf wichtige Ereignisse der Rostocker Reformationsgeschichte untersuchen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen dieses Aufsatzes sind: Hansestadtreformation, Reformation in Rostock, mecklenburgische Herzöge, Heinrich V., Albrecht VII., Magnus III., Bistum Schwerin, frühneuzeitlicher Territorialstaat, politische Situation in Mecklenburg, Einflussnahme der Herzöge, Rostocker Reformationsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Heinz Schilling unter dem Begriff „Hansestadtreformation“?
Es bezeichnet einen Reformationstypus in Hansestädten, der eng mit dem Aufstieg des frühneuzeitlichen Territorialstaates verknüpft war.
Welche Rolle spielten die Herzöge Heinrich V. und Albrecht VII. in Rostock?
Trotz der Landesteilung unterstellten sie Rostock einer gemeinschaftlichen Regierung, was ihren Einfluss auf den dortigen Reformationsprozess sicherte.
Wie beeinflusste Herzog Magnus II. die Stadt Rostock?
Er trieb die Zentralisierung voran, stärkte die herzogliche Verwaltung und schränkte die städtische Selbstständigkeit ein.
War die Rostocker Reformation ein rein religiöser Prozess?
Nein, sie war stark von territorialpolitischen Machtkämpfen zwischen den Fürsten und der Stadt geprägt.
Welcher Zeitraum wird in dieser Untersuchung betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die historischen Ereignisse in Rostock bis zum Jahr 1540.
- Citation du texte
- Sebastian Rosche (Auteur), 2001, Die Herzöge von Mecklenburg und die Reformation in der Hansestadt Rostock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147652