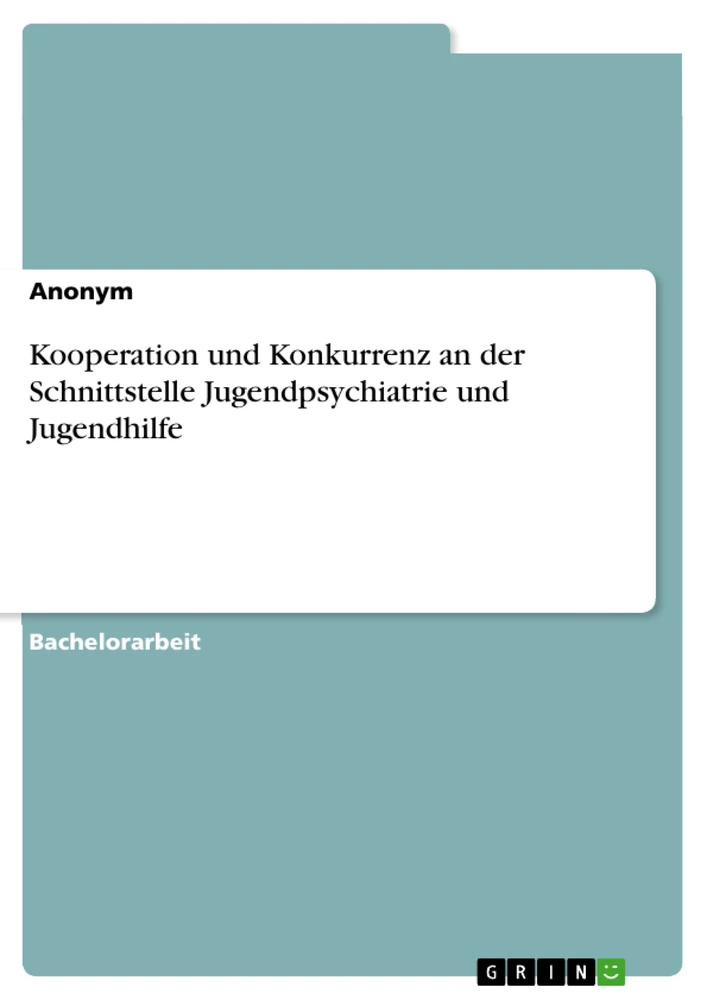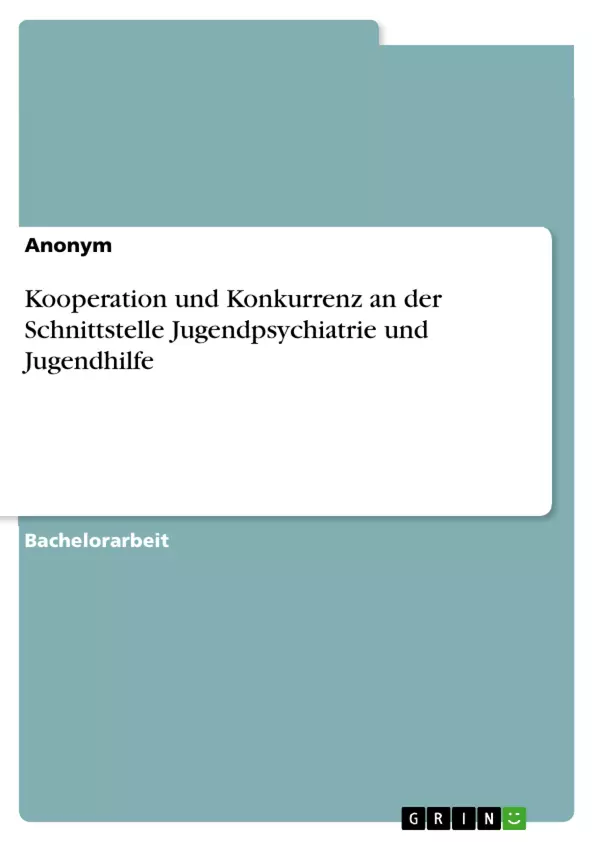Die Arbeit behandelt die Thematik der Kooperation zwischen den zwei Systemen Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie setzt sich mit der Frage "Wie müssen Kooperationsvereinbarungen gestaltet sein, um ein optimales Gesamthilfesystem für Kinder und Jugendliche zu schaffen?" auseinander.
Im September 2019 lief der Film "Systemsprenger" das erste Mal auf den Leinwänden der deutschen Kinos. Das Mädchen Benni ist neun Jahre alt und kann nicht bei ihrer überforderten Mutter leben. Sie wechselt zwischen Pflegefamilien, Heimen und Wohngruppen, weil sie aufgrund ihrer aggressiven Gewalttaten untragbar zu sein scheint. Der Rettungswagen bringt sie wöchentlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, von dort aus kommt sie in die nächste Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Begrifflichkeit Systemsprenger zeigt die Machtlosigkeit der verschiedenen Helfersysteme eindrücklich. Als Systemsprenger werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die innerhalb des Systems keinen festen Ort finden, stattdessen werden sie von Heimen, Pflegefamilien und Psychiatrien hin und her geschoben. In diesem dramatischen, preisgekrönten Film wird die Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie gut veranschaulicht.
Zunächst geben der erste und zweite Teil einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der Systeme der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im ersten Kapitel werden die strukturellen Rahmenbedingen der Kinder- und Jugendhilfe und darüber hinaus die Hilfen zur Erziehung ausführlich beschrieben, da dort der größte Kooperationsbedarf mit der Jugendpsychiatrie herrscht. Anschließend wird in der Darstellung des Klientenprofils auf die Zielgruppe und deren Lebenssituation eingegangen. Konkretisiert werden die Hilfen zur Erziehung in Form der Heimerziehung und deren Handlungsspielräumen. Das zweite Kapitel gibt einen strukturellen Überblick über das System der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es werden die Ursachen, Klassifikation und Diagnostik der psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter näher erläutert. Im Anschluss daran werden Behandlungsarten im stationären und ambulanten Rahmen aufgeführt und Therapiearten beschrieben. Zur Vereinfachung werden in dieser Arbeit die Begriffe Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie KJP und JH gleichbedeutend benutzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Kinder- und Jugendhilfe
- Strukturen und Aufgaben der Jugendhilfe
- Hilfen zur Erziehung
- Die Adressaten
- Pädagogik in der Heimerziehung
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Allgemeine Rahmenbedingungen
- Multiaxiale Klassifikation
- Behandlungsarten
- Psychotherapie und Psychopharmaka Therapie
- Das Verhältnis Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie
- Gemeinsamer Auftraggeber
- Konfliktlinien
- Kriterien gelingender Kooperation
- Vergleich bestehender Kooperationsvereinbarungen
- Kooperation als Handlungsprinzip
- Bestehende Arbeitshilfen
- Saarland
- Mecklenburg-Vorpommern
- Westfalen-Lippe
- Vergleichskriterien
- Ergebnisse
- Bedarfsanalyse und Ausgangslage
- Zielsetzung
- Aufgabenbereich
- Übergangsgestaltung
- Konflikt- und Krisenregelung
- Material zur praktischen Umsetzung
- Qualitätssicherung
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie und stellt die Frage, wie Kooperationsvereinbarungen gestaltet sein müssen, um ein optimales Gesamthilfesystem für Kinder und Jugendliche zu schaffen.
- Strukturen und Aufgaben der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie
- Die gemeinsame Zielgruppe und deren spezifischen Herausforderungen
- Konflikte und Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie
- Kriterien und Beispiele gelingender Kooperation
- Analyse bestehender Kooperationsvereinbarungen in verschiedenen Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die beiden Systeme der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie. Sie beschreibt die strukturellen Rahmenbedingungen, die Aufgabenfelder und die Zielgruppe beider Systeme. Dabei werden die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe sowie die Behandlungsarten in der Jugendpsychiatrie detailliert dargestellt.
Im dritten Kapitel werden die Herausforderungen und Chancen der interprofessionellen Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die gemeinsame Zielgruppe, die „Grenzgänger“, und identifiziert wichtige Konfliktlinien, die die Zusammenarbeit erschweren.
Das vierte Kapitel analysiert drei verschiedene Kooperationsvereinbarungen aus Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Westfalen-Lippe. Es werden die wichtigsten Inhalte der Vereinbarungen sowie deren Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie dargestellt.
Der fünfte Teil der Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse der Kooperationsvereinbarungen zusammen.
Schlüsselwörter
Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie, Kooperation, interprofessionelle Zusammenarbeit, Hilfen zur Erziehung, psychische Störungen, „Grenzgänger“, Kooperationsvereinbarung, Bedarfsanalyse, Qualitätssicherung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Kooperation und Konkurrenz an der Schnittstelle Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1476988