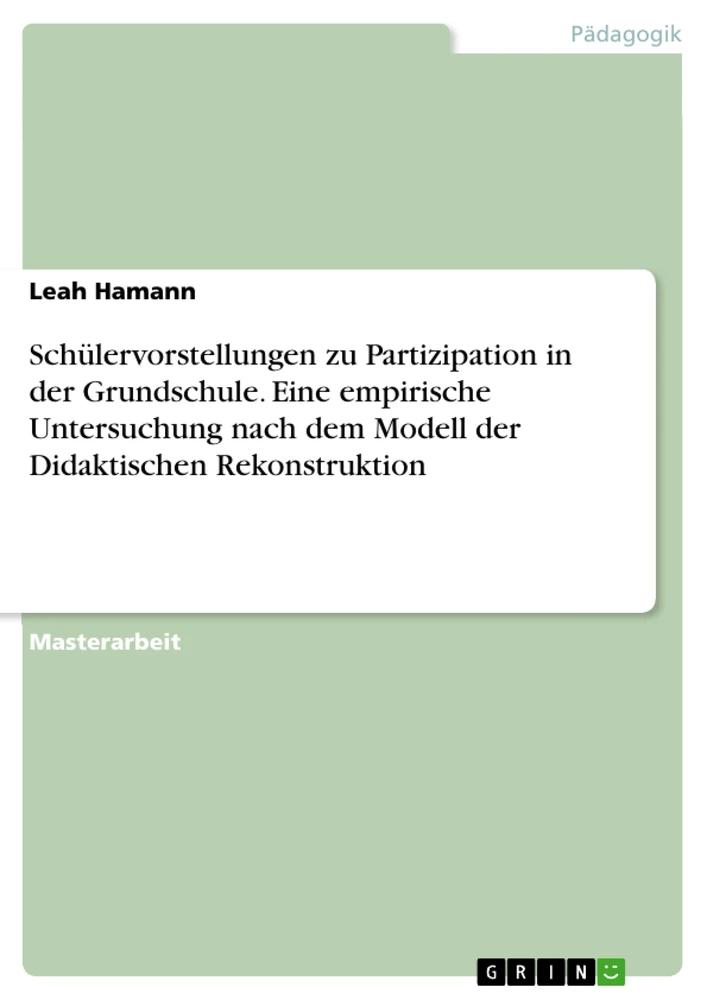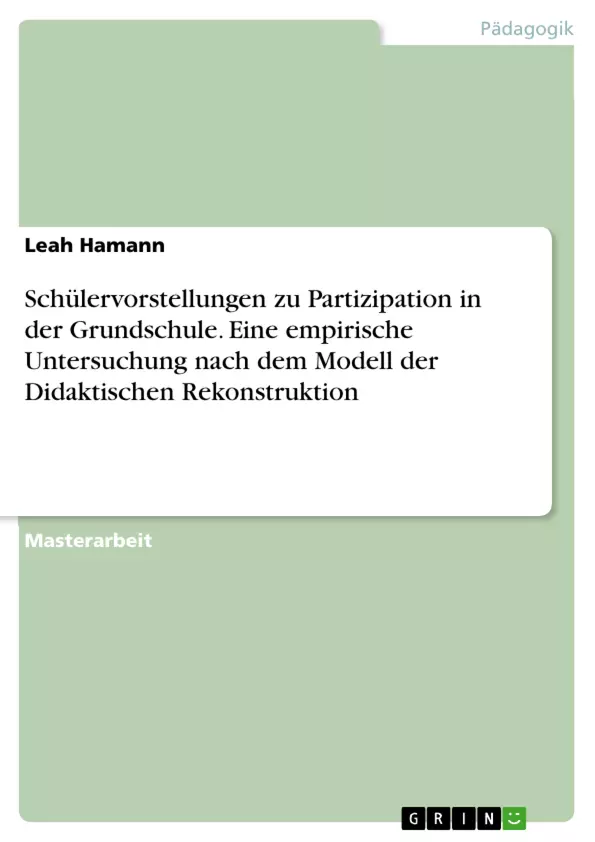Diese Arbeit untersucht die Vorstellungen von Grundschüler:innen der dritten und vierten Jahrgangsstufe zur Partizipation in der Schule. Ziel ist es, die Meinungen dieser Schüler:innen zu erfassen und mit dem fachwissenschaftlichen Diskurs über Partizipation zu vergleichen. Die Untersuchung folgt dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion und nutzt leitfadenorientierte Kleingruppeninterviews als qualitative Forschungsmethode. Im zweiten Kapitel wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion eingeordnet. Das dritte Kapitel bietet eine ausführliche Darstellung der fachlichen Perspektive, einschließlich diverser Begriffsdefinitionen und Modelle zur Partizipation sowie spezifischer Überlegungen zur schulischen Partizipation.
Das vierte Kapitel beschreibt den Forschungsprozess und begründet die Wahl der qualitativen Forschungsmethoden und der Stichprobe. Die zentralen Ergebnisse der Interviews werden im fünften Kapitel präsentiert. Im sechsten Kapitel erfolgt ein wechselseitiger Vergleich zwischen den Schüler:innen und der fachlichen Perspektive. Im siebten Kapitel werden gemäß dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion didaktische Strukturierungen vorgenommen und Handlungsempfehlungen für die Partizipationsforschung in der Grundschule aufgezeigt. Abschließend werden die zentralen Elemente der Arbeit in den Schlussbetrachtungen resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
- Fachliche Klärung
- Partizipation - eine begriffliche Annäherung
- Demokratische Partizipation
- Modelle der Partizipation
- Merkmale schulischer Partizipation
- Klassenrat
- Klassensprecher
- Herausforderungen im Zusammenhang mit schulischer Partizipation
- Zusammenfassung
- Partizipation - eine begriffliche Annäherung
- Erhebung der Schülerperspektive
- Schülervorstellungen – eine begriffliche Annäherung
- Fragestellung
- Methodenauswahl
- Der Interview-Leitfaden
- Daten
- Datenauswahl
- Datenerfassung
- Datenaufbereitung
- Ergebnisse der Untersuchung – geordnete Aussagen
- FIONA UND ISABELL
- Gedankenexperiment Schulhofgestaltung
- Partizipation in der Schule
- Klassensprecher
- Klassenrat
- FINN UND MAX
- Gedankenexperiment Schulhofgestaltung
- Partizipation in der Schule
- Klassensprecher
- Klassenrat
- JACOB UND JAN
- Gedankenexperiment Schulhofgestaltung
- Partizipation in der Schule
- Klassensprecher
- Klassenrat
- LIA UND ANNA
- Gedankenexperiment Schulhofgestaltung
- Partizipation in der Schule
- Klassensprecher
- Klassenrat
- Vorstellungen im Vergleich
- Gedankenexperiment Schulhofgestaltung
- Partizipation in der Schule
- Klassensprecher
- Klassenrat
- FIONA UND ISABELL
- Wechselseitiger Vergleich
- Mitbestimmung
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Fazit
- Klassenrat
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Fazit
- Mitbestimmung
- Didaktische Strukturierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Vorstellungen von Grundschulkindern bezüglich Partizipation. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Perspektiven der Kinder auf Mitbestimmungsprozesse in der Schule zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Praxis der Partizipation in der Grundschule zu verbessern und die Demokratieerziehung zu fördern.
- Schülervorstellungen von Partizipation
- Konzepte von Mitbestimmung in der Grundschule
- Analyse von Klassenrat und Klassensprecher als Partizipationsformen
- Herausforderungen bei der Umsetzung schulischer Partizipation
- Didaktische Implikationen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schülerpartizipation in der Grundschule ein und begründet die Relevanz der Arbeit vor dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskonvention, der Bedeutung der Demokratieerziehung und aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie unterstreicht die zentrale Rolle der Grundschule bei der Demokratieerziehung und verweist auf pädagogische, rechtliche und gesellschaftliche Begründungslinien für die Auseinandersetzung mit dem Thema.
Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion: Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit, welches auf dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion basiert. Es erläutert die einzelnen Schritte dieses Modells und wie es in der vorliegenden Arbeit angewendet wird, um die Schülervorstellungen zu Partizipation zu rekonstruieren.
Fachliche Klärung: Dieses Kapitel bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Partizipation, unterscheidet verschiedene Modelle und Merkmale schulischer Partizipation, insbesondere Klassenrat und Klassensprecher. Es beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Umsetzung schulischer Partizipation verbunden sind, und fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen.
Erhebung der Schülerperspektive: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Erhebung. Es erläutert die begriffliche Annäherung an Schülervorstellungen, die Forschungsfrage, die gewählte Methode (Interviews), den Aufbau des Interviewleitfadens und die Datenaufbereitung.
Ergebnisse der Untersuchung – geordnete Aussagen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit verschiedenen Schülergruppen (Fiona/Isabell, Finn/Max, Jacob/Jan, Lia/Anna). Die Ergebnisse werden anhand von Gedankenexperimenten zur Schulhofgestaltung und der Beschreibung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule, der Rolle des Klassensprechers und des Klassenrates dargestellt und analysiert.
Wechselseitiger Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der einzelnen Interviews und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Schülervorstellungen zu Mitbestimmung und Klassenrat. Die Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen.
Schlüsselwörter
Partizipation, Grundschule, Schülervorstellungen, Mitbestimmung, Demokratieerziehung, Klassenrat, Klassensprecher, empirische Forschung, Qualitative Forschung, Didaktische Rekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Schülervorstellungen zur Partizipation in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Vorstellungen von Grundschulkindern bezüglich Partizipation und Mitbestimmung in der Schule. Sie analysiert die Perspektiven der Kinder auf Mitbestimmungsprozesse und zielt darauf ab, die Praxis der Partizipation in der Grundschule zu verbessern und die Demokratieerziehung zu fördern.
Welche Methode wurde in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Die empirische Erhebung erfolgte mittels Interviews mit verschiedenen Schülergruppen. Die Ergebnisse werden qualitativ analysiert und verglichen.
Welche Aspekte der Partizipation werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Partizipation, darunter Schülervorstellungen von Partizipation, Konzepte von Mitbestimmung in der Grundschule, die Analyse von Klassenrat und Klassensprecher als Partizipationsformen, Herausforderungen bei der Umsetzung schulischer Partizipation und die didaktischen Implikationen für die Praxis.
Welche konkreten Partizipationsformen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Klassenrat und Klassensprecher als Formen der Partizipation in der Grundschule. Die Schülervorstellungen zu diesen Formen werden im Detail untersucht.
Wie wurden die Daten erhoben und ausgewertet?
Die Daten wurden mittels Interviews erhoben. Der Interviewleitfaden enthielt Fragen zum Gedankenexperiment „Schulhofgestaltung“ sowie Fragen zur Partizipation in der Schule, zur Rolle des Klassensprechers und des Klassenrates. Die Daten wurden anschließend qualitativ ausgewertet und verglichen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit verschiedenen Schülergruppen. Die Ergebnisse werden anhand von Gedankenexperimenten zur Schulhofgestaltung und der Beschreibung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule, der Rolle des Klassensprechers und des Klassenrates dargestellt und analysiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Schülervorstellungen werden im Vergleich herausgearbeitet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen und gibt didaktische Implikationen für die Praxis der Partizipation in der Grundschule an. Sie trägt dazu bei, ein tieferes Verständnis für die Perspektiven der Kinder auf Mitbestimmungsprozesse zu entwickeln.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Partizipation, Grundschule, Schülervorstellungen, Mitbestimmung, Demokratieerziehung, Klassenrat, Klassensprecher, empirische Forschung, Qualitative Forschung, Didaktische Rekonstruktion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum Modell der Didaktischen Rekonstruktion, ein Kapitel zur fachlichen Klärung des Begriffs Partizipation, ein Kapitel zur Erhebung der Schülerperspektive, ein Kapitel mit den Ergebnissen der Untersuchung, ein Kapitel zum wechselseitigen Vergleich der Ergebnisse und abschließend eine didaktische Strukturierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrer*innen der Grundschule, Schulentwickler*innen und alle, die sich mit der Partizipation von Kindern und der Demokratieerziehung in der Schule auseinandersetzen.
- Quote paper
- Leah Hamann (Author), 2024, Schülervorstellungen zu Partizipation in der Grundschule. Eine empirische Untersuchung nach dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1478486