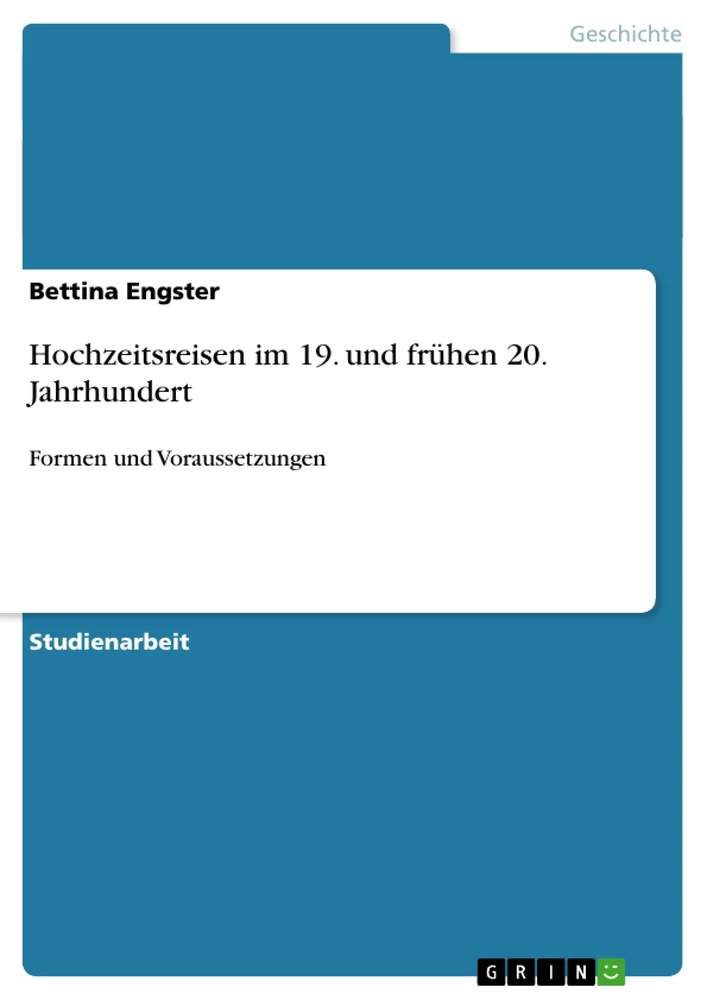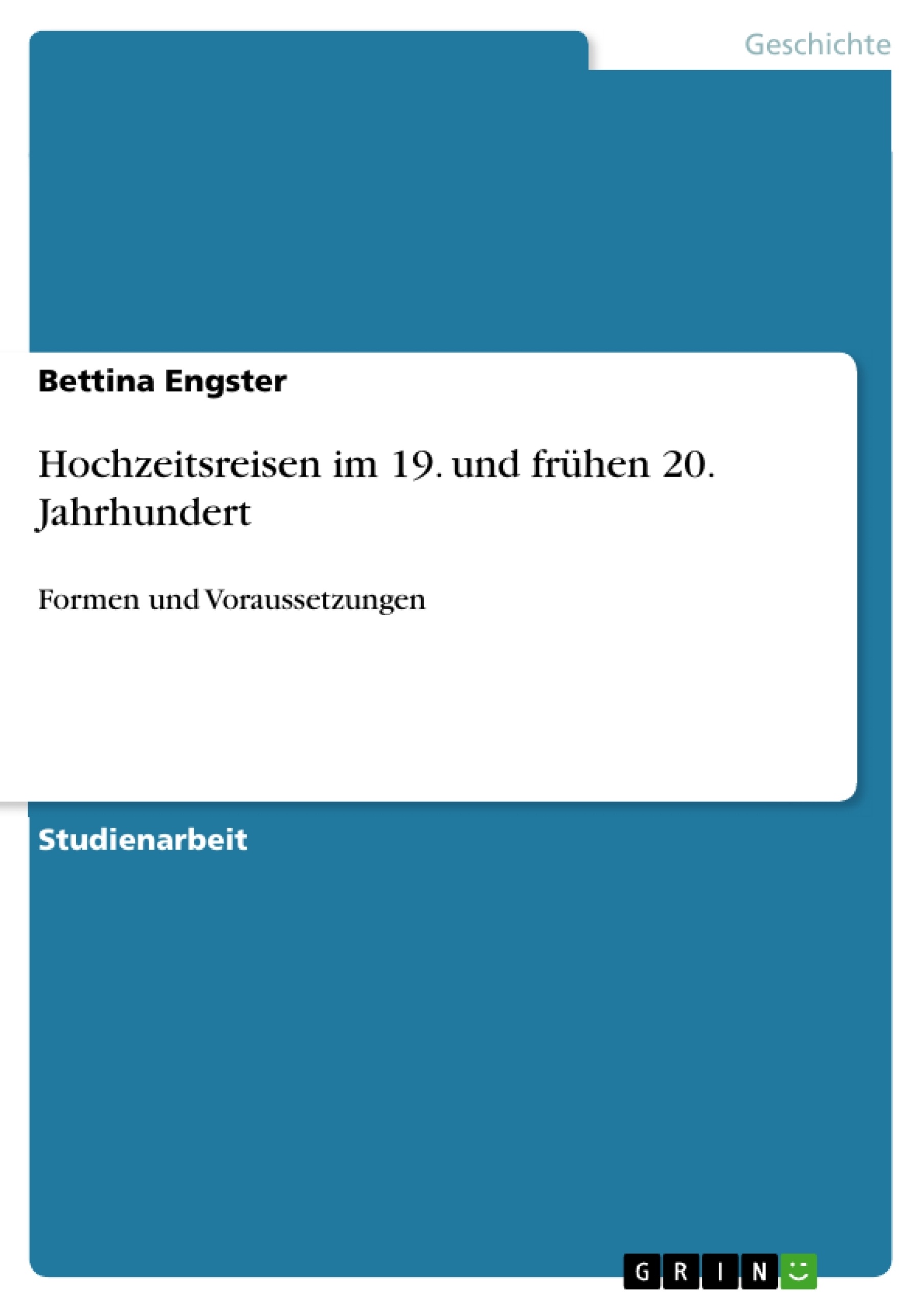Im Gegensatz zur Literatur des ‚langen’ 19. Jahrhunderts scheint das 20. und 21. Jahrhundert das Interesse an dieser Art von Reise verloren zu haben. Dies hat sicherlich damit zu tun, daß das Reisen in den Alltag vieler Menschen von heute gehört. Zwar sind auch heute noch viele Hotels mit einer Hochzeitssuite ausgestattet, doch unterscheidet diese sich von den übrigen Hotelzimmern meist nur durch ein großes Doppelbett. Wenn noch immer Hochzeitsreisen unternommen werden, so sind es vermutlich ganz andere Gründe aus denen das Ehepaar nach der Hochzeit für einige Zeit dem Alltag entflieht und zusammen verreist, als im 19. Jahrhundert. Ein wichtiger Unterschied liegt etwa darin, daß viele Paare vor ihrer Heirat bereits zusammenleben und vielfach sicherlich auch zusammen verreist sind. Somit ist häufig das Be-dürfnis, auf Hochzeitsreise zu fahren, nicht mehr vorhanden. Noch im 19. Jahrhundert war es hingegen so, daß Mann und Frau vor der Ehe kaum intimeren Kontakt zueinander hatten und sich vielfach auch nur flüchtig kannten. Die Phase des Kennenlernens fand daher oft erst nach der Hochzeit statt, wenn das Paar in einen gemeinsamen Haushalt zog.
Es liegt nahe, zwischen den Veränderungen der Reisemöglichkeiten und der verstärkten Neigung zu Hochzeitsreisen einen Zusammenhang zu vermuten. Neben den zwei Haupttypen der Ferienreise, namentlich des Kurortes und der Sommerfrische, bildete sie sich als Sonderform heraus. Thomas Nipperdey verweist auf die zunehmende Zahl von Bildungsreisen, „in Deutschland etwa als Hochzeitsreise nach Venedig und Florenz.“ Zumindest wurde nicht länger nur dann gereist, wenn es nicht zu vermeiden war. Auch zum Vergnügen ließen sich mitun-ter ausgedehnte Reisen unternehmen. Meyers Lexikon stellt hierzu fest, daß „umgekehrt […] größerer Wohlstand zu Vergnügungsreisen [veranlaßt], die sich in neuster Zeit auf außerordentliche Entfernungen ausgedehnt haben, so daß selbst Reisen um die Erde unternommen werden.“ Wesentlich ist aber nicht nur dies, sondern auch die Tatsache, daß zum Reisen noch immer Voraussetzungen erforderlich waren, die nicht jedem Zeitgenossen zugänglich waren. Außer der Bereitschaft hierzu, mußte nicht nur ein gewisser Wohlstand, sondern auch freie Zeit vorhanden sein. Immerhin wurde im späten 19. Jahrhundert der Grundstock für den heutigen Tourismus gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hochzeitsreise – Versuch einer Definition
- Die Hochzeitsreise – Dimensionen einer Praxis
- Schlußfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hochzeitsreise im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland. Ziel ist es, das Phänomen der Hochzeitsreise zu definieren, ihre Praxis zu beschreiben und die sozioökonomischen und kulturellen Voraussetzungen zu analysieren. Die Arbeit basiert auf literarischen Texten und autobiografischen Quellen der Zeit.
- Definition und Entwicklung des Begriffs "Hochzeitsreise"
- Soziale und ökonomische Voraussetzungen für Hochzeitsreisen
- Genutzte Verkehrsmittel und Reiseziele
- Motive und Normen der Hochzeitsreise
- Bedeutung der Hochzeitsreise im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Hochzeitsreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein. Sie hebt die Besonderheit der Hochzeitsreise als Reiseform hervor und verweist auf die Relevanz literarischer und autobiografischer Quellen für die Untersuchung. Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen der Quellenarbeit, insbesondere die unterschiedliche Wertigkeit literarischer und autobiografischer Quellen in der Geschichtswissenschaft und die potenziellen Verzerrungen in autobiografischen Berichten. Die Einleitung stellt schließlich zentrale Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden sollen, wie z.B. wer auf Reisen war, welche Verkehrsmittel genutzt wurden und welche Motive die Hochzeitsreisen bestimmten.
Die Hochzeitsreise – Versuch einer Definition: Dieses Kapitel unternimmt den Versuch, den Begriff "Hochzeitsreise" anhand von Lexikoneinträgen des 19. Jahrhunderts zu definieren. Es wird der Wandel der Hochzeitsrituale und Reisegewohnheiten beleuchtet, wobei der zunehmende Komfort des Reisens durch Verbesserungen der Verkehrsmittel und internationale Beziehungen hervorgehoben wird. Der Zusammenhang zwischen dem Aufschwung der Eisenbahn und Dampfschifffahrt und dem steigenden Interesse an Hochzeitsreisen wird analysiert. Das Kapitel verortet die Hochzeitsreise als eine Sonderform des Reisens neben Kurorten und Sommerfrische, die durch eine zunehmende Wohlhabenheit und verfügbare Freizeit begünstigt wurde.
Die Hochzeitsreise – Dimensionen einer Praxis: Dieses Kapitel analysiert die Praxis der Hochzeitsreise anhand von Beispielen aus literarischen Werken und autobiografischen Quellen. Es wird deutlich, dass Hochzeitsreisen überwiegend von Angehörigen der oberen und oberen Mittelschicht unternommen wurden. Das Kapitel untersucht die genutzten Verkehrsmittel (Eisenbahn, Dampfschiff) und Reiseziele, wobei Italien eine beliebte Destination war. Die Rolle von Hotels als Unterbringungsmöglichkeit wird diskutiert. Die Bedeutung von Zeit und Geld als Voraussetzungen für Hochzeitsreisen, sowie die Motive (Flucht vor der Familie, Bildung, Vergnügen, geschäftliche Interessen) werden umfassend untersucht. Schließlich werden Normen und Regeln der Hochzeitsreise, wie z.B. der Reisezeitpunkt und die Kostenübernahme, erörtert.
Schlüsselwörter
Hochzeitsreise, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Reiseverhalten, Verkehrsmittel (Eisenbahn, Dampfschiff), Soziale Schicht, Reisemotive, Bildung, Vergnügen, Gesellschaftliche Veränderungen, Autobiografie, Literatur, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hochzeitsreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Hochzeitsreise im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland. Sie definiert die Hochzeitsreise, beschreibt ihre Praxis und analysiert die sozioökonomischen und kulturellen Voraussetzungen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf literarischen Texten und autobiografischen Quellen aus der entsprechenden Zeit. Die Arbeit thematisiert dabei auch die Herausforderungen der Quellenarbeit, insbesondere die unterschiedliche Wertigkeit literarischer und autobiografischer Quellen und die potenziellen Verzerrungen in autobiografischen Berichten.
Wie wird der Begriff "Hochzeitsreise" definiert?
Das Kapitel "Die Hochzeitsreise – Versuch einer Definition" untersucht den Begriff anhand von Lexikoneinträgen des 19. Jahrhunderts und beleuchtet den Wandel der Hochzeitsrituale und Reisegewohnheiten. Der Zusammenhang zwischen dem Aufschwung der Eisenbahn und Dampfschifffahrt und dem steigenden Interesse an Hochzeitsreisen wird analysiert. Die Hochzeitsreise wird als Sonderform des Reisens neben Kurorten und Sommerfrische verortet.
Wer unternahm Hochzeitsreisen?
Die Analyse der Praxis der Hochzeitsreise (Kapitel "Die Hochzeitsreise – Dimensionen einer Praxis") zeigt, dass Hochzeitsreisen überwiegend von Angehörigen der oberen und oberen Mittelschicht unternommen wurden.
Welche Verkehrsmittel und Reiseziele waren üblich?
Es wurden hauptsächlich Eisenbahn und Dampfschiff genutzt. Italien war ein beliebtes Reiseziel. Das Kapitel beschreibt die Rolle von Hotels und diskutiert die Bedeutung von Zeit und Geld als Voraussetzungen für Hochzeitsreisen.
Welche Motive gab es für Hochzeitsreisen?
Die Motive für Hochzeitsreisen waren vielfältig und umfassten Flucht vor der Familie, Bildung, Vergnügen und geschäftliche Interessen. Das Kapitel erläutert diese Motive detailliert.
Welche Normen und Regeln bestimmten Hochzeitsreisen?
Das Kapitel "Die Hochzeitsreise – Dimensionen einer Praxis" erörtert Normen und Regeln der Hochzeitsreise, wie z.B. den Reisezeitpunkt und die Kostenübernahme.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hochzeitsreise, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Reiseverhalten, Verkehrsmittel (Eisenbahn, Dampfschiff), Soziale Schicht, Reisemotive, Bildung, Vergnügen, Gesellschaftliche Veränderungen, Autobiografie, Literatur, Quellenkritik.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Versuch einer Definition der Hochzeitsreise, ein Kapitel zu den Dimensionen der Praxis der Hochzeitsreise und abschließende Schlussfolgerungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der Hochzeitsreise zu definieren, ihre Praxis zu beschreiben und die sozioökonomischen und kulturellen Voraussetzungen zu analysieren.
- Quote paper
- Bettina Engster (Author), 2003, Hochzeitsreisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147991