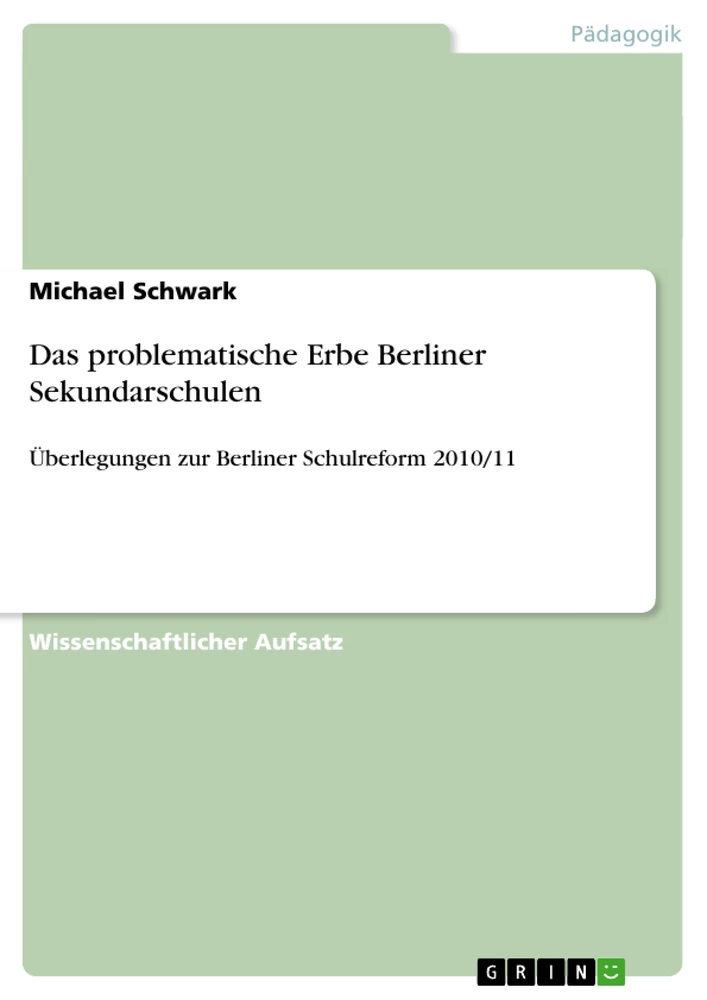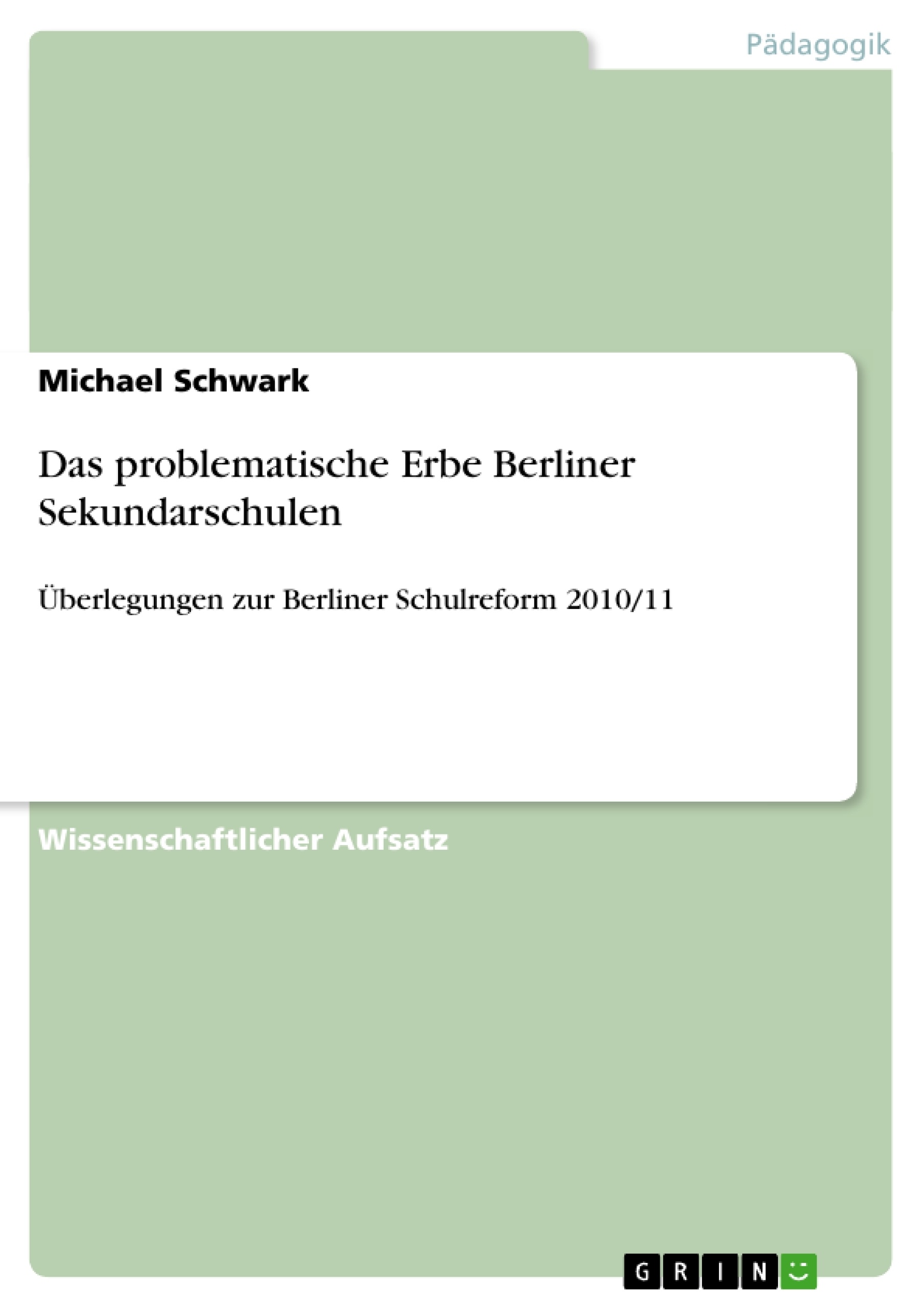In Berlin steht eine Bildungsreform an, die Hamburg bereits durchlaufen und jüngst bildungspolitische Diskussionen in Bayern ausgelöst hat. Ziel der Berliner Reform ist
die Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems.
Der Berliner Senat strebt über die Reform gute Bildungschancen für alle Kinder an, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Begründet in den sinkenden Schülerzahlen
an Berliner Hauptschulen und den dort herrschenden schwierigen Lern- und Entwicklungsmilieus sieht er in der Sekundarschule die Chance, die Zahl der Schüler zu verringern, die keinen Abschluss oder ihren Abschluss nur stark verzögert erlangen.
Der Handlungsbedarf ist eindeutig gegeben. Laut aktuellem Bildungsbericht verzeichnete das Land Berlin im Jahr 2007 3295 Schüler, die ein Abgangszeugnis erhielten. Ein Abgangszeugnis zu erhalten meint, keinen allgemeinen Schulabschluss
zu erlangen. Somit haben im Schuljahr 2007/08 10,7 Prozent aller Schüler der Berliner allgemeinbildenden Schulen keinen Befähigungsnachweis erhalten, um sich auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einzubringen. Über die Hälfte dieser
Schüler scheitert auf den Berliner Hauptschulen. Deren Hälfte besitzt einen Migrationshintergrund, gekoppelt an eine nichtdeutsche Herkunftssprache, 30 Prozent sind Ausländer, sind also nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.3
Die Reform betrifft strukturell im Wesentlichen die Punkte Leistungsdifferenzierung, Stundentafel, Ganztagsbetrieb und Duales Lernen.
Vor allem der erste Punkt stößt aber zunehmend auf Kritik seitens der Lehrerverbände, Oppositionsparteien und auch der Eltern, weil spezifische Bestimmungen für Schulen nur vage formuliert worden sind. Es obliegt der einzelnen Schule selbst, zu entscheiden, ob sie ihren Unterricht binnendifferenziert
gestaltet oder aber, wie bisher an Berliner Gesamtschulen üblich, nach Leistungsniveau gestaffelte Kurse anbietet.
Dieser Aufsatz soll nicht die Sekundarschule und das altangestammte dreigliedrige Bildungsmodell qualitativ gegeneinander abwägen. Statt einer solchen
zukunftsorientierten Diskussion, die viele Unbekannte einschließt, soll vielmehr das problematische Erbe der Berliner Hauptschulen erörtert werden. Denn die
Hauptschule nimmt, das gilt es herauszustellen, in Berlin im Vergleich zum Rest der Bundesrepublik eine Sonderstellung ein. Es muss zunächst geklärt werden, welche gesellschaftspolitische Rolle der Hauptschule in der Berliner Bildungslandschaft
zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemschule Hauptschule
- 2.1 Die Hauptschule im bundesdeutschen Bildungssystem
- 2.2 Zur Problemlage an Berliner Hauptschulen
- 2.3 Das problematische Erbe der Sekundarschulen und Lösungsansätze
- 2.3.1 Motivationsbereitschaft und Erfolgserwartung
- 2.3.2 Schuldistanz und ihre Auswirkungen
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht das problematische Erbe der Berliner Hauptschulen im Kontext der geplanten Schulreform 2010/11. Er analysiert die Herausforderungen, denen sich die neuen Sekundarschulen stellen müssen, insbesondere die mangelnde Motivation und Erfolgserwartung sowie die zunehmende Schuldistanz bei Hauptschülern in ausgewählten Berliner Bezirken.
- Die Rolle der Hauptschule im deutschen Bildungssystem
- Die spezifischen Probleme Berliner Hauptschulen
- Defizite in der Motivationsbereitschaft und Erfolgserwartung bei Hauptschülern
- Zunehmende Schuldistanz und deren Auswirkungen
- Potentielle Lösungsansätze der Schulreform
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Berliner Schulreform ein und benennt das zentrale Problem: das problematische Erbe der Berliner Hauptschulen. Sie skizziert die geplante Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems und die Zusammenlegung von Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Sekundarschulen. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Analyse der Herausforderungen hervor, um den Erfolg der Reform zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der defizitären Motivationsbereitschaft und Erfolgserwartung sowie der wachsenden Schuldistanz bei Hauptschülern in den Bezirken Kreuzberg-Friedrichshain, Neukölln und Mitte.
2. Problemschule Hauptschule: Dieses Kapitel analysiert die Hauptschule als Schulform. Es beginnt mit einer kurzen Darstellung ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihres Bildungsauftrags im bundesdeutschen Kontext. Im Anschluss wird die Situation an Berliner Hauptschulen kritisch beleuchtet, wobei die Frage nach der Berechtigung des Begriffs "Problemschule" im Mittelpunkt steht. Das Kapitel untersucht gesellschaftliche Stigmatisierungen der Hauptschule und ihrer Schüler und stellt fest, dass der Berliner Bildungsbericht das Problem nur unzureichend adressiert. Die detaillierte Diskussion der defizitären Motivationsbereitschaft und Erfolgserwartung sowie der hohen Schuldistanz der Schüler verdeutlicht Mängel und Stärken des Reformmodells. Die Analyse der Herausforderungen dient als Grundlage für die Bewertung des Potenzials der Sekundarschule als Lösungsansatz.
2.1 Die Hauptschule im bundesdeutschen Bildungssystem: Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung und den Bildungsauftrag der Hauptschule im bundesdeutschen Bildungssystem, insbesondere im Vergleich zu anderen Schulformen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Praxisbezug und der Berufsorientierung, wobei die Besonderheiten des Berliner Systems, wie der verstärkte Unterricht im Fach Arbeitslehre, hervorgehoben werden. Die Bedeutung von Berufsorientierung und die Bemühungen des Berliner Senats im Kontext der PISA-Ergebnisse werden dargestellt.
2.2 Zur Problemlage an Berliner Hauptschulen: Dieser Abschnitt beschreibt die spezifischen Herausforderungen der Berliner Hauptschulen. Er beleuchtet die hohen Abgangsquoten und die Schwierigkeiten der Hauptschüler auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die demografischen Besonderheiten der Schüler, wie der hohe Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, werden ebenfalls thematisiert. Der Abschnitt liefert statistische Daten, die die Problemlage verdeutlichen und den Handlungsbedarf der Reform begründen.
2.3 Das problematische Erbe der Sekundarschulen und Lösungsansätze: Dieser Abschnitt analysiert die tiefgreifenden Probleme, die die neuen Sekundarschulen angehen müssen. Er fokussiert sich auf die mangelnde Motivation und Erfolgserwartung sowie die zunehmende Schuldistanz bei Hauptschülern. Es wird diskutiert, inwieweit diese Probleme im Bildungsbericht des Berliner Senats abgebildet werden und welche Lösungsansätze das Modell Sekundarschule bietet. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, die Vergangenheit zu analysieren, um die neue Schulform erfolgreich zu etablieren.
Schlüsselwörter
Berliner Schulreform, Hauptschule, Sekundarschule, Motivationsbereitschaft, Erfolgserwartung, Schuldistanz, Migrationshintergrund, Bildungsbericht, dreigliedriges Schulsystem, Ganztagsschule, Berufsorientierung.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Berliner Schulreform
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Analyse untersucht das problematische Erbe der Berliner Hauptschulen im Kontext der geplanten Schulreform 2010/11. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen für die neuen Sekundarschulen, insbesondere der mangelnden Motivation und Erfolgserwartung sowie der zunehmenden Schuldistanz bei Hauptschülern in ausgewählten Berliner Bezirken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse behandelt die Rolle der Hauptschule im deutschen Bildungssystem, die spezifischen Probleme Berliner Hauptschulen, Defizite in der Motivationsbereitschaft und Erfolgserwartung bei Hauptschülern, zunehmende Schuldistanz und deren Auswirkungen sowie potentielle Lösungsansätze der Schulreform. Die Analyse betrachtet die geschichtliche Entwicklung der Hauptschule, gesellschaftliche Stigmatisierungen, demografische Besonderheiten der Schüler (z.B. hoher Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund) und statistische Daten, die die Problemlage verdeutlichen.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Problemschule Hauptschule" mit Unterkapiteln zur Hauptschule im bundesdeutschen System, der Problemlage in Berlin und dem problematischen Erbe für die Sekundarschulen) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen und Analysen zu den jeweiligen Themenbereichen.
Welche konkreten Probleme der Berliner Hauptschulen werden analysiert?
Die Analyse beleuchtet hohe Abgangsquoten, Schwierigkeiten der Hauptschüler auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, mangelnde Motivation und Erfolgserwartung, zunehmende Schuldistanz und die unzureichende Behandlung dieser Probleme im Berliner Bildungsbericht. Der hohe Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund wird ebenfalls thematisiert.
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Analyse untersucht das Potential der Sekundarschule als Lösungsansatz für die Probleme der Berliner Hauptschulen. Sie analysiert, inwieweit das Modell Sekundarschule geeignet ist, die defizitäre Motivationsbereitschaft, die geringe Erfolgserwartung und die hohe Schuldistanz bei den Schülern zu adressieren. Die Notwendigkeit, die Vergangenheit zu analysieren, um die neue Schulform erfolgreich zu etablieren, wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Berliner Schulreform, Hauptschule, Sekundarschule, Motivationsbereitschaft, Erfolgserwartung, Schuldistanz, Migrationshintergrund, Bildungsbericht, dreigliedriges Schulsystem, Ganztagsschule, Berufsorientierung.
Für wen ist diese Analyse gedacht?
Diese Analyse richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Kontext der Berliner Schulreform. Die Daten sind für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Schulreform gedacht.
- Citar trabajo
- Michael Schwark (Autor), 2010, Das problematische Erbe Berliner Sekundarschulen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148050