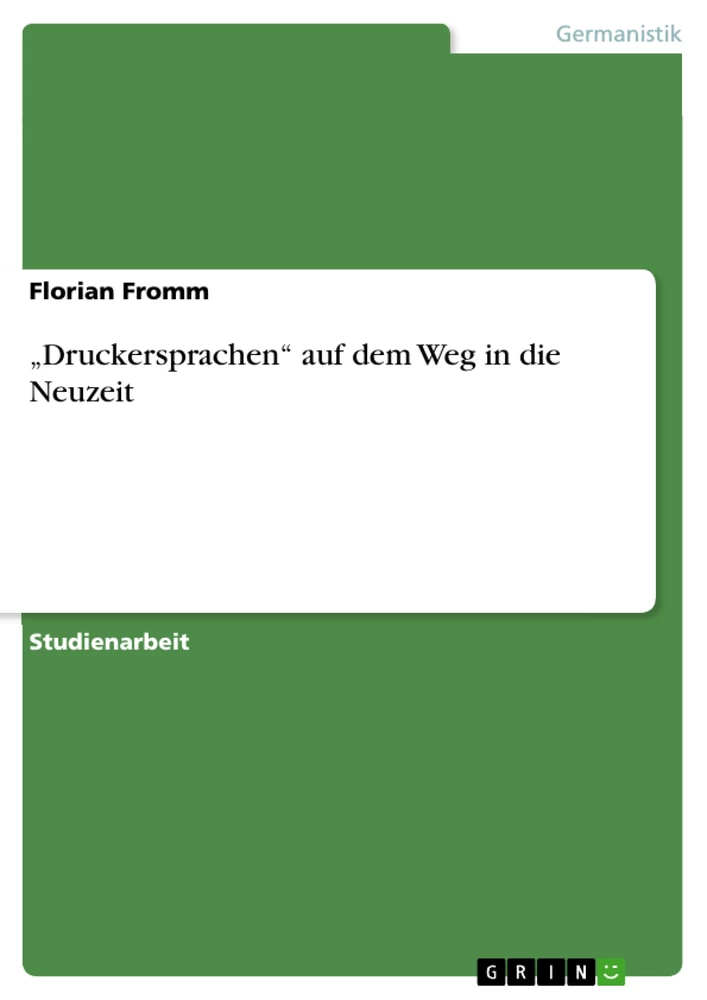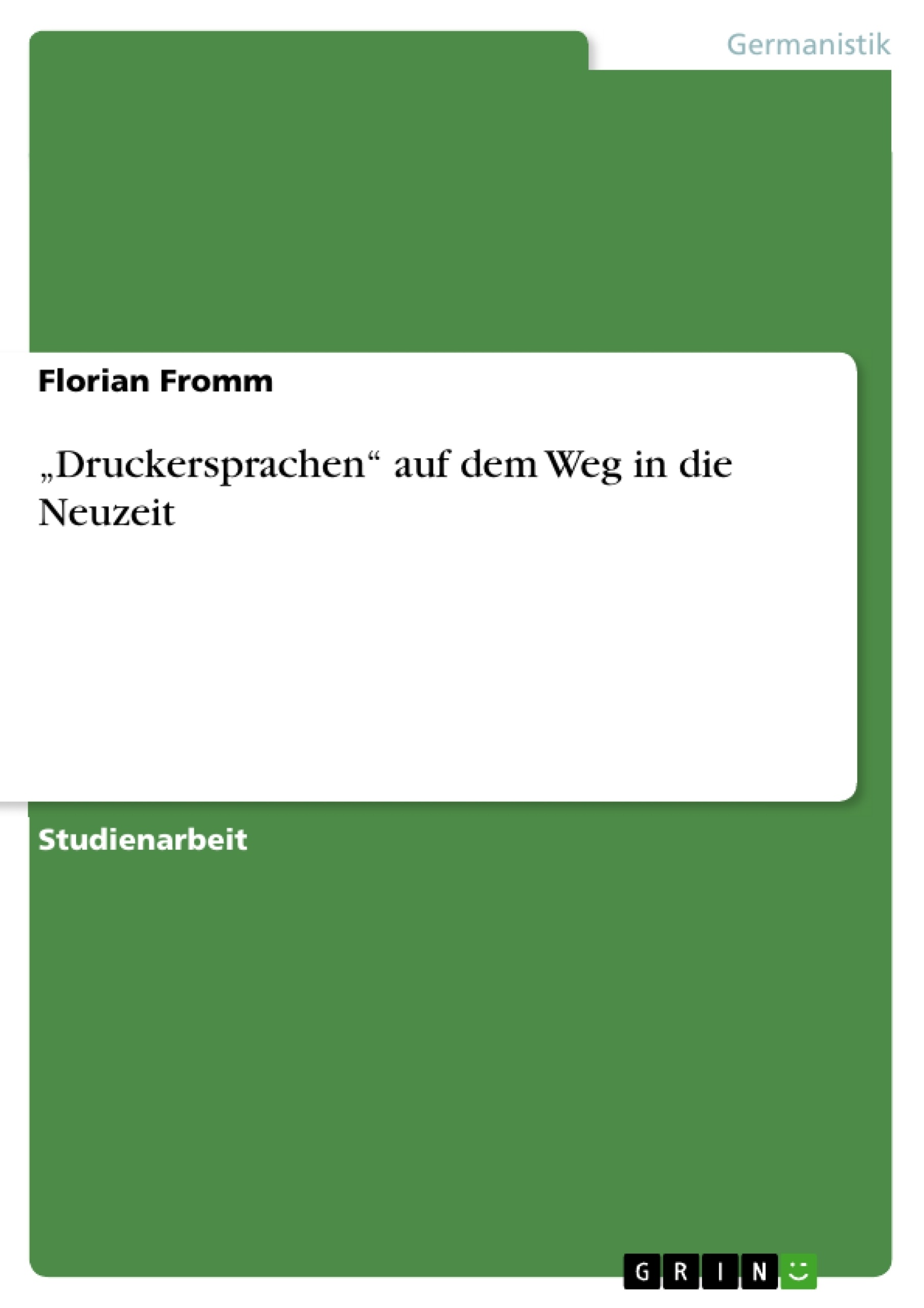In der modernen Forschung wird heutzutage vielfach die Meinung ver-treten, dass die deutsche Sprachnorm mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Geburtsstunde im 16. Jahrhundert gehabt haben könnte. Die noch im Spätmittelalter anzutreffende bunte Variantenvielfalt wird an der Schwelle zur Frühen Neuzeit einer zunehmend beobachtbaren Homogenisierung unterzogen, die den Abbau der durchaus heterogenen und dialektal ge-färbten Sprachlandschaften im Zuge eines Selektionsprozesses zur Fol-ge hatte. Obgleich sich im Zuge dieser Selektion ein Variantenabbau konstatieren lässt, so präsentieren sich gerade diese Jahrhunderte als eine Zeit, in der ebenso, und dies gerade aufgrund einer eingehenden Beschäftigung mit der Schriftsprache, neue Varianten entstehen. Dabei ist an dieser Stelle jedoch zu betonen, dass solche Wandlungs- und Ent-wicklungsprozesse hin zu einer deutschen Norm keineswegs linear ver-laufen sind, sondern dass vielmehr auch Rückschritte, Behinderungen und Stagnation den Weg der deutschen, normierten Schriftsprache mar-kierten und ferner charakterisieren.
Dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit folgend, wird versucht, anhand besonders signifikanter Beispiele und anderen nachgewiesenen Entwick-lungstendenzen, die Bedeutsamkeit und die intensive Verdichtung sprachlicher Entwicklungs- und Homogenisierungsprozesse an der Schwelle zur Frühe Neuzeit aufzuzeigen. Dies geschieht sicherlich aus verschiedensten Motivationen, jedoch in seinem Kern hauptsächlich auf-grund der Tatsache, da ein jeder Mensch tagtäglich von der Errungen-schaft des gedruckten Wortes und seiner einheitlichen Normierung profi-tieren kann und deren Wurzeln nachweislich in jene ausgesprochen fa-cettenreiche Epoche fallen. Ähnlich wie schon die lateinische Redensart zu wissen glaubte:
„Vox audita perit, litera scriptura manet“
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Einleitung
- Besonderheiten der frühneuhochdeutschen Sprache
- Linguistische Entwicklungstendenzen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 15./16. Jahrhundert
- Fortschritt im Wandel der Zeit
- TextsortenSpektrum des frühneuhochdeutschen
- Luthers Signifikanz im Kontext innerdeutscher Sprachentwicklung
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der deutschen Schriftsprache an der Schwelle zur Frühen Neuzeit. Sie beleuchtet die linguistischen Veränderungen und Homogenisierungsprozesse, die zur Herausbildung einer überregionalen Sprachform führten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle der Druckersprachen und der Stadt als Ort sprachlicher Ausgleichsprozesse.
- Entwicklung der deutschen Schriftsprache im 15./16. Jahrhundert
- Rolle der Druckersprachen in der Sprachhomogenisierung
- Sprachliche Veränderungen auf graphematischer, morphologischer und syntaktischer Ebene
- Bedeutung der Städte als Zentren sprachlicher Entwicklung
- Luthers Einfluss auf die Standardisierung der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die Thematik: Dieses einführende Kapitel beleuchtet die These, dass die deutsche Sprachnorm im 16. Jahrhundert entstand. Es beschreibt den Wandel von einer vielfältigen, dialektal geprägten Sprachlandschaft hin zu einer zunehmenden Homogenisierung. Die Arbeit betont, dass dieser Prozess nicht linear verlief und von Rückschritten und Stagnation geprägt war. Die Bedeutung der Stadt als Ort sprachlicher Ausgleichsprozesse wird hervorgehoben, wo bereits im Spätmittelalter eine volgarsprachliche Schriftlichkeit entstand, die regionale und später überregionale Schreib- und Schriftsprachen hervorbrachte. Das Kapitel unterstreicht die alltägliche Relevanz der Errungenschaften jener Epoche für den modernen Menschen, der vom gedruckten Wort und seiner Normierung profitiert.
Linguistische Entwicklungstendenzen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 15./16. Jahrhundert: Dieses Kapitel erörtert die linguistischen Entwicklungstendenzen im 15. und 16. Jahrhundert. Es analysiert den Fortschritt im Wandel der Zeit, das TextsortenSpektrum des Frühneuhochdeutschen und die besondere Bedeutung Luthers für die Entwicklung der deutschen Sprache. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der intensiven Verdichtung sprachlicher Entwicklungs- und Homogenisierungsprozesse an der Schwelle zur Frühen Neuzeit anhand signifikanter Beispiele. Die Kapitelteile beleuchten die komplexen Interaktionen zwischen schriftlicher und mündlicher Kommunikation in der Herausbildung einer einheitlicheren Schriftsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Frühneuhochdeutschen Sprachentwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der deutschen Schriftsprache im 15. und 16. Jahrhundert. Sie untersucht die linguistischen Veränderungen und Homogenisierungsprozesse, die zur Herausbildung einer überregionalen Sprachform führten, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Druckersprachen und der Städte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der deutschen Schriftsprache im 15./16. Jahrhundert, die Rolle der Druckersprachen in der Sprachhomogenisierung, sprachliche Veränderungen auf graphematischer, morphologischer und syntaktischer Ebene, die Bedeutung der Städte als Zentren sprachlicher Entwicklung und Luthers Einfluss auf die Standardisierung der deutschen Sprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel über linguistische Entwicklungstendenzen im Heiligen Römischen Reich im 15./16. Jahrhundert und eine abschließende Betrachtung. Die Einführung beleuchtet den Wandel von einer dialektal geprägten Sprachlandschaft hin zu einer zunehmenden Homogenisierung und betont die Bedeutung der Stadt als Ort sprachlicher Ausgleichsprozesse. Das zweite Kapitel analysiert den Fortschritt im Wandel der Zeit, das TextsortenSpektrum des Frühneuhochdeutschen und Luthers Bedeutung für die Sprachentwicklung.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass die deutsche Sprachnorm im 16. Jahrhundert entstand. Der Prozess wird als nicht-linear beschrieben, geprägt von Rückschritten und Stagnation, wobei die Bedeutung der Stadt als Ort sprachlicher Ausgleichsprozesse hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielt Martin Luther?
Die Arbeit untersucht die besondere Bedeutung Luthers für die Entwicklung der deutschen Sprache und seinen Einfluss auf die Standardisierung. Seine Rolle wird in mehreren Kapiteln im Kontext der innerdeutschen Sprachentwicklung und der Homogenisierungsprozesse betrachtet.
Welche Bedeutung haben die Städte in diesem Kontext?
Die Städte werden als zentrale Orte sprachlicher Entwicklung und Ausgleichsprozesse hervorgehoben. Bereits im Spätmittelalter entstand dort eine volgarsprachliche Schriftlichkeit, die regionale und später überregionale Schreib- und Schriftsprachen hervorbrachte.
Welche sprachlichen Ebenen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert sprachliche Veränderungen auf graphematischer, morphologischer und syntaktischer Ebene. Dies umfasst also die Schrift, die Wortbildung und den Satzbau.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Interaktionen zwischen schriftlicher und mündlicher Kommunikation in der Herausbildung einer einheitlicheren Schriftsprache.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit der Entwicklung der deutschen Sprache befassen. Der Inhalt ist auf eine strukturierte und professionelle Analyse der Themen ausgerichtet.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können im vollständigen Text gefunden werden (hier nicht vollständig enthalten).
- Quote paper
- Florian Fromm (Author), 2009, „Druckersprachen“ auf dem Weg in die Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148057