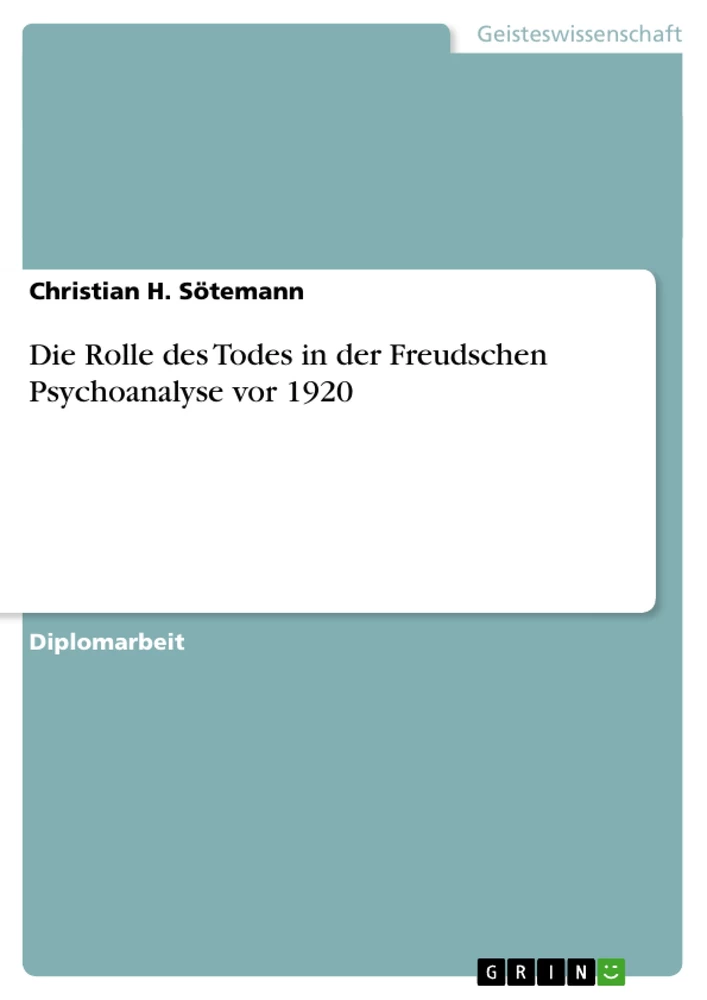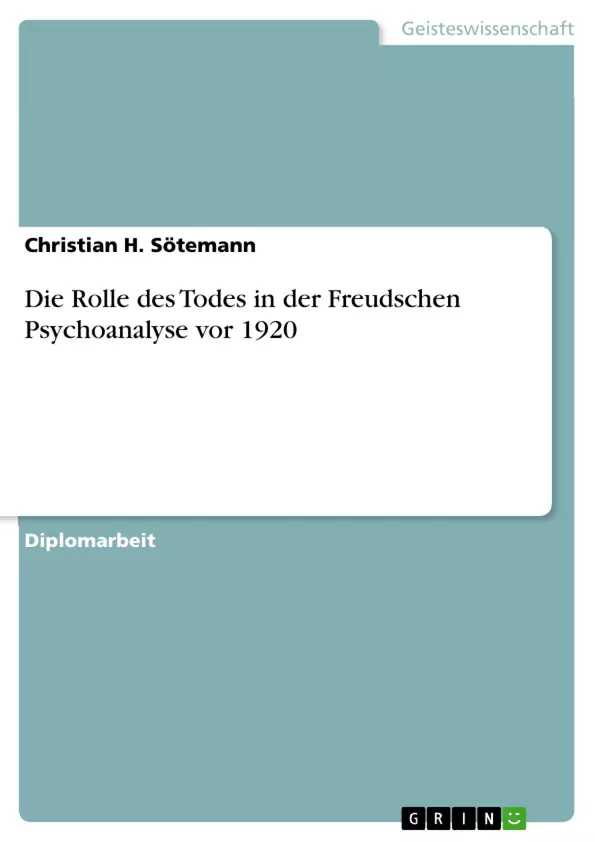Die Arbeit behandelt die Rolle des Todes in der Freudschen Psychoanalyse vor 1920, dem Jahr, das eine metapsychologische Zensur in der Arbeit Freuds durch die Einführung des Todestriebes bedeutete. Nach einer kurzen Skizzierung der trotz ihrer Unableugbarkeit eher gering einzuschätzenden Präsenz der Todesthematik gerade auch in einigen anderen psychologischen Grundausrichtungen werden Todesverleugnung, der Verlustaspekt des Todes, die Rolle des Todes im Traum, Todesangst und die generellen Zusammenhänge zwischen dem Unbewußten und dem Tod aus freudianisch-psychoanalytischer Sicht untersucht. Anschließend wird dieses mit z.B. existentiellen Aspekten kontextualisiert und die verschiedenen Manifestationen des Todes in der Psychoanalyse Freuds vor Einführung des Todestriebes einer kritischen Würdigung unterzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle des Todes in einigen nicht-psychoanalytischen Ausrichtungen der Psychologie
- Anmerkungen zur Rolle des Todes im Behaviorismus
- Anmerkungen zur Rolle des Todes in der humanistischen Psychologie
- Verleugnung und Vernichtung
- Von der Verleugnung des Todes im Alltäglichen
- Die Erschütterung des Verhältnisses zum Tode durch den Krieg
- Der „Urmensch“ - der damalige wie der in uns - und seine Einstellung zu Tod und Töten
- Der Verlustaspekt des Todes
- Vergänglichkeit und Verfall
- Der Objektverlust - Trauer und Melancholie
- Der Subjektverlust (Selbstmord)
- Die Komplexität des Umgangs mit Verlust
- Tod, Wunsch und Traum
- Heranführung an die Traumdeutung Freuds
- Einige Grundzüge der Traumdeutung
- Die verschiedenen Arten der Träume vom Tod geliebter Personen
- Die Genese des Wunsches
- Der Todeswunsch in den geschwisterlichen und den Eltern-Kind-Beziehungen
- Affekte und Vorstellungen in Todeswunschträumen
- Zur psychischen Realität des Todeswunsches
- Weitere Äußerungsformen von Todeswünschen
- Der Wunsch vom Tod zur Liebe, vom Zwang zur Wahl
- Angst und Tod
- Die Theoriebildung Freuds zur Angst
- Die Todesangst
- Der Tod und das Unheimliche
- Die Zusammenhänge zwischen dem Unbewußten und dem Tod
- Die Existenz des Unbewußten
- Die Funktionsweisen des Unbewußten
- Die Rolle des Todes im Unbewußten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist eine werkimmanente Darstellung Freudscher Ausführungen zum Thema Tod vor 1920. Es soll gezeigt werden, dass der Tod, obwohl nicht absolut fundamental, eine vielfach präsente und wichtige Komponente in Freuds Psychoanalyse darstellt, die über den oft hervorgehobenen Todestrieb hinausgeht. Die Arbeit beginnt mit der Oberflächenerscheinung der Einstellungen zum Tod und geht zu den tieferen Zusammenhängen im menschlichen Seelenleben.
- Die Verleugnung des Todes im Alltag und ihre Modifikation durch den Krieg.
- Der Verlustaspekt des Todes: Objektverlust (Trauer und Melancholie), Subjektverlust (Selbstmord).
- Die Verbindung zwischen Tod, Wunsch und Traum im Kontext der Freudschen Traumdeutung.
- Die Verflechtung von Angst und Tod, inklusive der Erörterung des Unheimlichen.
- Die Rolle des Todes im Unbewußten und seine metapsychologische Bedeutung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt fest, dass der Tod in der Psychologie oft vernachlässigt wird, im Gegensatz zur Psychoanalyse, die ihn als unabdingbaren Bestandteil des menschlichen Lebens betrachtet. Die Arbeit untersucht Freuds Auseinandersetzung mit dem Tod vor der Einführung des Todestriebes im Jahre 1920, um Aspekte aufzuzeigen, die oft durch den Todestrieb überlagert werden. Sie verfolgt einen psychoanalytischen Ansatz, beginnend mit dem Bewusstsein und fortschreitend in die Tiefen des Seelenlebens.
Die Rolle des Todes in einigen nicht-psychoanalytischen Ausrichtungen der Psychologie: Dieses Kapitel vergleicht die geringe Berücksichtigung des Todes in anderen psychologischen Richtungen wie dem Behaviorismus und der humanistischen Psychologie mit der zentralen Rolle des Todes in der Psychoanalyse. Es dient als Kontrapunkt zur folgenden detaillierten Auseinandersetzung mit Freuds Werk.
Verleugnung und Vernichtung: Dieses Kapitel untersucht die Verleugnung des Todes im Alltag und wie der Krieg diese Verleugnung erschüttert. Es betrachtet die "primitive" Einstellung zum Tod und deren Modifikation durch die Kriegserfahrungen. Es wird der "Urmensch" und seine Beziehung zu Tod und Töten analysiert, um die Wurzeln der menschlichen Auseinandersetzung mit dem Tod zu verstehen.
Der Verlustaspekt des Todes: Dieses Kapitel vertieft den Aspekt des Verlustes, indem es Objektverlust (Trauer und Melancholie) und Subjektverlust (Selbstmord) unterscheidet und analysiert. Es konzentriert sich auf die Differenzierung zwischen der klinischen Melancholie und der im Alltagsleben vorkommenden Trauer, um die verschiedenen Facetten des Umgangs mit Verlust zu beleuchten.
Tod, Wunsch und Traum: Dieser umfangreiche Teil behandelt die komplexen Verbindungen zwischen Tod und Wunsch, hauptsächlich anhand der Freudschen Traumtheorie und der darin postulierten unbewussten Todeswünsche. Es werden Aspekte der Freudschen Entwicklungstheorie, insbesondere die ödipale und geschwisterliche Situation, einbezogen, um die Genese dieser Wünsche zu verstehen.
Angst und Tod: Dieses Kapitel untersucht die Verflechtungen von Angst und Tod im Kontext der Entwicklung der Freudschen Angsttheorie. Es wird das Unheimliche als eine besondere Form der Angst genauer erörtert und dessen Beziehung zum Tod analysiert.
Die Zusammenhänge zwischen dem Unbewußten und dem Tod: Dieses Kapitel befasst sich mit der Existenz und den Funktionsweisen des Unbewußten und seiner Rolle in der Repräsentation des Todes. Es stellt die Verbindung zwischen unbewussten Regungen und dem Tod her und ist das metapsychologischste Kapitel der Arbeit.
Schlüsselwörter
Tod, Psychoanalyse, Freud, Todestrieb, Unbewußtes, Traumdeutung, Verlust, Trauer, Melancholie, Selbstmord, Angst, Unheimliches, Verleugnung, Krieg, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Freud und der Tod - Eine Analyse der psychoanalytischen Auseinandersetzung mit dem Tod vor 1920
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Freuds Auseinandersetzung mit dem Thema Tod in seinen Schriften vor der Einführung des Todestriebes (1920). Sie untersucht die vielfältigen Aspekte des Todes in der Psychoanalyse, die über den oft betonten Todestrieb hinausgehen, und beleuchtet den Tod als wichtige, wenn auch nicht absolut fundamentale Komponente im menschlichen Seelenleben.
Welche psychologischen Richtungen werden im Vergleich zur Psychoanalyse betrachtet?
Die Arbeit vergleicht Freuds psychoanalytische Sichtweise auf den Tod mit der Rolle des Todes im Behaviorismus und in der humanistischen Psychologie. Es wird deutlich, dass der Tod in diesen nicht-psychoanalytischen Ansätzen deutlich weniger Beachtung findet als in der Psychoanalyse.
Wie wird die Verleugnung des Todes behandelt?
Die Arbeit untersucht die Verleugnung des Todes im Alltag und wie diese Verleugnung durch den Ersten Weltkrieg erschüttert wurde. Es wird die "primitive" Einstellung zum Tod und deren Veränderung durch Kriegserfahrungen analysiert. Die Betrachtung des "Urmenschen" und seiner Beziehung zu Tod und Töten soll die Wurzeln der menschlichen Auseinandersetzung mit dem Tod verstehen helfen.
Welche Aspekte des Verlustes werden diskutiert?
Der Verlustaspekt wird differenziert betrachtet: Objektverlust (Trauer und Melancholie) und Subjektverlust (Selbstmord) werden unterschieden und analysiert. Die Arbeit betont den Unterschied zwischen klinischer Melancholie und der im Alltag vorkommenden Trauer, um die verschiedenen Facetten des Umgangs mit Verlust zu beleuchten.
Welche Rolle spielen Tod, Wunsch und Traum in der Arbeit?
Ein großer Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den komplexen Verbindungen zwischen Tod und Wunsch, hauptsächlich anhand Freuds Traumtheorie und der darin postulierten unbewussten Todeswünsche. Die ödipale und geschwisterliche Situation aus Freuds Entwicklungstheorie werden einbezogen, um die Genese dieser Wünsche zu verstehen.
Wie werden Angst und Tod in Beziehung gesetzt?
Die Arbeit untersucht die Verflechtung von Angst und Tod im Kontext der Entwicklung der Freudschen Angsttheorie. Das "Unheimliche" als besondere Form der Angst wird genauer erörtert und dessen Beziehung zum Tod analysiert.
Welche Bedeutung hat das Unbewußte in Bezug auf den Tod?
Die Arbeit befasst sich mit der Existenz und den Funktionsweisen des Unbewußten und dessen Rolle bei der Repräsentation des Todes. Die Verbindung zwischen unbewussten Regungen und dem Tod wird hergestellt. Dieses Kapitel ist metapsychologisch ausgerichtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tod, Psychoanalyse, Freud, Todestrieb, Unbewußtes, Traumdeutung, Verlust, Trauer, Melancholie, Selbstmord, Angst, Unheimliches, Verleugnung, Krieg, Entwicklungspsychologie.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel: Einleitung, Die Rolle des Todes in einigen nicht-psychoanalytischen Ausrichtungen der Psychologie, Verleugnung und Vernichtung, Der Verlustaspekt des Todes, Tod, Wunsch und Traum, Angst und Tod, Die Zusammenhänge zwischen dem Unbewußten und dem Tod.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen werkimmanenten Ansatz, der sich auf Freuds Schriften vor 1920 konzentriert. Sie verfolgt einen psychoanalytischen Ansatz, der vom Bewusstsein zu den Tiefen des Seelenlebens fortschreitet.
- Citar trabajo
- Dr. Christian H. Sötemann (Autor), 2001, Die Rolle des Todes in der Freudschen Psychoanalyse vor 1920, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148072