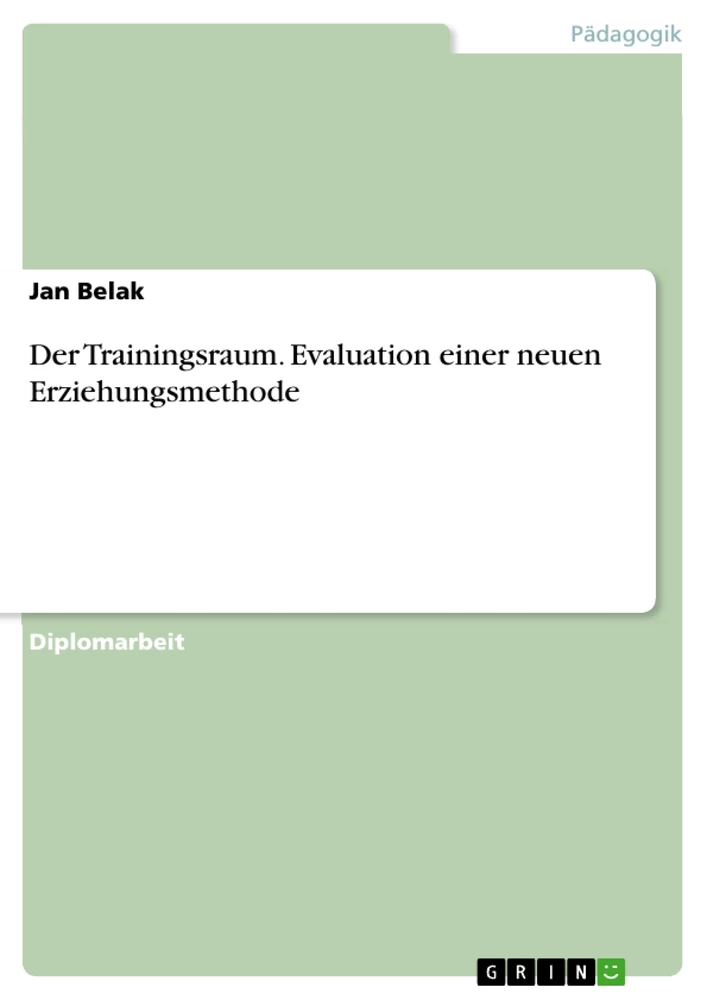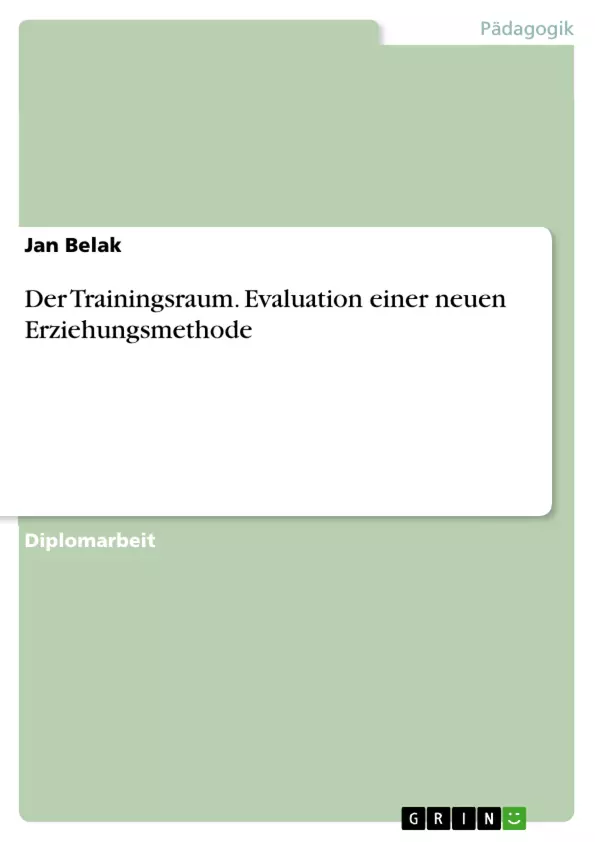Der Trainingsraum (TR), in andern Ländern auch bekannt als „Responcible Thinking Classroom“, „Arizona Project“, „die Kantine“ oder Ähnliches, bezeichnet eine neue Erziehungsmethode, die immer mehr Anhänger unter den Schulen auch in Deutschland findet. Postuliert wird die Hilfe zur Selbsthilfe für den Schüler. Dieser ständige Störenfried muss lernen, wie er in sich selbst hineinsehen und erkennen kann, wie und wo er selbst sein möchte, wie er von anderen wahrgenommen werden möchte. Dies und ein festgesetztes Reglement sollen helfen wieder Ruhe in den Klassenraum zu bringen. Tatsächlich soll mit dieser Methode der Lehrer wieder 99% seiner Unterrichtszeit unterrichten können. Das klingt wie ein wahres Wunder. Ob dies gewährleistet werden kann und mit welchen pädagogischen Auswirkungen gerechnet werden muss oder ob es sich am Ende doch nur um eine neue Strafmaßnahme handelt, soll diese Arbeit klären.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorwort
- Teil I: Die Theorie
- 1. Über Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen
- 1.1 Ein Definitionsversuch
- 1.2 Disziplinprobleme - eine Selbstverschuldung des Schulsystems?
- 1.3 Handlungsmöglichkeiten des Lehrers gegen Störungen
- 2. Die Trainingsraum-Methode - Einleitung
- 2.1 Das Gedankengebäude oder „Fords Noema“
- 2.1.1 Das Grundproblem
- 2.1.2 Fords Disziplin-Begriff
- 2.1.3 Fords Regelverständnis
- 2.1.4 Regelverstöße und Konsequenzen
- 2.1.5 Resümee der Grundgedanken Fords
- 3. Die Wahrnehmungskontrolltheorie
- 3.1 Lebende Kontrollsysteme
- 3.2 Probleme mit der WKT
- 3.3 Resümee und Ergänzungen zur WKT
- 3.3.1 Fords Konzept des TR und die WKT
- 3.3.2 Konflikte und Störungen im Rahmen der WKT
- 4. Der Trainingsraum in der Praxis
- 4.1 Eine objektiv hermeneutische Analyse des Begriffs „Trainingsraum“
- 4.2 Die Vorbereitung innerhalb des Kollegiums
- 4.3 Die Vorbereitung innerhalb der Klasse
- 4.4 Die Durchführung
- 4.4.1 Die Fragen
- 4.4.2 Der Laufzettel
- 4.4.3 Chronische Störer
- 5. Die Widersprüche im System
- 5.1 Über „quality time“
- 5.1.1 Der Widerspruch zwischen Quality Time und Trainingsraum
- 5.2 Anklang einer negativen Pädagogik
- 6. Das TR-Programm in der öffentlichen Diskussion
- 6.1 Internet-Foren-Diskussionen
- 6.2 Die juristische Lage
- 6.3 Bröcher vs. Bründel/Simon
- 6.4 Fazit der öffentlichen Diskussionen
- 7. Fazit und Resümee des theoretischen Teils
- Teil II: Empirische Untersuchung
- 8. Der TR in der Praxis an einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
- 9. Das TR-Team über den Trainingsraum
- 9.1 Analyse des TR-Instrumentariums
- 9.1.1 Der Laufzettel
- 9.1.2 Der Rückkehrplan
- 9.1.3 Der neue Rückkehrplan
- 9.1.4 Der Rückkehrzettel
- 9.2 Resümee zum TR-Instrumentarium
- 9.3 Fazit zum TR-Instrumentarium
- 10. Die Lehrerbefragung
- 11. Fazit der empirischen Erhebung
- Teil III: Allgemeines Fazit
- Nachwort
- Literatur
- WWW
- Anhang
- Definition von Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen
- Die Grundgedanken der Trainingsraum-Methode von Edward E. Ford
- Die Wahrnehmungskontrolltheorie als theoretische Grundlage des Trainingsraums
- Die Praxis des Trainingsraums an einer konkreten Schule
- Die öffentliche Diskussion über die Trainingsraum-Methode
- Kapitel 1: Dieses Kapitel definiert Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen. Es werden verschiedene Ursachen für Störungen im Unterricht untersucht, wie z.B. zu große Klassen, langweiliger Unterricht, zu hohe Anforderungen an die Schüler und eine negative Anthropologie.
- Kapitel 2: Das Konzept des Trainingsraums wird eingeführt. Ford geht davon aus, dass Kinder ohne die nötigen sozialen Fähigkeiten aufwachsen. Sie würden Regeln nicht beachten und haben nicht gelernt sich selbst zu disziplinieren. Seine Definition von Disziplin beinhaltet die Fähigkeit, Regeln und die Rechte anderer zu wahren.
- Kapitel 3: Die Wahrnehmungskontrolltheorie (WKT) von W.T. Powers, welche der Trainingsraum-Methode zugrunde liegt, wird erläutert. Die WKT geht davon aus, dass Lebewesen das kontrollieren, was sie wahrnehmen und nicht ihre Handlungen.
- Kapitel 4: Der Trainingsraum in der Praxis wird beschrieben. Ford beschreibt das Vorgehen beim Einsatz des Trainingsraums. Der Schüler wird in den Trainingsraum geschickt, wenn er gegen die Regeln verstößt. Dort wird er dann durch Fragen dazu angehalten, sein Verhalten zu reflektieren.
- Kapitel 5: Die Widersprüche innerhalb des Trainingsraum-Programms werden aufgezeigt. So wird beispielsweise der Begriff „quality time“ verwendet, obwohl das Programm darauf abzielt, die Kinder für eine gewisse Zeit aus dem Unterricht auszuschließen.
- Kapitel 6: Die öffentliche Diskussion über die Trainingsraum-Methode wird beleuchtet. Die Kritikpunkte, die in der Öffentlichkeit geäußert werden, stimmen weitgehend mit den in der Arbeit dargestellten Argumenten überein.
- Kapitel 8: Es wird die konkrete Schule vorgestellt, an der die empirische Untersuchung durchgeführt wurde.
- Kapitel 9: Das TR-Team berichtet von den Erfahrungen mit dem Trainingsraum an der Schule.
- Kapitel 10: Die Lehrerbefragung wird dargestellt und die Ergebnisse zusammengefasst.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Trainingsraum-Methode, eine neue Erziehungsmethode aus den USA, die auch in Deutschland zunehmend Einzug hält. Der Fokus liegt darauf, zu analysieren, ob es sich bei der Methode tatsächlich um Hilfe zur Selbsthilfe handelt oder ob sie eher einer Disziplinarmaßnahme gleicht.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Disziplinprobleme, Unterrichtsstörungen, Trainingsraum, Wahrnehmungskontrolltheorie, Hilfe zur Selbsthilfe, Disziplinarmaßnahme, Kommunikation, Erziehung, Mündigkeit, und der „Schnellfeuer-Kultur“.
- Arbeit zitieren
- Jan Belak (Autor:in), 2008, Der Trainingsraum. Evaluation einer neuen Erziehungsmethode, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148143