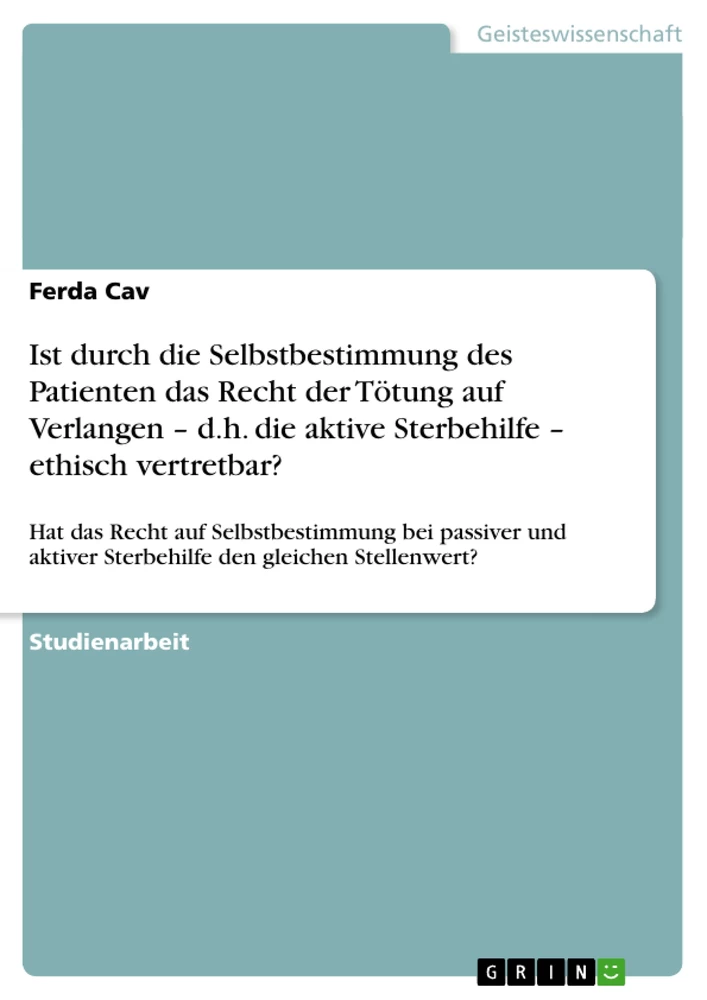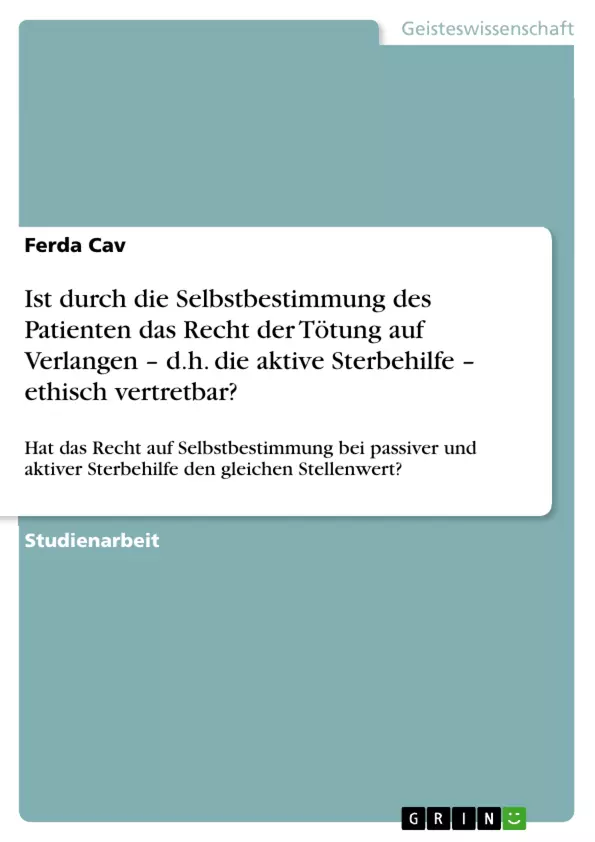Das Sterben wird in der Gesellschaft vielfach verdrängt und ist mit großen Ängsten belastet, mit denen sich die Mehrheit der Menschen quält. So z.B. die Angst unerträgliche Schmerzen erleiden zu müssen oder beim Sterben allein gelassen zu werden. Hinzu kommen die Ängste den Angehörigen zu Last zu fallen oder Fremden (z.B. dem medizinischem Personal) ausgeliefert zu sein. Um diesen Ängsten vorzubeugen, fällt es leichter den Willen zu äußern, dass dem Leben ein vorzeitiges Ende bereitet werden soll. Diesem Wunsch kann je nach Diagnose und verbleibende Behandlungsmethoden mit Sterbehilfe entsprochen werden.
Dabei unterscheidet man vier Formen der Sterbehilfe: 1. Beihilfe zur Selbsttötung, 2. Indirekte Sterbehilfe, 3. Passive Sterbehilfe und 4. Aktive Sterbehilfe. Gemeinsame Vorraussetzung jeder Form der Sterbehilfe ist, dass sie aufgrund des Patientenwunsches erfolgen muss und somit nicht gegen den Willen erfolgen darf. Die Beihilfe zur Selbsttötung geschieht, indem eine Person (oft der Arzt) ein Mittel zur Selbsttötung dem Patienten bereitstellt, damit dieser selbst dieses Mittel einnimmt. Indirekte Sterbehilfe ist der Einsatz von Medikamenten zur Linderung von Beschwerden, die als Nebenwirkung die Lebensdauer verkürzen. Dies erfolgt in Krankenhäusern regelmäßig mit Morphium im Endstadium der Krebserkrankungen. Unter passiver Sterbehilfe versteht man hingegen die aktive Beendigung von lebensverlängernden oder –erhaltenden Maßnahmen bei expliziter oder mutmaßlicher Einwilligung des Patienten. Die gezielte und von einem Arzt aktiv herbeigeführte vorzeitige Beendigung des Lebens durch Verabreichung tödlicher Substanzen wird als aktive Sterbehilfe bezeichnet.
Viele Sterbende sind in ärztlicher Behandlung und sterben in den meisten Fällen im Krankenhaus. Dabei hat jeder Mensch ein Recht auf einen würdevollen Tod. Jeder sollte bestimmen können, wann er seinem Leben ein würdevolles Ende setzen möchte. Es hängt aber oftmals vom Arzt ab, ob ein Sterbeprozess würdevoll oder qualvoll abläuft. Hierbei besteht ein Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und der Fürsorgepflicht des Arztes.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage wie weit das Recht auf Selbstbestimmung, das auch in der letzten Lebensphase gilt, reicht und ob das Recht auf Selbstbestimmung bei passiver und aktiver Sterbehilfe den gleichen Stellenwert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Problemstellung
- Hauptteil
- Erstes Fallbeispiel
- Argumente gegen die aktive Sterbehilfe
- Zweites Fallbeispiel
- Argumente für die aktive Sterbehilfe
- Schluss
- Erörterung der anfangs der Arbeit erstellten Fragestellung auf der Grundlage der im Hauptteil erzielten Befunde
- Zusatzfrage zum Erwerb des EPG 2 Scheins:
- Ist das aktive Abschalten eines Beatmungsgerätes aktive Sterbehilfe?
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der ethischen Vertretbarkeit der aktiven Sterbehilfe im Kontext des Selbstbestimmungsrechts des Patienten. Sie untersucht, ob das Recht auf Selbstbestimmung bei passiver und aktiver Sterbehilfe den gleichen Stellenwert hat und welche moralischen und rechtlichen Implikationen sich daraus ergeben.
- Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten in der letzten Lebensphase
- Die ethische Abwägung zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und der Fürsorgepflicht des Arztes
- Die Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Sterbehilfe
- Die rechtliche und gesellschaftliche Debatte um die aktive Sterbehilfe
- Die Rolle der Palliativmedizin im Kontext der Sterbebegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Sterbehilfe ein und stellt die Problemstellung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Verdrängung des Sterbens und die damit verbundenen Ängste. Darüber hinaus werden die verschiedenen Formen der Sterbehilfe definiert und die Bedeutung des Patientenwillens in diesem Kontext hervorgehoben.
Erstes Fallbeispiel
Das erste Fallbeispiel schildert die Geschichte von Frau Müller, die nach einer schweren Diagnose den Wunsch äußert, durch aktive Sterbehilfe einen schnellen Tod herbeizuführen. Die behandelnden Ärzte lehnen diese Maßnahme ab, was Frau Müller dazu veranlasst, in die Schweiz zu ‘Exit’ zu reisen, um dort den Wunsch nach Selbsttötung zu realisieren. Die ethische Vertretbarkeit des Verhaltens der Ärzte wird in Frage gestellt.
Argumente gegen die aktive Sterbehilfe
Dieser Abschnitt präsentiert Argumente gegen die aktive Sterbehilfe. Es wird betont, dass das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zwar ein zentrales Argument für die aktive Sterbehilfe ist, aber nicht uneingeschränkt gelten kann. Der moralische Unterschied zwischen Therapieverzicht und aktiver Sterbehilfe wird diskutiert.
Zweites Fallbeispiel
Der zweite Abschnitt enthält ein weiteres Fallbeispiel, das die Argumentation für die aktive Sterbehilfe vertieft. Es werden verschiedene Aspekte der ethischen Debatte beleuchtet und die Bedeutung der individuellen Entscheidung des Patienten hervorgehoben.
Argumente für die aktive Sterbehilfe
Dieser Abschnitt stellt Argumente für die aktive Sterbehilfe dar. Es wird die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten im Kontext der Sterbebegleitung betont. Die ethische und rechtliche Diskussion um die aktive Sterbehilfe wird weitergeführt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sterbehilfe, Selbstbestimmungsrecht, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Patientenwille, Fürsorgepflicht des Arztes, Palliativmedizin, ethische und rechtliche Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Aktive Sterbehilfe ist die gezielte Tötung durch Substanzen, während passive Sterbehilfe das Beenden oder Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen bedeutet.
Was versteht man unter "indirekter Sterbehilfe"?
Dabei werden Medikamente zur Schmerzlinderung eingesetzt, die als unvermeidbare Nebenwirkung die Lebensdauer verkürzen können (z.B. Morphium im Endstadium).
Wie wird das Selbstbestimmungsrecht des Patienten in der Arbeit bewertet?
Es wird untersucht, ob dieses Recht auch die Entscheidung über den eigenen Tod umfasst und wie es gegenüber der ärztlichen Fürsorgepflicht abzuwägen ist.
Ist das Abschalten eines Beatmungsgeräts aktive Sterbehilfe?
Diese spezifische Frage wird in der Arbeit erörtert, wobei rechtliche und ethische Kriterien zur Einordnung als passive oder aktive Maßnahme herangezogen werden.
Welche Rolle spielt die Palliativmedizin in dieser Debatte?
Die Arbeit beleuchtet die Palliativmedizin als Alternative, die durch Schmerzlinderung und Sterbebegleitung den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe mindern kann.
- Arbeit zitieren
- Ferda Cav (Autor:in), 2007, Ist durch die Selbstbestimmung des Patienten das Recht der Tötung auf Verlangen – d.h. die aktive Sterbehilfe – ethisch vertretbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148150