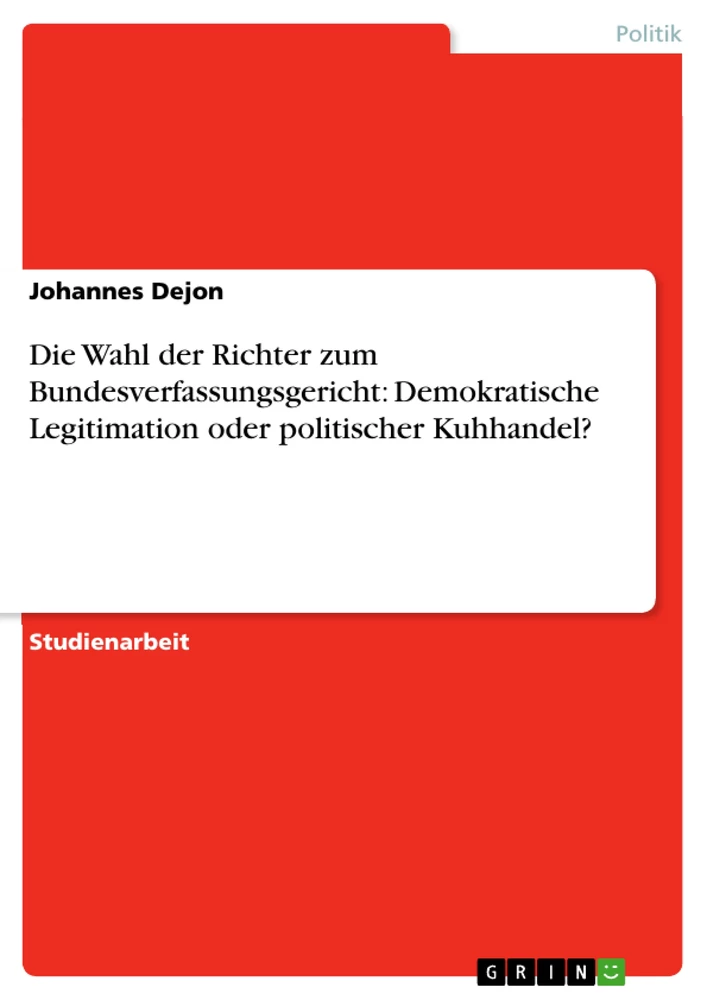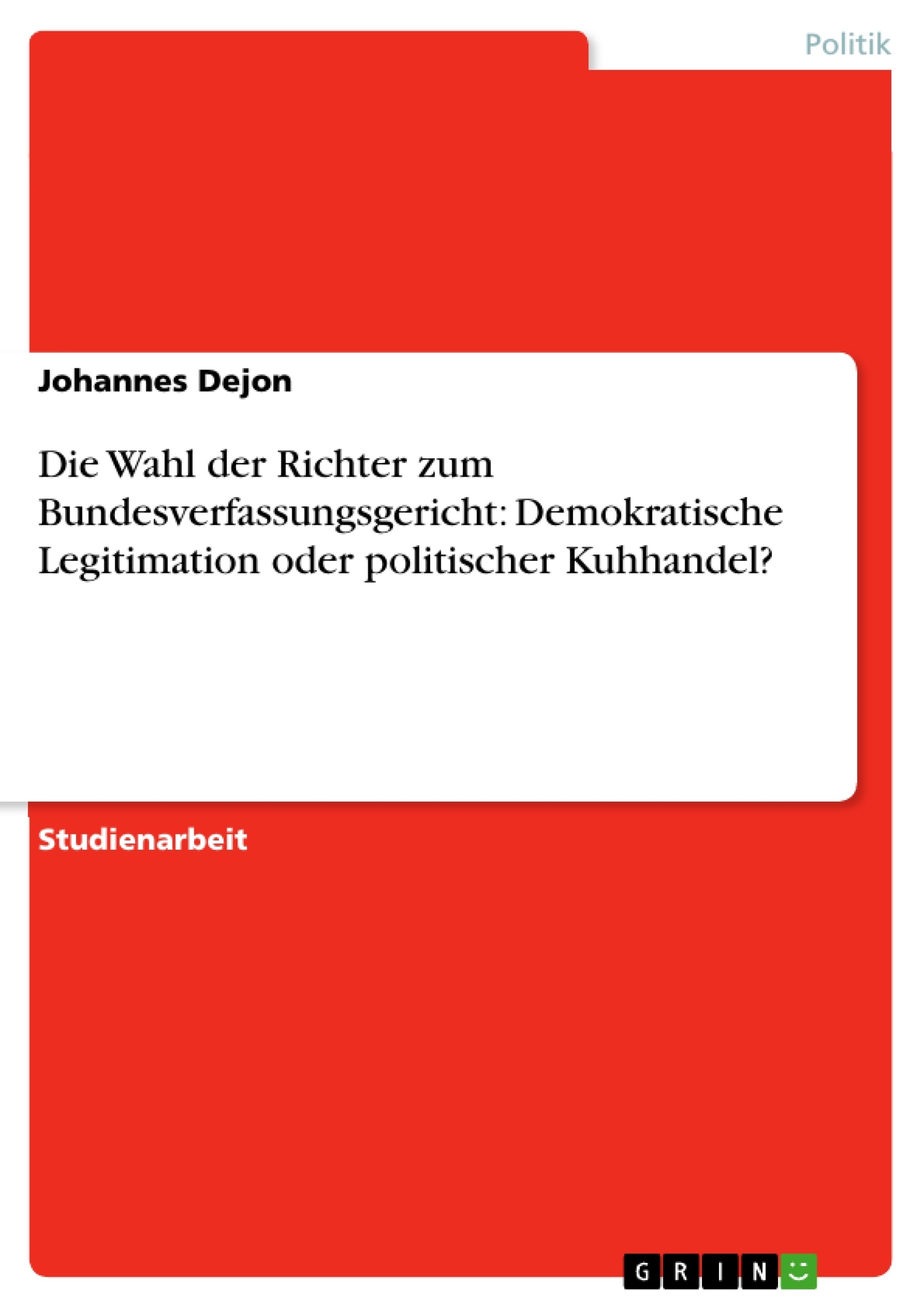Im Unterschied zur Rechtsprechung im Rahmen der klassischen Gewaltenteilung fällt dem
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nicht lediglich die Aufgabe zu, am vorgegebenen
Maßstab des gesetzten Rechtes die Wirklichkeit zu überprüfen.1 Vielmehr besitzt das
Bundesverfassungsgericht als selbständigem Verfassungsorgan eine Fülle an Kompetenzen,
die ihm einen „Anteil an der Staatsleitung“2 zukommen lassen.
Willi Geiger zählt in „Verfassungsgerichtsbarkeit im dritten Jahrzehnt“ drei Dimensionen auf
in denen sich ein Verfassungsgerichts legitimieren muss. Einmal durch die Erfüllung seiner
Funktion, den Schutz des demokratischen Rechtsstaates und der bundesstaatlichen Struktur,
zweitens durch die Qualität seiner Rechtsprechung und drittens nach der Legitimation als
Verfassungsorgan, also die Frage nach der demokratischen Legitimationskette.3 Daraus
erwachsen vier zentrale Forderungen an die Regelung der Richterbestellung, die sich nicht
leicht vereinbaren lassen. Dies sind nach Heinz Laufer zuerst demokratische Legitimierung der
Verfassungsrichter, dann der Ausschluss einseitiger Einflüsse bei der Richterwahl, weiter die
Forderung nach hoher richterlicher Qualität und schließlich föderative Repräsentation. Diese
Forderungen, die Laufer als „magisches Viereck der Richterbestellung“ bezeichnet, schaffen
erst die Möglichkeit für eine substantielle Funktionsfähigkeit des Verfassungsgerichts.4
In der folgende Hausarbeit soll die Frage geklärt werden, ob das Wahlverfahren der Richter
die Anforderungen, eine demokratische Legitimation des an der Staatsleitung beteiligten
Verfassungsorgans „Bundesverfassungsgericht“ zu leisten, in der Lage ist.
Dabei soll in einem ersten Schritt eine ausführliche Darstellung der Richterwahl gegeben
werden. Anschließend werden Kritikansätze dargestellt, um dann zu Ende die obige Frage zu
diskutieren.
1v gl. Rudzio, W., Das politische System, 2000, S. 329
2 Stern, K., Staatsrecht, 1980, S. 951
3vgl. Geiger, S. 73 in: Frowein, J., Bundesverfassungsgericht, 1973
4vgl. Laufer, H., Verfassungsgerichtsbarkeit, 1968, S. 207
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gesetzliche Grundlagen der Richterwahl
- 1. Die Normierung in Grundgesetz und Bundesverfassungsgerichtsgesetz
- 2. Die allgemeinen Voraussetzungen für die Wählbarkeit
- III. Das gesetzliche Wahlverfahren
- 1. Kandidatenauswahl
- a) Liste des Bundesministerium der Justiz
- b) Vorschlagrecht des Bundesverfassungsgericht
- 2. Die Wahl in Bundestag und Bundesrat
- a) Aufteilung der Richterstellen
- b) Die Wahl im Bundestag
- c) Das Wahlverfahren im Bundesrat
- 3. Die Ernennung durch den Bundespräsidenten
- 1. Kandidatenauswahl
- IV. Die Praxis der Verfassungsrichterwahl
- 1. Die Auswahl der Kandidaten
- 2. Das praktizierte Wahlverfahren
- V. Kritik am Wahlverfahren
- 1. Kritik an den gesetzlichen Regelungen der Richterwahl
- a) Kritik am Wahlausschuss des Bundestags
- b) Kritik an der Transparenz des Wahlverfahrens
- c) Bewertung der Kritik an der gesetzlichen Ausgestaltung der Verfassungsrichterwahl
- 2. Kritik an der Praxis der Wahl
- 1. Kritik an den gesetzlichen Regelungen der Richterwahl
- VI. Demokratische Legitimation des Bundesverfassungsgerichts
- 1. Keine demokratische Legitimation durch Responsivität
- 2. Richterwahl: Demokratische Legitimation oder politischer Kuhhandel?
- VII. Zwei Anmerkungen zur Vollständigkeit
- 1. Unterschiedliche Grade an politischer Legitimation durch zwei Wahlorgane?
- 2. Das Wahlverfahren und die richterliche Unabhängigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahlverfahren der Richter am Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und deren Auswirkung auf die demokratische Legitimation des Gerichts. Ziel ist es zu analysieren, ob das bestehende Verfahren den Anforderungen an eine demokratische Legitimation eines Organs mit so weitreichenden Kompetenzen gerecht wird.
- Gesetzliche Grundlagen der Richterwahl am BVerfG
- Das Wahlverfahren in der Praxis und dessen Kritikpunkte
- Die Frage nach demokratischer Legitimation versus politischem Kuhhandel
- Der Einfluss des Wahlverfahrens auf die richterliche Unabhängigkeit
- Differenzierung der Legitimation durch Bundestag und Bundesrat
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Legitimation des Bundesverfassungsgerichts ein und betont dessen besondere Rolle im politischen System. Sie skizziert die zentralen Herausforderungen bei der Richterwahl – die Vereinbarkeit von demokratischer Legitimation, Unabhängigkeit der Richter, hoher Qualität der Richter und föderativer Repräsentation – und kündigt die Vorgehensweise der Arbeit an: eine detaillierte Darstellung der Richterwahl, eine Analyse der Kritikpunkte und schließlich die Beantwortung der Frage nach der demokratischen Legitimation des Wahlverfahrens.
II. Gesetzliche Grundlagen der Richterwahl: Dieses Kapitel beschreibt die gesetzlichen Grundlagen der Richterwahl am BVerfG, wie sie im Grundgesetz (GG) und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) verankert sind. Es beleuchtet die formalen Voraussetzungen für die Wählbarkeit und die historische Entwicklung der gesetzlichen Regelungen, einschließlich wichtiger Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die Wahlprozesse. Die Analyse zeigt die Komplexität der gesetzlichen Vorgaben und legt den Grundstein für die spätere Kritik an diesen Regelungen.
III. Das gesetzliche Wahlverfahren: Hier wird das gesetzliche Wahlverfahren im Detail dargestellt, beginnend bei der Kandidatenauswahl über die Wahlprozesse im Bundestag und Bundesrat bis hin zur Ernennung durch den Bundespräsidenten. Es werden die Rollen des Bundesministeriums der Justiz und des BVerfG selbst bei der Kandidatenauswahl erläutert, und die Bedeutung der jeweiligen Mehrheiten wird diskutiert. Dieses Kapitel bildet das Herzstück der Arbeit, indem es die Mechanismen der Richterwahl transparent macht.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Richterwahl, demokratische Legitimation, politischer Kuhhandel, Grundgesetz, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Bundestag, Bundesrat, richterliche Unabhängigkeit, föderale Repräsentation, Gewaltenteilung, Rechtsprechung, Verfassungsgerichtsbarkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Wahl der Richter am Bundesverfassungsgericht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Wahlverfahren der Richter am Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und untersucht dessen Auswirkungen auf die demokratische Legitimation des Gerichts. Sie betrachtet die gesetzlichen Grundlagen, das Verfahren in der Praxis, Kritikpunkte daran und die Frage, ob das Verfahren einen politischen Kuhhandel darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzlichen Grundlagen der Richterwahl im Grundgesetz und Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das detaillierte Wahlverfahren (Kandidatenauswahl, Wahl im Bundestag und Bundesrat, Ernennung durch den Bundespräsidenten), praktische Aspekte der Wahl, Kritikpunkte am Verfahren (Transparenz, Wahlausschuss), die demokratische Legitimation des BVerfG, den Einfluss des Wahlverfahrens auf die richterliche Unabhängigkeit und die unterschiedlichen Grade an Legitimation durch Bundestag und Bundesrat.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Gesetzliche Grundlagen der Richterwahl, Das gesetzliche Wahlverfahren, Die Praxis der Verfassungsrichterwahl, Kritik am Wahlverfahren, Demokratische Legitimation des Bundesverfassungsgerichts und Zwei Anmerkungen zur Vollständigkeit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert, welche die zentralen Punkte hervorhebt.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die im Grundgesetz (GG) und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) verankerten gesetzlichen Grundlagen der Richterwahl. Sie analysiert die formalen Voraussetzungen der Wählbarkeit und die historische Entwicklung der gesetzlichen Regelungen.
Wie wird das Wahlverfahren im Detail beschrieben?
Das Wahlverfahren wird detailliert beschrieben, von der Kandidatenauswahl (inkl. Rolle des Bundesministeriums der Justiz und des BVerfG) über die Wahlprozesse im Bundestag und Bundesrat bis hin zur Ernennung durch den Bundespräsidenten. Die Bedeutung der jeweiligen Mehrheiten wird diskutiert.
Welche Kritikpunkte am Wahlverfahren werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die Kritik am Wahlverfahren, sowohl an den gesetzlichen Regelungen (Transparenz, Wahlausschuss) als auch an der Praxis der Wahl. Die Kritikpunkte werden bewertet und eingeordnet.
Wie wird die Frage der demokratischen Legitimation behandelt?
Die Arbeit befasst sich intensiv mit der Frage der demokratischen Legitimation des BVerfG. Sie untersucht, ob das bestehende Wahlverfahren den Anforderungen an eine demokratische Legitimation eines Organs mit so weitreichenden Kompetenzen gerecht wird, und beleuchtet die mögliche Gegenüberstellung von demokratischer Legitimation und politischem Kuhhandel.
Welchen Einfluss hat das Wahlverfahren auf die richterliche Unabhängigkeit?
Die Arbeit diskutiert den Einfluss des Wahlverfahrens auf die richterliche Unabhängigkeit. Dieser Aspekt wird im Kontext der gesamten Analyse der Legitimation und des Verfahrens betrachtet.
Wie unterscheidet sich die Legitimation durch Bundestag und Bundesrat?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Grade an politischer Legitimation, die durch die Wahlorgane Bundestag und Bundesrat entstehen. Sie untersucht, ob und wie diese Unterschiede die Legitimation des BVerfG beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bundesverfassungsgericht, Richterwahl, demokratische Legitimation, politischer Kuhhandel, Grundgesetz, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Bundestag, Bundesrat, richterliche Unabhängigkeit, föderale Repräsentation, Gewaltenteilung, Rechtsprechung, Verfassungsgerichtsbarkeit.
- Quote paper
- Johannes Dejon (Author), 2003, Die Wahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht: Demokratische Legitimation oder politischer Kuhhandel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14825