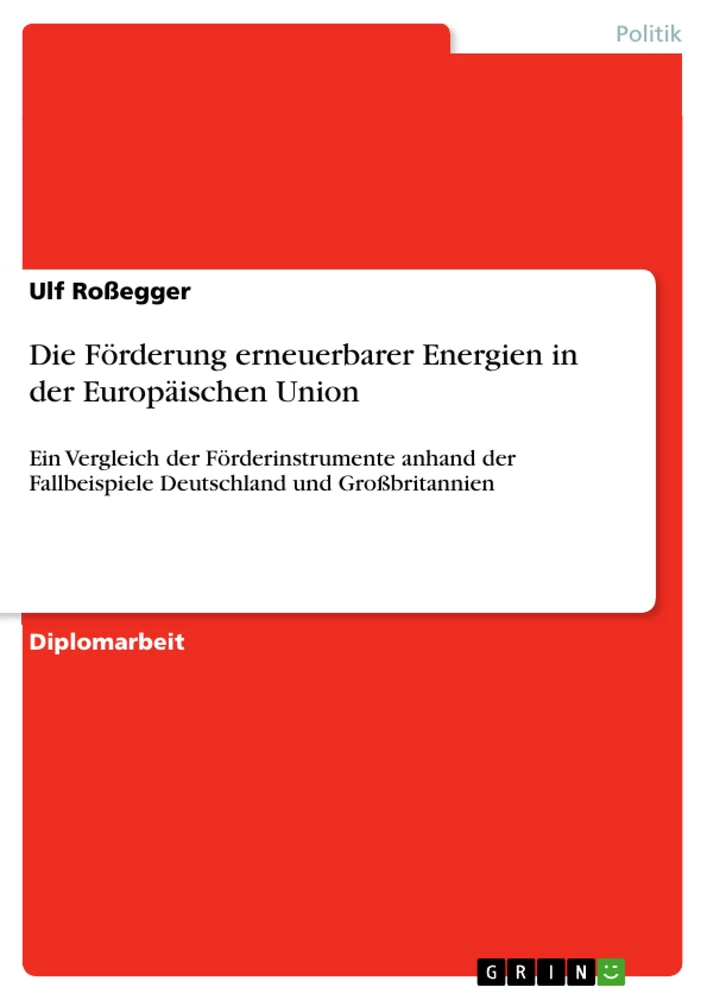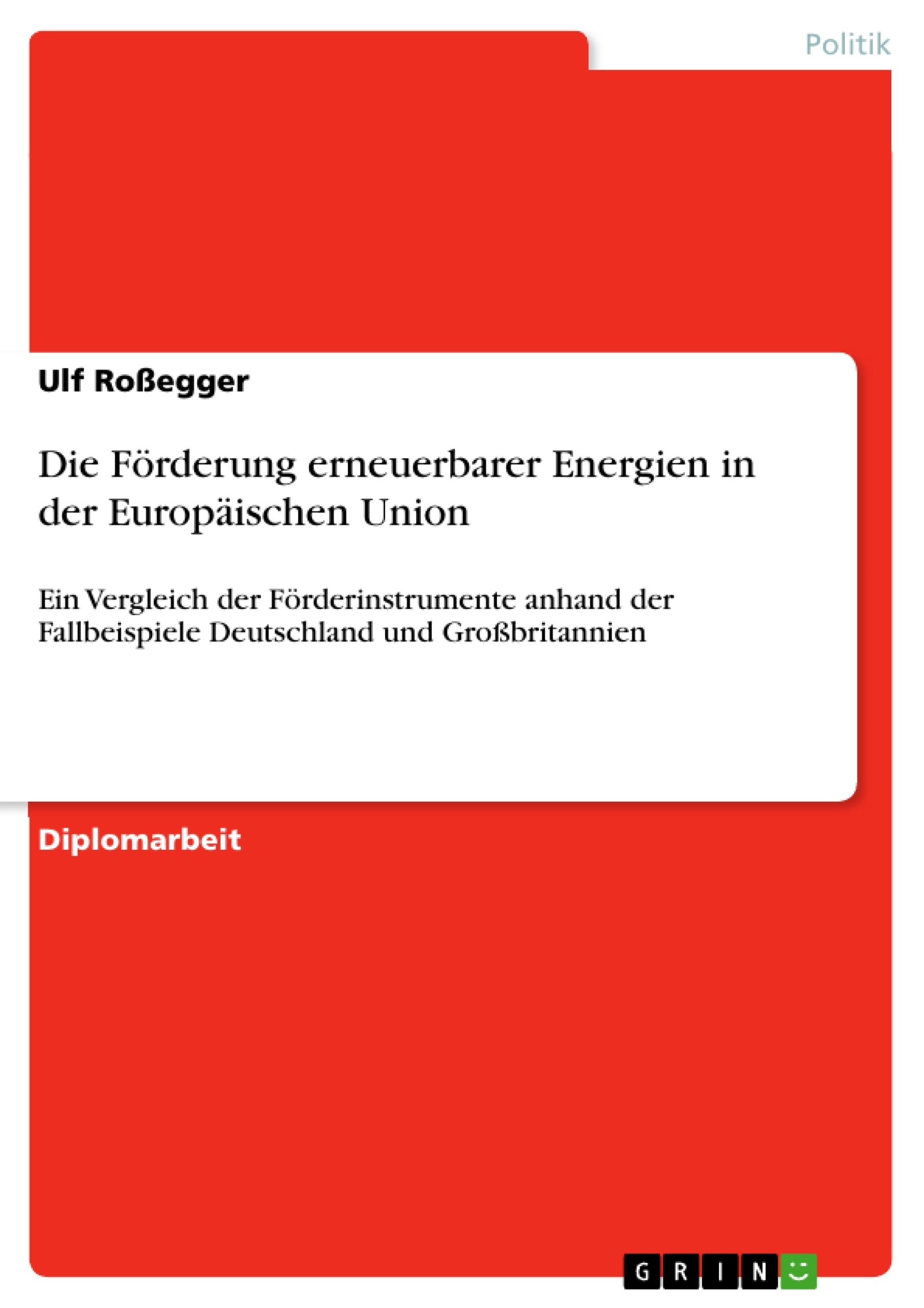„Wenn wir unsere Partner auch weiter dazu bewegen wollen, ehrgeizige Ziele für die erneuerbaren Energien festzulegen, müssen wir beweisen, dass wir unsere eigenen Ziele erreichen werden, und sollten vor unserer eigenen Tür kehren.“
(Loyola de Palacio, ehemalige Vizepräsidentin der EU-Kommission von 1999 bis 2004, Zuständigkeitsbereich Verkehr und Energie, auf der Ratstagung „Energie“ am 14.05.2003, EU 2003a: 2)
Mit der Richtlinie vom 27. September 2001 (EU 2001a, 2001/77/EG) hat die Europäische Union erstmals einen Rahmen zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EE) verabschiedet. Die EE-Stromrichtlinie ist somit die maßgebliche legislative Grundlage zur Förderung erneuerbarer Energiequellen auf der europäischen Ebene, mit entsprechenden Rückwirkungen auf die nationale Ebene.
In der Richtlinie werden die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Stromgewinnung auf Basis der erneuerbaren Energiequellen am gesamten Bruttostromverbrauch der EU15 von 13,9 Prozent im Jahr 1997 auf 22,1 Prozent bis 2010 zu steigern. Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Umsetzung der EE-Stromrichtlinie war die Zustimmung der Europäischen Union zum Kyoto-Protokoll im Jahr 1997. In diesem Rahmen ging sie die
Verpflichtung ein, ihre jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2010 um 8 Prozent zu senken und bis zum Jahr 2010 bei den erneuerbaren Energien einen Anteil von 12 Prozent am
Primärenergieverbrauch zu erreichen.
Die Richtlinie beinhaltet unterschiedliche nationale Referenzwerte für die Regenerativstromerzeugung in allen EU-Mitgliedstaaten. Nach der EU-Erweiterung in den Jahren 2004 und 2007 wurden für die Beitrittstaaten ebenso nationale Richtziele festgeschrieben. Nach der Ergänzung der EE-Stromrichtlinie um die nationalen Richtziele der Beitrittsländer beträgt das Gesamtausbauziel der EU27 beim Regenerativstrom 21 Prozent bis zum Jahr 2020. Für die Zeit nach 2010 wird ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien
zur Stromerzeugung angestrebt. Dies wird am Beschluss des Rates der Europäischen Union im März 2007 deutlich. Darin wird ein verbindliches Ziel in Höhe von 20 Prozent als Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch der EU bis 2020 festgeschrieben (Rat der Europäischen Union 2007: 21).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Förderung regenerativer Stromerzeugung in der Europäischen Union
- 2.1 Entwicklung der Förderung erneuerbarer Energien in der EU
- 2.2 EU-Richtlinie zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
- 3. Modellüberblick verschiedener Förderinstrumente
- 3.1 Klassifizierung verschiedener Förderinstrumente
- 3.2 Einspeisevergütungsmodell
- 3.2.1 Funktionsweise der Einspeisevergütung
- 3.2.2 Ausgestaltungsmöglichkeiten der Einspeisevergütung
- 3.2.3 Zusammenfassung
- 3.3 Quotenmodell mit Zertifikatshandel
- 3.3.1 Funktionsweise eines Quotenmodells
- 3.3.2 Zertifizierung im Quotenmodell
- 3.3.3 Ausgestaltungsmöglichkeiten eines Quotenmodells mit Zertifikatshandel
- 3.3.4 Zusammenfassung
- 4. Kriterien für die Bewertung von Förderpolitiken und -instrumenten
- 4.1 Effizienz, Effektivität und Wirkungen im EU-Binnenmarkt
- 4.2 Nationale Richtziele
- 4.3 Förderregelungen und Berichtspflicht
- 4.4 Verwaltungsverfahren
- 4.5 Netzanschluss
- 4.6 Herkunftsgarantie für Strom
- 5. Förderinstrumentarien
- 5.1 Institutionelle Ausgestaltung der EE-Förderung zur Stromerzeugung in Deutschland
- 5.1.1 Das Stromeinspeisegesetz (StrEG)
- 5.1.2 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- 5.1.3 Novellierung des EEG
- 5.1.4 Funktionsweise des EEG
- 5.1.5 Vergütung nach dem EEG
- 5.2 Institutionelle Ausgestaltung der EE-Förderung zur Stromerzeugung in Großbritannien
- 5.2.1 Die Non-Fossil-Fuel-Obligation (NFFO; SRO; NI NFFO)
- 5.2.2 Funktionsweise des NFFO-Systems
- 5.2.3 Die Renewables Obligation (RO; ROS; NIRO)
- 5.2.4 Funktionsweise der Renewables Obligation (RO) mit Zertifikatshandel (ROCs)
- 5.2.5 Vergütung nach der Renewables Obligation
- 5.2.6 Einführung von Technologiebändern und Reformansätze
- 6. Evaluierung und Vergleich der Förderinstrumentarien
- 6.1 Zielsetzungen und Förderinstrumente im europäischen Überblick
- 6.2 Verwaltungstechnische und netzspezifische Hemmnisse in den Mitgliedstaaten
- 6.3 Kriterienüberprüfung
- 6.3.1 Effizienz
- 6.3.2 Effektivität
- 6.3.3 Wirkungen im EU-Binnenmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Förderung erneuerbarer Energien in der Europäischen Union. Sie vergleicht dabei die Förderinstrumente in Deutschland und Großbritannien anhand von Fallbeispielen. Ziel ist es, die Effizienz, Effektivität und Auswirkungen der jeweiligen Förderpolitik auf den EU-Binnenmarkt zu analysieren.
- Entwicklung der Förderung erneuerbarer Energien in der EU
- Vergleich verschiedener Förderinstrumente (Einspeisevergütung, Quotenmodell)
- Kriterien zur Bewertung von Förderpolitiken (Effizienz, Effektivität, Wirkungen im EU-Binnenmarkt)
- Analyse der Förderinstrumentarien in Deutschland (EEG) und Großbritannien (RO)
- Evaluierung und Vergleich der Förderinstrumentarien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Förderung erneuerbarer Energien in der EU und die EU-Richtlinie zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Kapitel 3 gibt einen Überblick über verschiedene Förderinstrumente, darunter das Einspeisevergütungsmodell und das Quotenmodell mit Zertifikatshandel. Kapitel 4 definiert Kriterien zur Bewertung von Förderpolitiken und -instrumenten, wie Effizienz, Effektivität und Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt. Kapitel 5 analysiert die Förderinstrumentarien in Deutschland und Großbritannien, wobei das EEG und die RO im Detail betrachtet werden. Kapitel 6 evaluiert und vergleicht die Förderinstrumentarien beider Länder.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, Förderung, Europäische Union, Deutschland, Großbritannien, Einspeisevergütung, Quotenmodell, Zertifikatshandel, EEG, RO, Effizienz, Effektivität, EU-Binnenmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die EU-Richtlinie 2001/77/EG?
Es ist die maßgebliche legislative Grundlage zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EE) auf europäischer Ebene.
Welche zwei Hauptmodelle der Förderung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Einspeisevergütungsmodell (wie in Deutschland) mit dem Quotenmodell inklusive Zertifikatshandel (wie in Großbritannien).
Was ist das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)?
Das deutsche EEG zielt auf eine feste Vergütung für eingespeisten Ökostrom ab, um Investitionssicherheit für regenerative Anlagen zu schaffen.
Wie funktioniert das britische Quotenmodell (Renewables Obligation)?
Energieversorger werden verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, was über handelbare Zertifikate nachgewiesen wird.
Anhand welcher Kriterien werden die Förderpolitiken bewertet?
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Effizienz, Effektivität und den Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt.
- Citar trabajo
- Ulf Roßegger (Autor), 2008, Die Förderung erneuerbarer Energien in der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148268