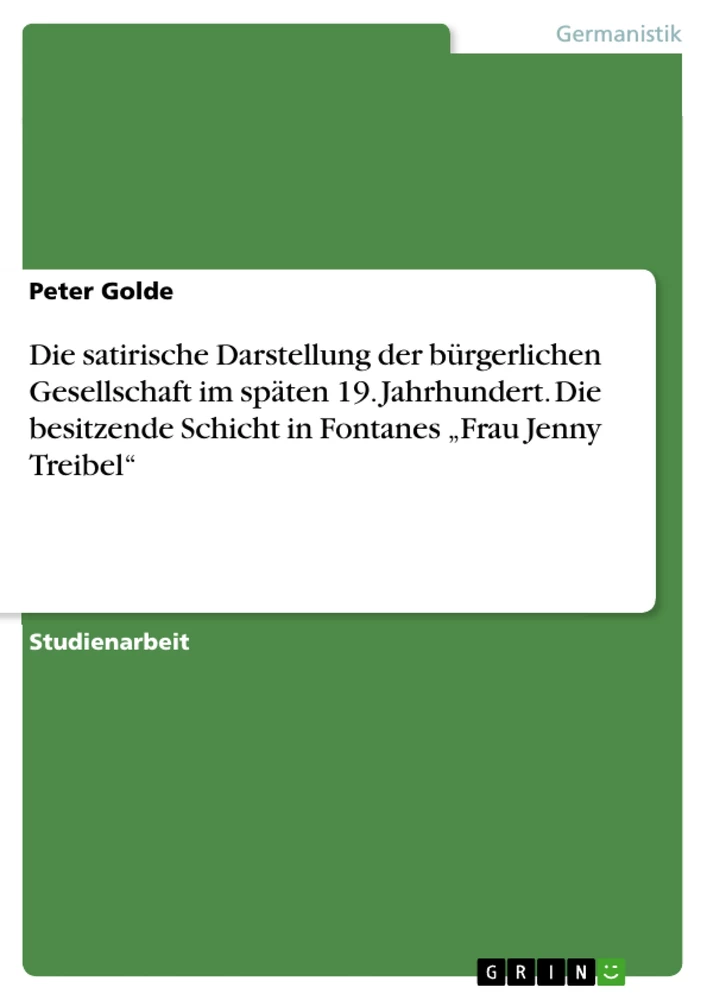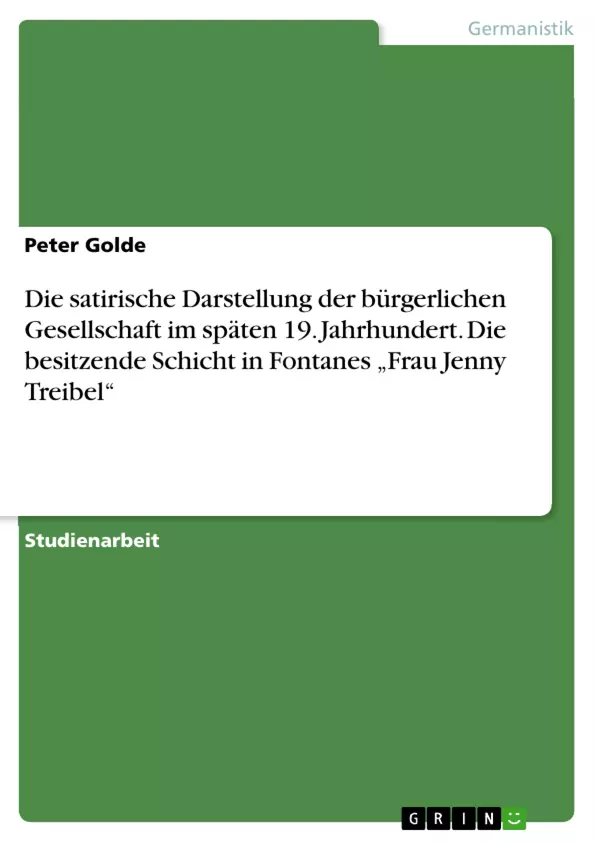„…Titel: ››Frau Kommerzienrätin oder Wo sich Herz zum Herzen findt ‹‹. Dies ist die Schlußzeile eines sentimentalen Lieblingsliedes, das die 50jährige Kommerzienrätin im engeren Zirkel beständig singt und sich dadurch Anspruch auf das ››Höhere‹‹ erwirbt, während ihr in Wahrheit nur das Kommerzienrätliche, will sagen viel Geld, das ››Höhere‹‹ bedeutet…“.
Gerade die Vereinbarkeit dieser Gegensätzlichkeit ist es, die Theodor Fontane seiner Hauptfigur zumutet und womit die zentrale Thematik seiner Milieustudie festgelegt ist. Knapp zusammengefasst sagt dieser Satz alles aus, um was es in Theodor Fontanes Gesellschaftsroman „Frau Jenny Treibel“ (so der spätere Titel) geht. Mit einem Minimum an Handlung auskommend und in einem, sich auf Gespräche beschränkendem Erzählstil wird hier u. a. dem bourgeoisen Besitzbürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts der Spiegel vorgehalten.
Einer kurzen historische Einordnung, der soziokulturellen und gesellschaftlichen Zustände der damaligen Zeit, folgt eine Erörterung über Fontanes Mentalitäten und Einstellungen zu eben diesen Zuständen, wie sie anhand brieflicher Zeugnisse festgemacht und belegt werden können. Die zum Teil harschen Worte, die Fontane in seinen Briefen verwendet, woraus seine kritische Haltung deutlich zu ersehen ist, beziehen sich vielfach zwar nicht konkret auf „Frau Jenny Treibel“, so aber doch auf die hierin behandelte Thematik. Die deutlichen Worte schwächen sich zu humoristischen Bildern ab, ein satirischer Grundton hält Einzug in die Schilderungen der Personen und deren Handlungen; dennoch bleibt die Kritik bestehen und ist sowohl für den damaligen als auch für den heutigen Leser unschwer zu erkennen.
So soll auch im weiteren Verlauf der Arbeit, primär anhand der Darstellung der Industriellenfamilie Treibel und seiner Agitationen und Interaktionen im Roman, wobei ein besonderer Augenmerk auf die Hauptgestalt gerichtet ist, versucht werden herauszuarbeiten, inwieweit die satirische Grundkonzeption und die humoristische Darstellungsvariante, Theodor Fontanes gesellschaftskritischen Mentalitäten gerecht und somit als solche nach wie vor erkannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung/ Historischer Kontext
- Fontane und das Bürgertum
- Das Besitzbürgertum/ Akteure
- Primat des Materialismus/ Äußerlichkeitsherrschaft
- Äußerlichkeiten in Einrichtung und Ausstattung
- Äußerlichkeiten/ Repräsentation bei Gesellschaften
- Widerspruch zwischen reellem Sein und ideellem Schein
- Der Typus Jenny Treibel
- Humor und Satire im Dienste der Kritik
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Theodor Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“ im Kontext des ausgehenden 19. Jahrhunderts und untersucht die satirische Darstellung des Besitzbürgertums. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen, die Fontanes Kritik am Bürgertum prägten, und analysiert die literarischen Mittel, die er zur Darstellung der Widersprüche und Scheinheiligkeiten dieser Schicht einsetzt.
- Die gesellschaftliche und historische Einordnung des ausgehenden 19. Jahrhunderts
- Fontanes Kritik am Besitzbürgertum und seine satirische Darstellung
- Die Rolle des Materialismus und der Äußerlichkeiten in der bürgerlichen Gesellschaft
- Der Widerspruch zwischen reellem Sein und ideellem Schein
- Die Figur der Jenny Treibel als Repräsentantin des Besitzbürgertums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der satirischen Darstellung des Besitzbürgertums in Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“ dar.
Das Kapitel „Historische Einordnung/ Historischer Kontext“ beleuchtet die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die den Aufstieg des Bürgertums und die Entstehung des Besitzbürgertums prägten. Es werden die wichtigsten Entwicklungen der Zeit, wie die Industrialisierung, die politische Emanzipation des Bürgertums und die zunehmende Bedeutung des materiellen Reichtums, dargestellt.
Das Kapitel „Fontane und das Bürgertum“ analysiert Fontanes kritische Haltung gegenüber dem Bürgertum und seine literarischen Strategien, um diese Kritik zu artikulieren. Es werden Fontanes Briefe als Quelle für seine Ansichten und seine satirische Herangehensweise an die Darstellung des Bürgertums herangezogen.
Das Kapitel „Das Besitzbürgertum/ Akteure“ stellt die wichtigsten Figuren des Romans vor, insbesondere die Familie Treibel, und beleuchtet ihre Charakterzüge und ihre Rolle in der Gesellschaft. Es wird gezeigt, wie Fontane die typischen Merkmale des Besitzbürgertums, wie den Hang zum Materialismus, die Oberflächlichkeit und die Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung, in seinen Figuren verkörpert.
Das Kapitel „Primat des Materialismus/ Äußerlichkeitsherrschaft“ analysiert die Bedeutung des materiellen Reichtums und der Äußerlichkeiten in der bürgerlichen Gesellschaft. Es wird gezeigt, wie Fontane die Bedeutung von Besitz und Statussymbolen für das Selbstverständnis des Besitzbürgertums satirisch darstellt.
Das Kapitel „Widerspruch zwischen reellem Sein und ideellem Schein“ untersucht die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Verhalten und den moralischen Ansprüchen des Besitzbürgertums. Es wird gezeigt, wie Fontane die Scheinheiligkeit und die Doppelmoral dieser Schicht durch die Darstellung ihrer Handlungen und ihrer Sprache aufdeckt.
Das Kapitel „Der Typus Jenny Treibel“ analysiert die Figur der Jenny Treibel als Repräsentantin des Besitzbürgertums. Es wird gezeigt, wie Fontane durch die Darstellung ihrer Persönlichkeit und ihrer Handlungen die typischen Merkmale dieser Schicht satirisch überzeichnet.
Das Kapitel „Humor und Satire im Dienste der Kritik“ untersucht die literarischen Mittel, die Fontane zur satirischen Darstellung des Besitzbürgertums einsetzt. Es werden die verschiedenen Formen des Humors und der Satire analysiert, die Fontane in seinem Roman verwendet, um die Widersprüche und die Scheinheiligkeit dieser Schicht aufzudecken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den bürgerlichen Realismus, Theodor Fontane, „Frau Jenny Treibel“, Besitzbürgertum, Materialismus, Äußerlichkeiten, Satire, Kritik, Gesellschaft, 19. Jahrhundert, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Fontanes „Frau Jenny Treibel“?
Der Roman ist eine Milieustudie des Berliner Besitzbürgertums im späten 19. Jahrhundert und kritisiert dessen Materialismus und Scheinheiligkeit.
Was charakterisiert die Figur der Jenny Treibel?
Sie gibt sich sentimental und bildungsorientiert („das Höhere“), ist in Wahrheit aber rein materiell und machtbewusst fixiert.
Warum wird der Roman als Satire bezeichnet?
Fontane nutzt Humor und Ironie, um die Diskrepanz zwischen dem idealen Schein und dem tatsächlichen materiellen Sein der Bourgeoisie aufzudecken.
Welche Rolle spielen Äußerlichkeiten im Roman?
Einrichtung, Kleidung und repräsentative Gesellschaften dienen im Besitzbürgertum als Statussymbole zur sozialen Abgrenzung.
Wie stand Fontane persönlich zum Bürgertum?
In seinen Briefen äußerte sich Fontane oft harsch und kritisch über die Engstirnigkeit und den Geldstolz der Schicht, der er selbst angehörte.
Was ist das „sentimentale Lieblingslied“ der Kommerzienrätin?
Es enthält die Zeile „Wo sich Herz zum Herzen find’t“, was ironisch im Kontrast zu Jennys kühler, berechnender Heirats- und Machtpolitik steht.
- Citation du texte
- Peter Golde (Auteur), 2007, Die satirische Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert. Die besitzende Schicht in Fontanes „Frau Jenny Treibel“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148300