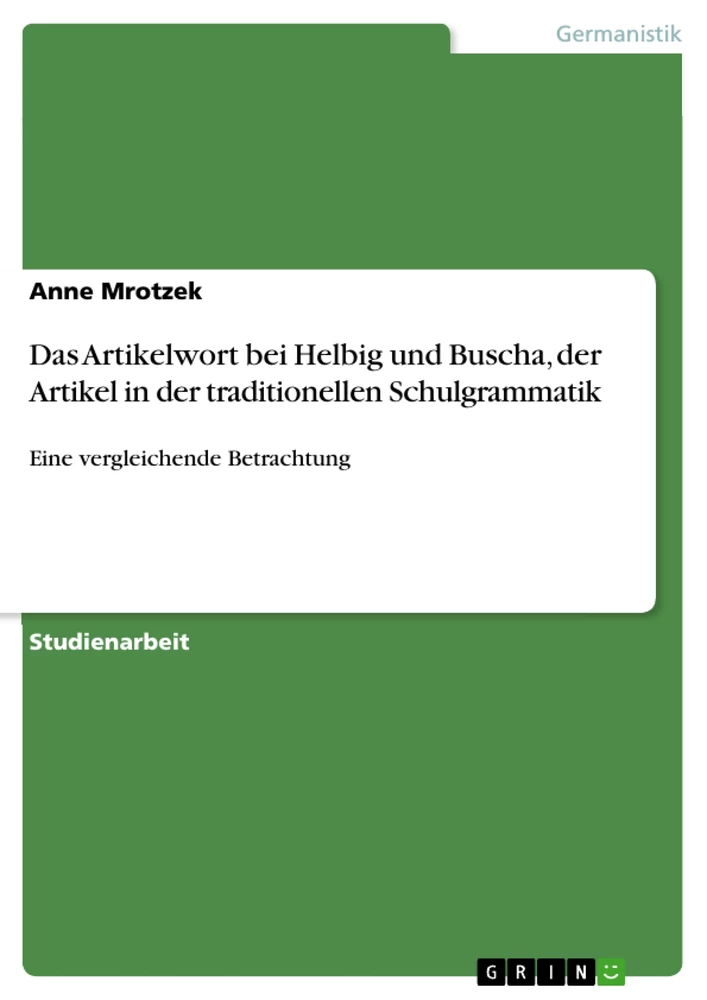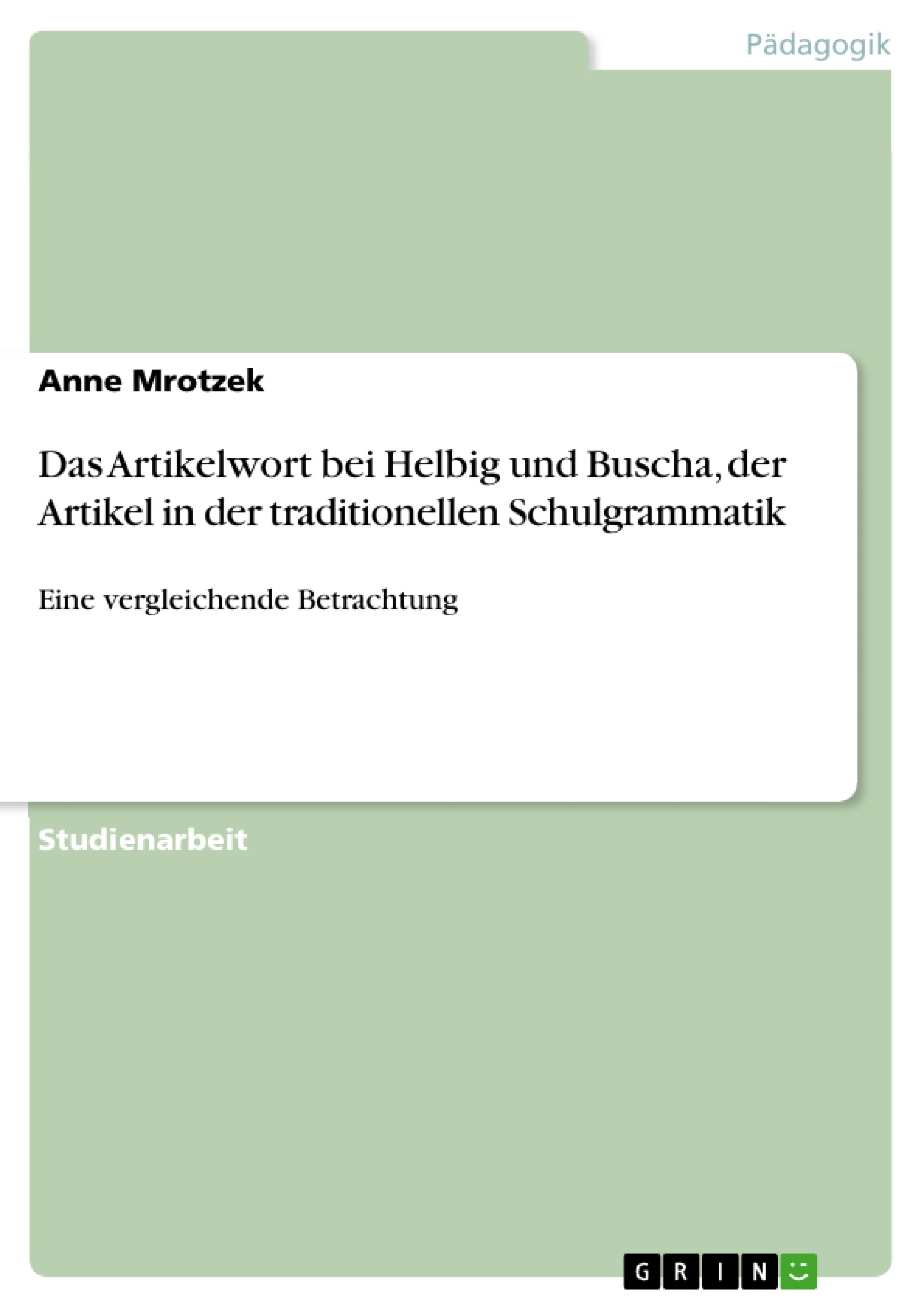Die Bestimmung und Untersuchung der Wortarten im Deutschen stellt sowohl für Schüler als auch für Studenten sehr oft ein grundlegendes Problem dar. Hinzu kommt, dass es eine Vielzahl von Grammatiken gibt, die sich nach unterschiedlichen Kriterien zur Kategorisierung von Wortarten richten. Die Schulgrammatik besitzt keine einheitlichen Kategorisierungskriterien und somit ist es für Schüler schwierig, das erlernte Wortartensystem logisch nachzuvollziehen. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob es eine andere, eventuell bessere Einteilung der Wortarten gibt, die den Schülern die Bestimmung der Wortarten erleichtert.
Besonders die Wortart Artikel/Artikelwort wird in den einzelnen Grammatiksystemen unterschiedlich betrachtet und erfährt dadurch häufig eine Überschneidung mit den Pronomen und Numeralien der traditionellen Schulgrammatik. In der Seminararbeit Das Artikelwort bei Helbig und Buscha, der Artikel in der traditionellen Schulgrammatik. Eine vergleichende Betrachtung. soll zuerst auf das Artikelwort in der Grammatik bei Helbig/Buscha eingegangen werden. Im Anschluss daran wird das traditionelle Wortartensystem der Schulgrammatik am Beispiel des seit 2002 gültigen Brandenburger Rahmenlehrplanes Deutsch für die Sekundarstufe I untersucht. Als Grundlage für die folgende Darstellung wird hierbei das Lehrbuch für den Deutschunterricht Klasse 8 Deutsch. Wege zum sicheren Sprachgebrauch für die vertiefte allgemeine Bildung herangezogen. In diesem Zusammenhang wird zusätzlich peripher auf die Behandlung des Artikels im Duden eingegangen und in die Darstellung eingebracht. Daraufhin erfolgt der Vergleich der Grammatik von Helbig und Buscha mit der traditionellen Schulgrammatik und dem Duden. Es soll diskutiert werden, welche der vorgestellten Handhabungen bei der Darstellung des Artikels für die Schülerinnen und Schüler verständlicher, welche Betrachtung für sie nützlicher ist, aber auch welche Ausführungen für die Umsetzbarkeit im praktischen Unterricht besser geeignet sind. Es soll jedoch keine Empfehlung für die Behandlung des Artikels in der Schule sein, sondern vielmehr die Pro- und Kontra-Argumente der drei Wortartensysteme in Bezug auf den Artikel aufzeigen. In einer Schlussbetrachtung werden die herausgearbeiteten Ergebnisse zusammengefasst und überdies eine kurze kritische Bewertung abgegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Allgemeine Definition des Artikels
- 1.1 Artikelwort bei Helbig/Buscha
- 2. Artikel in der traditionellen Schulgrammatik
- Exkurs: Behandlung des Artikels im Duden
- 3. Vergleich der Grammatiken in Bezug auf den Artikel und Diskussion über die Anwendung in der Schule
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die unterschiedliche Behandlung des Artikels/Artikelwortes in der Grammatik von Helbig/Buscha und in der traditionellen Schulgrammatik. Ziel ist es, die jeweiligen Kategorisierungskriterien zu vergleichen und deren Eignung für den Schulunterricht zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze, ohne eine explizite Empfehlung für die schulische Praxis abzugeben.
- Vergleichende Analyse der Artikelbehandlung in verschiedenen Grammatiken.
- Untersuchung der morphosyntaktischen und semantischen Kriterien zur Artikelklassifizierung.
- Bewertung der Verständlichkeit und Nützlichkeit der verschiedenen Ansätze für Schüler.
- Diskussion der Umsetzbarkeit der unterschiedlichen Grammatikmodelle im Schulunterricht.
- Aufzeigen von Pro- und Kontra-Argumenten der verschiedenen Wortartensysteme bezüglich des Artikels.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wortartenbestimmung im Deutschen ein und hebt die Schwierigkeiten hervor, die sich aus der Vielfalt und den unterschiedlichen Kategorisierungskriterien verschiedener Grammatiken ergeben. Sie benennt den Fokus der Arbeit: den vergleichenden Blick auf die Behandlung des Artikels in der Grammatik von Helbig/Buscha und der traditionellen Schulgrammatik, unter Einbezug des Dudens. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont das Ziel, Pro- und Kontra-Argumente der verschiedenen Ansätze aufzuzeigen, ohne eine definitive Empfehlung auszusprechen.
1. Allgemeine Definition des Artikels: Dieses Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Definition des Artikels, der als Begleiter des Substantivs beschrieben wird, welcher dessen Genus anzeigt und Kasus erkennbar macht. Es wird auf die oft vernachlässigte Rolle des Artikels in vielen Grammatiken hingewiesen.
1.1 Artikelwort bei Helbig/Buscha: Hier wird die Behandlung des Artikelwortes in der Grammatik von Helbig und Buscha detailliert dargestellt. Die Grammatik von Helbig/Buscha basiert auf morphosyntaktischen Kriterien, die semantisch begründet werden, da es sich um eine Grammatik für Nicht-Muttersprachler handelt. Das Kapitel erläutert, welche Wortklassen Helbig/Buscha unterscheiden, wobei das Artikelwort eine eigenständige Klasse bildet. Es werden Beispiele gegeben, um die Kriterien zur Abgrenzung des Artikelwortes von anderen Wortklassen zu verdeutlichen, wie z.B. die obligatorische Verbindung mit einem Substantiv und die Kongruenz in Kasus, Numerus und Genus. Die Ausnahmefälle der Koordinierung von Artikelwörtern werden ebenfalls erklärt.
Schlüsselwörter
Artikelwort, Artikel, Helbig/Buscha, traditionelle Schulgrammatik, Duden, Wortarten, Wortklassen, morphosyntaktische Kriterien, semantische Kriterien, Genus, Kasus, Numerus, Kongruenz, Schulunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Artikelbehandlung in verschiedenen Grammatiken
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Behandlung des Artikels bzw. Artikelwortes in der Grammatik von Helbig/Buscha und in der traditionellen Schulgrammatik. Dabei wird auch der Duden als Referenz herangezogen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist der Vergleich der Kategorisierungskriterien für den Artikel in den verschiedenen Grammatiken und die Diskussion ihrer Eignung für den Schulunterricht. Die Arbeit beleuchtet Vor- und Nachteile der Ansätze, ohne eine explizite Empfehlung für die schulische Praxis abzugeben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Artikelbehandlung vergleichend, untersucht morphosyntaktische und semantische Kriterien zur Klassifizierung, bewertet die Verständlichkeit und Nützlichkeit für Schüler und diskutiert die Umsetzbarkeit im Unterricht. Pro- und Kontra-Argumente der verschiedenen Wortartensysteme bezüglich des Artikels werden aufgezeigt.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur allgemeinen Artikeldefinition, ein Unterkapitel zur Artikelwortbehandlung bei Helbig/Buscha, ein Kapitel zur traditionellen Schulgrammatik, einen Exkurs zum Duden und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt das Thema, die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel fassen die jeweilige Behandlung des Artikels zusammen und vergleichen die Ansätze.
Wie wird der Artikel bei Helbig/Buscha behandelt?
Helbig/Buscha behandeln das Artikelwort als eigenständige Wortklasse, basierend auf morphosyntaktischen Kriterien, die semantisch begründet sind. Die obligatorische Verbindung mit einem Substantiv und die Kongruenz in Kasus, Numerus und Genus sind zentrale Kriterien. Ausnahmefälle wie die Koordinierung von Artikelwörtern werden ebenfalls betrachtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Artikelwort, Artikel, Helbig/Buscha, traditionelle Schulgrammatik, Duden, Wortarten, Wortklassen, morphosyntaktische Kriterien, semantische Kriterien, Genus, Kasus, Numerus, Kongruenz, Schulunterricht.
Gibt die Arbeit eine Empfehlung für den Schulunterricht?
Nein, die Arbeit zeigt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze auf, gibt aber keine definitive Empfehlung für die schulische Praxis ab.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Grammatik von Helbig/Buscha mit der traditionellen Schulgrammatik und bezieht den Duden mit ein.
- Quote paper
- Anne Mrotzek (Author), 2006, Das Artikelwort bei Helbig und Buscha, der Artikel in der traditionellen Schulgrammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148443