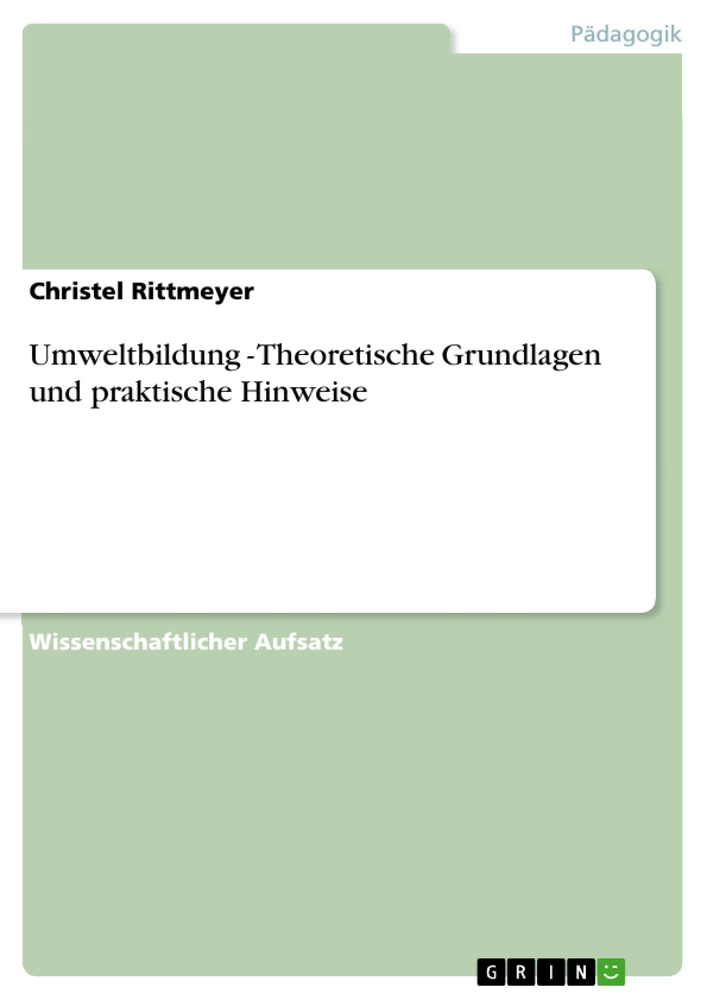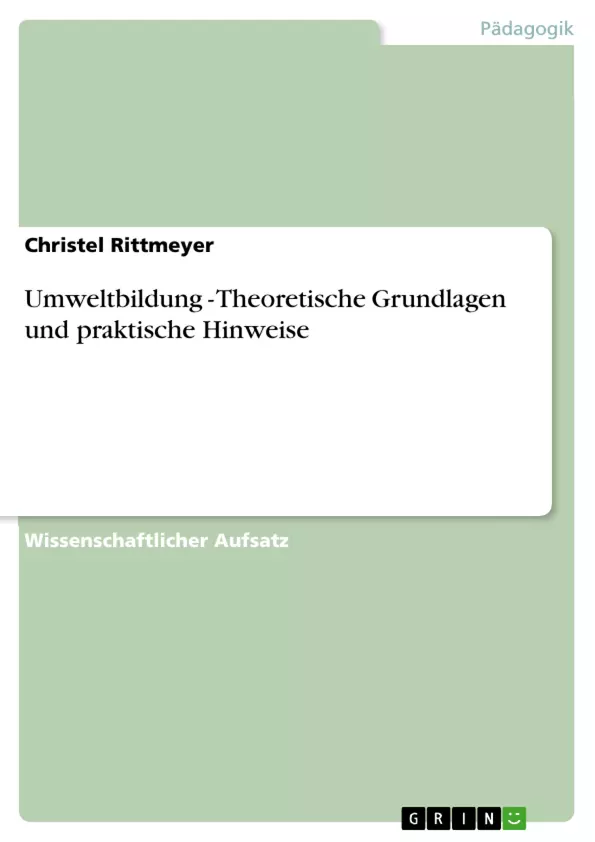In den 80er Jahren veröffentlichte Joseph Cornell einen Ansatz, der ein
Gegengewicht zur damals stark von Umweltproblemen dominierten öffentlichen
Debatte darstellte. Cornells Ansatz war durch einen spielerischen und sinnlichen
Zugang gekennzeichnet und ist in seinem 1979 erschienenen Buch „Mit Kindern die
Natur erleben“ dargestellt (vgl. STEINER/UNTERBRUNER 2005, 9 ff.).
Zahlreiche Ansätze in der heutigen Kinder- und Jugendarbeit sowie der
Erwachsenenbildung realisier(t)en oder integrier(t)en den von Cornell entwickelten
Ansatz der Naturerfahrungspädagogik (beispielsweise Landart und
Naturinterpretation, Naturtherapie und Tiefenökologie, Spiel- und
Erlebnispädagogik).
Anhänger der Naturerfahrungspädagogik gingen und gehen davon aus, dass das
Erleben von Natur auch einen wesentlichen Beitrag zur Umweltbildung liefert: „Nur
was man schätzt, ist man auch bereit zu schützen“ - lautet ihr Credo.
Dies wurde von Kritikern jedoch zurückgewiesen. Sie argumentierten, die
kontemplative Art, sich mit Natur zu beschäftigen, würde die gesellschaftliche
Realität ausblenden und damit entpolitisierend wirken.
Empirische Untersuchungen sprechen gegen diese Kritik an der
Naturerfahrungspädagogik. Sie zeichnen ein differenziertes und durchaus für die
Naturerfahrungspädagogik sprechendes Bild.
So wird von einer Reihe von empirischen Studien die Bedeutung von
Naturerfahrungen für die psychische Entwicklung nachgewiesen. Der besondere
Wert der Natur liegt diesen Untersuchungen zufolge im gleichzeitigen Erleben von
Veränderung und Kontinuität sowie der Möglichkeit, Bedürfnisse nach Abenteuer und
„Wildnis“ ausleben zu können. Insgesamt ist die Natur für Kinder und Jugendliche
häufig ein Symbol für Lebensqualität und Lebensfreude. Von Bogner wurde
nachgewiesen, dass Naturerlebnisse Naturschutzeinstellungen bei Schülern
erhöhen. Bögeholz und Lude wiesen nach, dass Naturerfahrung das Entstehen
umweltbewusster Einstellungen und vor allem auch Handlungsbereitschaften positiv
beeinflusst (a. a. O., 12).
Dem Naturerleben kommt eine besondere Bedeutung zu, weil „im Verhältnis des
Menschen zur Natur stets auch sein Verhältnis zu sich selbst sichtbar wird“ (a. a. O., 12). Deshalb
sind die Erfahrungen, die wir in und mit der Natur machen, auch Erfahrungen mit uns
selbst (vgl. ebd.).[...]
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Grundlagen und praktische Hinweise
- Theoretische Grundlagen der Naturerfahrungspädagogik
- Naturerfahrungen und Naturphänomene
- Die ästhetische Dimension von Naturerlebnissen
- Naturerleben und Spiritualität
- Ziele der Naturerlebnispädagogik
- Die Kantische Perspektive
- Erlebnispädagogik: Ein historischer Abriss
- Die drei Dimensionen des Lernens
- Natur als pädagogisches Setting
- Natur als Analogie
- Natur als Spiegel-Raum
- Außerschulische Lernorte zur Umweltbildung am Beispiel der Waldschule Düsseldorf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „Umweltbildung“ befasst sich mit den theoretischen Grundlagen und der praktischen Anwendung der Naturerfahrungspädagogik. Es beleuchtet die Bedeutung von Naturerfahrungen für die Entwicklung von Wertschätzung und Handlungsbereitschaft gegenüber der Natur. Ziel ist es, den Ansatz der Naturerfahrungspädagogik als eine wertvolle Ergänzung zur Umweltbildung zu etablieren und Möglichkeiten für die praktische Umsetzung aufzuzeigen.
- Die Rolle von Naturerfahrungen in der Umweltbildung
- Die Bedeutung der ästhetischen Dimension von Naturerlebnissen
- Die Verbindung von Naturerfahrung und Selbsterfahrung
- Natur als pädagogisches Setting, Analogieraum und Spiegel-Raum
- Außerschulische Lernorte zur Umweltbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Naturerfahrungspädagogik. Es stellt den Ansatz von Joseph Cornell vor, der einen spielerischen und sinnlichen Zugang zur Natur propagierte. Es werden verschiedene Ansätze der Naturerfahrungspädagogik vorgestellt, die sich in der heutigen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Erwachsenenbildung wiederfinden.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Naturerfahrungen und Naturphänomenen für die Persönlichkeitsentwicklung. Es wird die Bedeutung der Natur als Interaktionspartner und die ästhetische Dimension von Naturerlebnissen hervorgehoben. Darüber hinaus wird die Verbindung von Naturerfahrung und Selbsterfahrung diskutiert.
Im dritten Kapitel werden die Ziele der Naturerlebnispädagogik dargestellt. Es wird betont, dass die Naturerfahrungspädagogik nicht als Alternative, sondern als wichtige Ergänzung zur Naturwissenschaft verstanden werden sollte.
Schlüsselwörter
Naturerfahrungspädagogik, Umweltbildung, Naturerleben, ästhetische Dimension, Selbsterfahrung, pädagogisches Setting, Analogieraum, Spiegel-Raum, außerschulische Lernorte, Waldschule Düsseldorf
Häufig gestellte Fragen
Was ist Naturerfahrungspädagogik?
Ein Ansatz (u. a. von Joseph Cornell), der durch spielerische und sinnliche Erlebnisse in der Natur die Wertschätzung für die Umwelt fördern will.
Führt Naturerleben automatisch zu Umweltschutz?
Studien zeigen, dass positive Naturerfahrungen die Naturschutzeinstellungen und die Handlungsbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich erhöhen.
Was bedeutet „Natur als Spiegel-Raum“?
Es beschreibt die Idee, dass Erfahrungen in der Natur auch Erfahrungen mit sich selbst sind; das Verhältnis zur Natur spiegelt oft das Verhältnis zum eigenen Selbst wider.
Welche Rolle spielen außerschulische Lernorte wie Waldschulen?
Sie bieten den notwendigen Raum für praktische Erfahrungen, die im klassischen Klassenzimmer nicht möglich sind, und fördern die emotionale Bindung zur Umwelt.
Was ist die ästhetische Dimension von Naturerlebnissen?
Dazu gehört das Wahrnehmen von Schönheit, Stille und Kontinuität in der Natur, was einen wesentlichen Beitrag zur psychischen Entwicklung von Kindern leistet.
- Citation du texte
- Apl. Professor Dr. Christel Rittmeyer (Auteur), 2010, Umweltbildung - Theoretische Grundlagen und praktische Hinweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148516