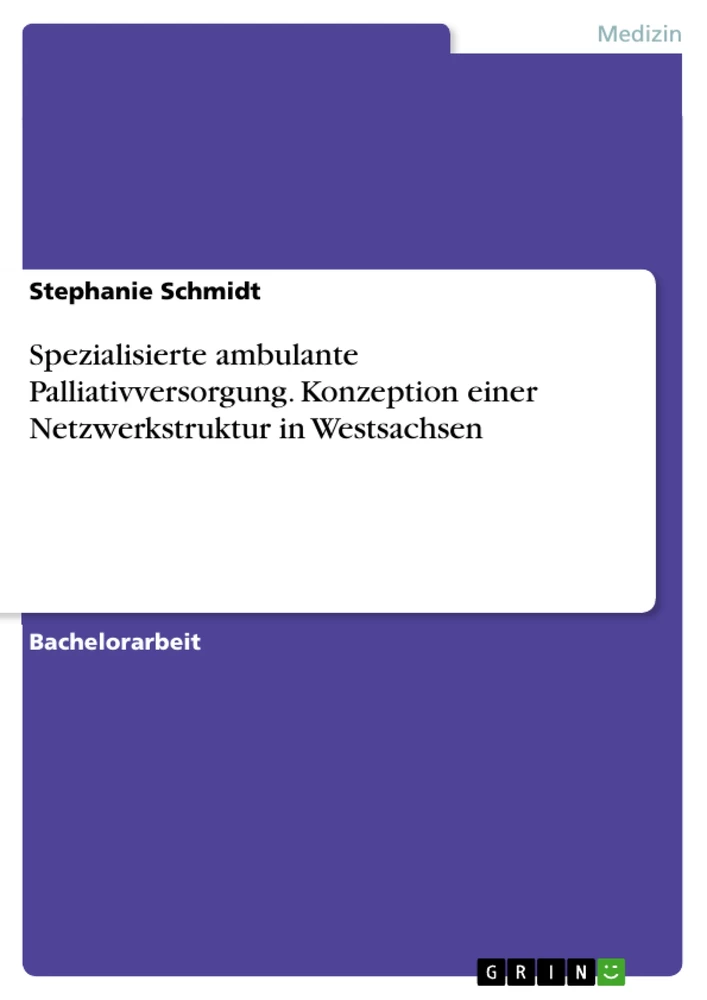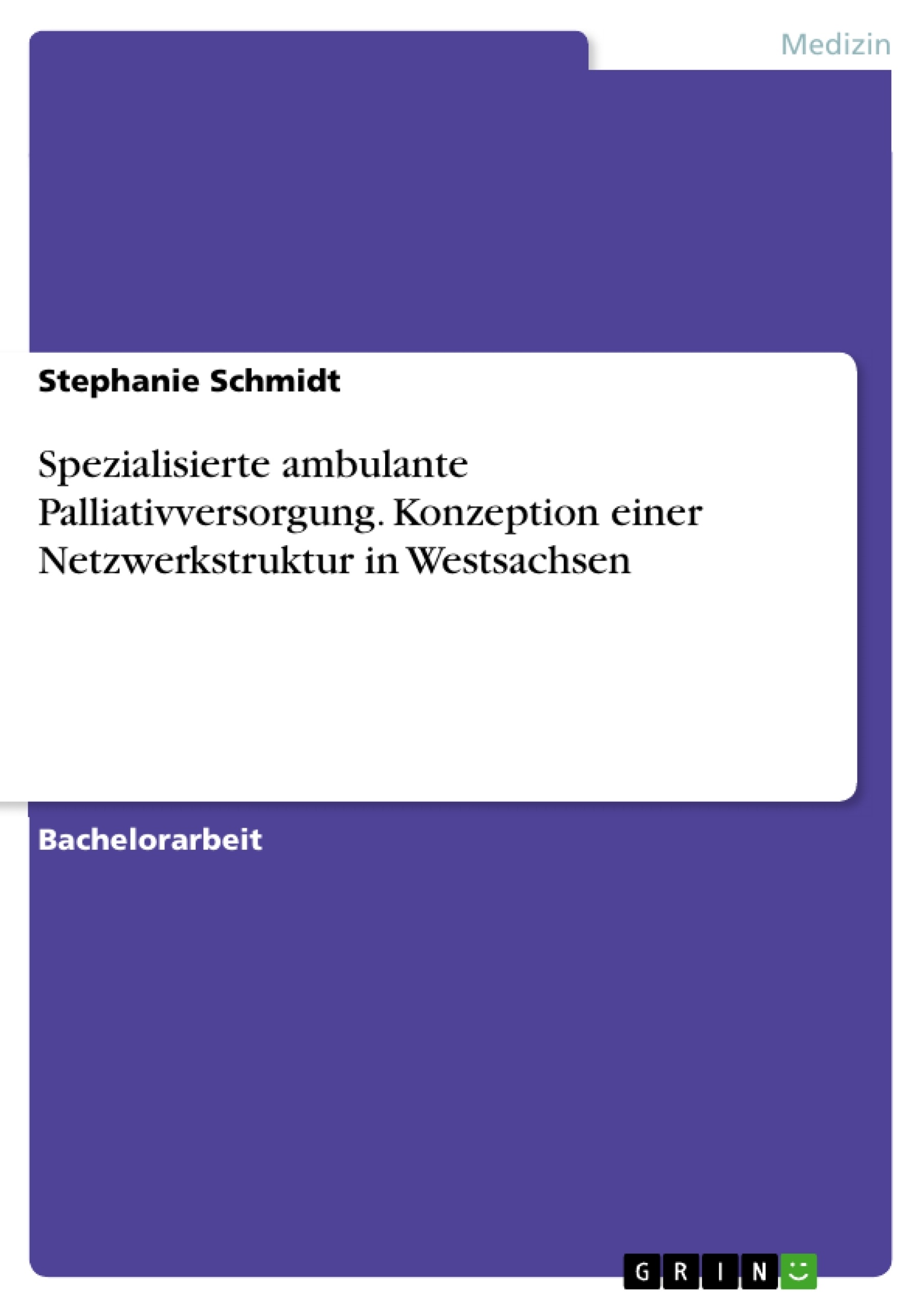Verbesserte Lebensbedingungen und Fortschitte in der Medizin führten zu einem demographischen Wandel. Daraus ergaben sich gesundheitspolitische Herausforderungen auch im Umgang mit den Themen Sterben und Tod. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte eine Institutionalisierung des Sterbens, obwohl es der Wunsch der meisten Menschen ist in der Häuslichkeit zu versterben. Seit dem 1. April 2007 haben Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung einen Anspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Der Kerngedanke der SAPV ist es, Patientinnen und Patienten am Lebensende zu Hause zu betreuen,und zwar von spezialisierten Arzt-Pflege-Teams. Diese berücksichtigen die örtlichen Angebotsstrukturen.
In der vorliegenden Arbeit wurden die zu beteiligenden Professionen und Disziplinen, der Versorgungsbedarf im Raum Zwickau sowie die bereits bestehenden Angebote analysiert und bei der Gestaltung der Netzwerkstruktur berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1 Palliative Care
- 2.1.1 Begriffsdefinition
- 2.1.2 Begriffsherkunft und -entwicklung - Cicely Saunders
- 2.1.3 Palliative Care als Versorgungskonzept
- 2.1.4 Lebensqualität als zentrales Ziel der Palliative Care
- 2.2 Palliative Home Care
- 2.2.1 Zunahme stationärer und ambulanter Einrichtungen
- 2.2.2 SGB V, rechtliche Bestimmungen und Empfehlungen
- 2.2.3 Leistungserbringer
- 2.2.4 Basisvoraussetzungen für SAPV
- 2.2.5 Bedeutung der ambulanten Palliativversorgung
- 2.3 Netzwerk und Netzwerkbildung
- 2.3.1 Definition und Abgrenzung
- 2.3.2 Grundlagen
- 2.3.3 Arten, Typen und Erscheinungsformen
- 3. Zielstellung
- 4. Methodik
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.2 Begründung
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Professionen und Disziplinen
- 5.2 Entwicklungsstand SAPV in Sachsen
- 5.3 Versorgungbedarf im Landkreis Zwickau
- 5.4 Angebotsstrukturen im Landkreis Zwickau - Ist-Analyse
- 5.4.1 Stationäre Versorgung
- 5.4.2 Ambulante Versorgung
- 5.4.3 Versorgung mit Arznei- und Hilfsmitteln
- 5.4.5 Zusammenfassung
- 6. Diskussion
- 7. Vorschläge für die Netzwerkbildung
- 7.1 Zielvorstellung
- 7.2 Zielgruppe
- 7.3 Netzwerkzentrale
- 7.4 Phasen der Netzwerkbildung
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Konzeption einer Netzwerkstruktur für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Westsachsen. Ziel ist es, die Qualität der palliativen Versorgung in der Region zu verbessern und eine effektivere Zusammenarbeit der beteiligten Akteure zu fördern.
- Bedeutung und Entwicklung der Palliative Care
- Relevanz der ambulanten Palliativversorgung
- Netzwerkbildung als Konzept zur Verbesserung der Versorgung
- Analyse des aktuellen Versorgungsbedarfs und -angebots in Westsachsen
- Entwicklung von Vorschlägen für die Gestaltung einer Netzwerkstruktur für die SAPV
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen der Palliative Care, der ambulanten Palliativversorgung und der Netzwerkbildung. Kapitel 3 beschreibt die Zielstellung der Arbeit. Kapitel 4 erläutert die Methodik, die zur Erstellung der Arbeit verwendet wurde. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Analyse des Versorgungsbedarfs und -angebots in Westsachsen. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse der Analyse. Kapitel 7 entwickelt Vorschläge für die Gestaltung einer Netzwerkstruktur für die SAPV. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Palliative Care, spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), Netzwerkbildung, Versorgungskonzept, Lebensqualität, Westsachsen, Versorgungsbedarf, Angebotsstrukturen, Netzwerkstruktur, interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)?
SAPV ist ein Angebot für schwerstkranke Menschen am Lebensende, das eine spezialisierte medizinische und pflegerische Betreuung in der eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht.
Wer hat Anspruch auf SAPV?
Seit dem 1. April 2007 haben alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf diese spezialisierte Versorgung.
Was ist das Ziel von Palliative Care?
Das zentrale Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen durch die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen.
Warum ist eine Netzwerkstruktur in der Palliativversorgung wichtig?
Ein Netzwerk koordiniert die Zusammenarbeit verschiedener Professionen (Ärzte, Pflege, Hospizdienste), um eine lückenlose Versorgung des Patienten zu gewährleisten.
Wie sieht die Versorgungslage im Landkreis Zwickau aus?
Die Arbeit analysiert den spezifischen Bedarf und die bestehenden stationären sowie ambulanten Angebote in Westsachsen, um Vorschläge für eine optimierte Netzwerkbildung zu machen.
- Citation du texte
- Stephanie Schmidt (Auteur), 2009, Spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Konzeption einer Netzwerkstruktur in Westsachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148552