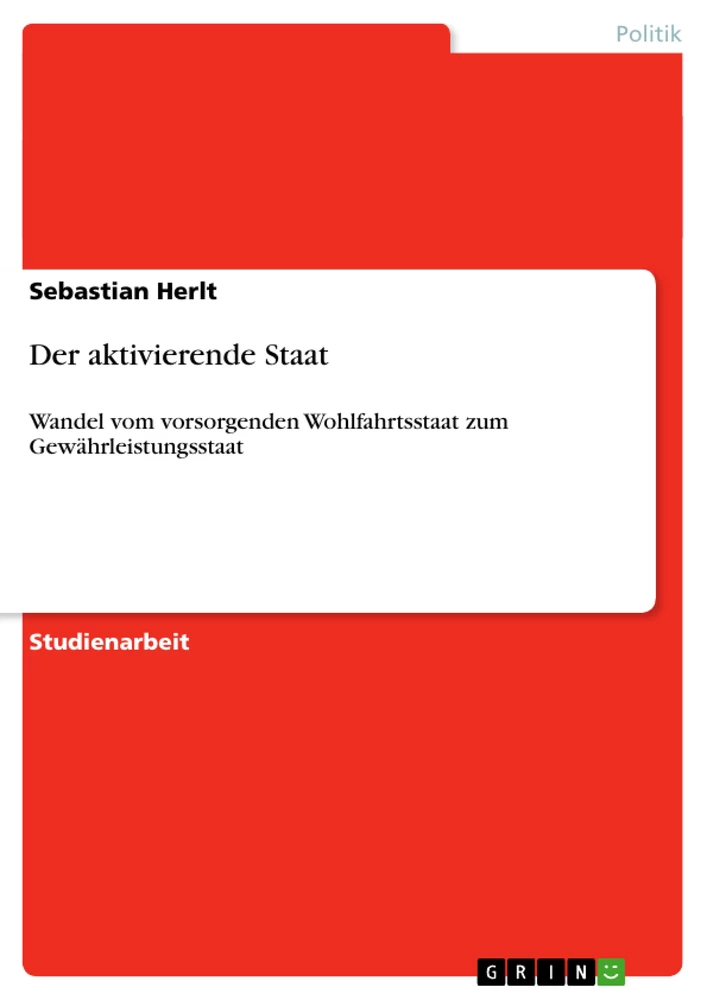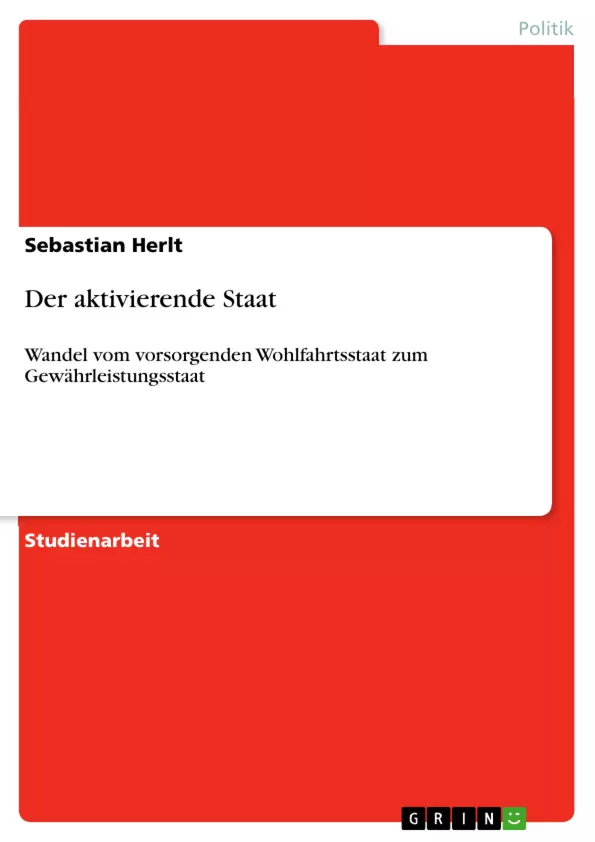Das Staatskonzept des sozialen Wohlfahrtsstaates blühte nach dem Zweiten Weltkrieg in
Westeuropa regelrecht auf. Bis zum Ende der 1970er Jahren wurden vorbehaltlos bestehende
Programme der sozialen Sicherung ausgebaut und die Leistungstiefe durch neu aufgelegte
Wohlfahrtsmaßnahmen ausgeweitet. Spätestens mit dem aufkommenden Leitbild des „Aktiven
Staates“ wurde der fürsorgende Wohlfahrtsstaat zu einem prägenden Kennzeichen der
deutschen Sozialstruktur. Die expansive Sozialpolitik zu jener Zeit wurde als Gegenkurs zu
den gesellschaftlichen Entwicklungen, Herausforderungen und vor allem Ängsten gesehen,
deren primäre Funktion eine stabilisierende war. Der Erhalt des sozialen Friedens sollte nicht
nur in Deutschland, sondern auch in anderen westeuropäischen Ländern eine neuerliche Katastrophe,
wie den Zweiten Weltkrieg, verhindern helfen. Der Wohlfahrtsstaat wurde in jenen
Jahren als Fundament der demokratischen Ordnung von allen gesellschaftlichen Kräften begrüßt
und galt als gewichtiges Element für eine erfolgreiche ökonomische Entwicklung. Die
konzeptionelle Wende deutete sich mit der ersten Ölpreiskrise von 1973 an. Der erste große
volkswirtschaftliche Einbruch führte zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und zu
einer massiven Belastung des öffentlichen Haushalts. Die Staatsschuldenkrise verschärfte sich
und der vorbehaltlose Wohlfahrtsstaat kam in die kritische Diskussion. Antagonistisch zum
sozialen Wohlfahrtsstaat entwickelten konservative Kräfte das neoliberale Leitbild des
„Schlanken Staates“. Dieses Konzept sieht eine massive Rückführung von staatlichen Leistungen
und Aufgaben sowie die Konzentration des Staates auf elementare Kernbereiche vor.
Die bisherigen Aufgaben des Sozialstaats sollten entweder eingeschränkt oder in die Hände
von privatwirtschaftlichen Leistungserzeugern übergeben werden. Dieses Leitbild setzte sich
ab den 80er Jahren verschieden stark in der Praxis durch, wenngleich die nationalen Ausprägungen
in den westeuropäischen Ländern verschieden waren und der schlanke Staat in
Deutschland weniger drastisch umgesetzt wurde. Seitdem ist der ideologische Antagonismus:
fürsorgender Sozialstaat versus neoliberaler Minimalstaat offensichtlich und bestimmt wesentlich
die konzeptionelle Staatsdiskussion. Den steigenden Ausgaben wurde mit einer Senkung
der Staatsquote mittels Privatisierung und einer betriebswirtschaftlich inspirierten Binnenmodernisierung
der Verwaltung begegnet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Governance und aktivierender Staat
- Bewahrung der staatlichen Handlungsfähigkeit
- Staatsverständnis im Wandel
- Aktivierender Staat und Verantwortungsteilung
- Leistungsaktivierung
- Aktivierende Arbeitsmarktpolitik
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das sozialpolitische Fundament des aktivierenden Staates. Ziel ist es, das Rollenverständnis von Staat und Gesellschaft zu beleuchten, welches das Leitbild des aktivierenden Staates prägt.
- Governancekonzept als theoretische Grundlage des aktivierenden Staates
- Historische Entwicklung der staatlichen Leitbilder seit den 1970er Jahren in Deutschland
- Kernelemente des aktivierenden Staates und das Verhältnis zwischen Akteuren
- Normative Intention des aktivierenden Staates
- Der aktivierende Staat in der Praxis, insbesondere die deutsche Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung vom sozialen Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Staat, beginnend mit der expansiven Sozialpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg und der kritischen Diskussion, die mit der ersten Ölpreiskrise von 1973 einsetzte.
- Governance und aktivierender Staat: Dieses Kapitel führt das Governancekonzept als theoretische Grundlage des aktivierenden Staates ein. Es beleuchtet die Abkehr von der akteurszentrierten Steuerungsperspektive und den Fokus auf die Regelungsstruktur und den daraus resultierenden Prozess.
- Bewahrung der staatlichen Handlungsfähigkeit: Der dritte Teil der Arbeit beleuchtet die Kernelemente des aktivierenden Staates und analysiert das Verhältnis zwischen den Akteuren. Es geht dabei auch um die normative Intention des aktivierenden Staates.
- Staatsverständnis im Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der staatlichen Leitbilder seit den 1970er Jahren in Deutschland. Es zeigt die Veränderungen im Staatsverständnis und die Herausforderungen, die mit der Globalisierung einhergehen.
- Aktivierender Staat und Verantwortungsteilung: Das Kapitel behandelt die Frage der Verantwortungsteilung im Kontext des aktivierenden Staates. Es beleuchtet, wie der Staat seine Aufgaben neu definiert und welche Rolle die Bürgergesellschaft dabei spielt.
- Leistungsaktivierung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Leistungsaktivierung als ein zentrales Element des aktivierenden Staates. Es analysiert, wie der Staat die Bürger zur Eigeninitiative ermutigen und ihre Leistungsfähigkeit fördern kann.
- Aktivierende Arbeitsmarktpolitik: Das Kapitel behandelt die aktivierende Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. Es beleuchtet die Reformen der letzten Jahre und analysiert, wie diese den Übergang vom passiven zum aktiven Arbeitsmarkt gestalten sollen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind der aktivierende Staat, Governance, Wohlfahrtsstaat, Staatsverständnis, Verantwortungsteilung, Leistungsaktivierung, Arbeitsmarktpolitik und die Herausforderungen der Globalisierung. Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Staatsverständnisses und der Rolle des Staates in einer sich wandelnden Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Konzept des „Aktivierenden Staates“?
Der aktivierende Staat ist ein Leitbild, das den klassischen fürsorgenden Wohlfahrtsstaat ablöst. Er setzt auf Eigenverantwortung der Bürger und fördert deren Initiative, statt nur passiv Leistungen zu erbringen.
Wie unterscheidet sich der aktivierende Staat vom „Schlanken Staat“?
Während der neoliberale „Schlanke Staat“ auf eine massive Rückführung staatlicher Aufgaben setzt, zielt der aktivierende Staat auf eine neue Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft ab.
Welches Ereignis markierte die Wende in der deutschen Sozialpolitik?
Die erste Ölpreiskrise von 1973 und die darauffolgende wirtschaftliche Belastung führten dazu, dass der vorbehaltlose Ausbau des Wohlfahrtsstaates kritisch hinterfragt wurde.
Was ist die theoretische Grundlage des aktivierenden Staates?
Das Governancekonzept dient als theoretische Basis, wobei der Fokus auf Regelungsstrukturen und Prozessen liegt, statt auf einer rein hierarchischen Steuerung.
Wie zeigt sich der aktivierende Staat in der Praxis?
Ein zentrales Beispiel ist die deutsche Arbeitsmarktpolitik, die durch Reformen den Übergang von passiver Unterstützung zu aktiver Leistungsaktivierung und Eigeninitiative gestaltet.
Welche Rolle spielt die Globalisierung in diesem Wandel?
Die Globalisierung stellt die staatliche Handlungsfähigkeit vor neue Herausforderungen, was eine Neudefinition der staatlichen Aufgaben und eine stärkere Einbindung der Bürgergesellschaft notwendig macht.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Sebastian Herlt (Autor:in), 2009, Der aktivierende Staat , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148589