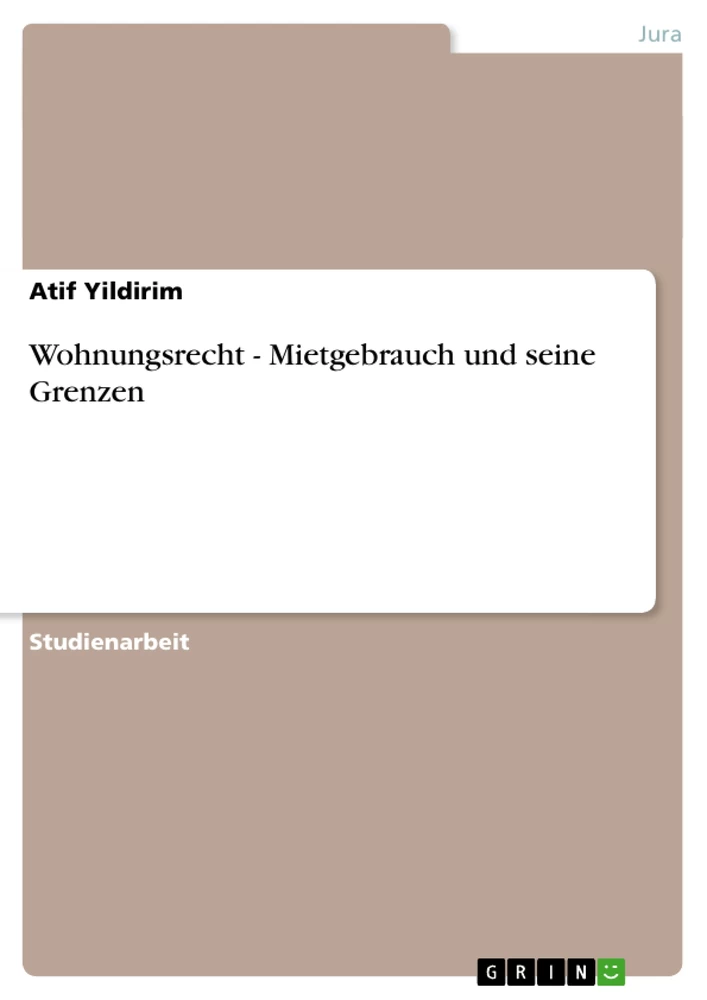A. Allgemeines
Gemäß § 535 Abs.1 S.1 BGB wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der
Mietzeit zu gewähren. In diesem breiten Spektrum finden sich eine große Anzahl von Konstellationen, in der
Interessengegensätze aufeinander prallen. Dieses Spektrum reicht von der Installation einer Parabolantenne bis zur
Untervermietung der Mietsache und noch viel weiter.
Die Hauptpflicht des Vermieters besteht darin, den Gebrauch der Mietsache zu gewähren. Diese beschränkt sich nicht nur
darauf, den Besitz des Mieters nicht aktiv zu stören. Vielmehr geht diese Pflicht insoweit, als dass der Vermieter
Besitzstörungen gegebenenfalls durch positives Tun abzuwenden hat, um den Mieter den vertragsgemäßen Gebrauch zu
gewähren. Während dessen ist der Mieter verpflichtet, Wohngebrauchsüberschreitungen zu unterlassen1. Wohnt der
Vermieter im selben Haus, treffen ihn weitgehend die selben Verpflichtungen und Wohnverhaltensregeln. Auch der nicht
im Hause wohnende Vermieter muss sich so behandeln lassen, wie er es von seinen Mietern verlangt. Daher darf sich der
Vermieter beispielsweise nicht gegen einen lauten Mieter wehren, wenn er selber im Erdgeschoss eine Diskothek unterhält.
I. Rechtsstellung des Mieters bezgl. des Mietgebrauchs
Mieter können sich auf den Schutz des Eigentums durch Art. 14 Abs.1 GG berufen; das Besitzrecht des Mieters ist dem
Eigentumsrecht des Vermieters gleichgestellt2. Dies begründet sich überwiegend damit, dass die Wohnung dem Mieter als
räumlicher Mittelpunkt freier Entfaltung seiner Persönlichkeit und als Freiraum eigenverantwortlicher Betätigung dient und
der grundrechtliche Eigentumsschutz Elemente der allgemeinen Handlungsfreiheit, sowie des allgemeinen
Persönlichkeitsrechtes beinhaltet3.
II. Rechtsstellung des Vermieters bezgl. des Mietgebrauchs
Der Vermieter wiederum hat neben seinem grundrechtlichen Eigentumsschutz, die Möglichkeit auf Unterlassung zu
klagen, wenn der Mieter einen, noch näher zu erläuternden, vertragswidrigen Gebrauch trotz einer Abmahnung fortsetzt, §
541 BGB. Des Weiteren steht dem vermietenden Eigentümer ein Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs.1 S.1 BGB bzw.
ein Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs.1 S.2 BGB gegen den störenden Mieter zu. [...]
1 Brox/ Walker, in Bes.SchR § 11 Rn.28
2 BVerfG WM 1993, 37
3 BVerfG WM 1994, 121; BVerfG WM 1989, 114
Inhaltsverzeichnis
- A. Allgemeines
- I. Rechtsstellung des Mieters bezgl. des Mietgebrauchs
- II. Rechtsstellung des Vermieters bezgl. des Mietgebrauchs
- B. Hausordnung
- C. Mietgebrauch
- I. in zeitlicher Hinsicht
- II. in räumlicher Hinsicht
- D. Einzelfälle
- III. Besonderheiten bei Wohnungseigentum
- IV. Nutzung als Wohnung
- V. Mischnutzung
- I. berufliche Nutzung
- II. Einbauten des Mieters
- III. Aufnahme von Personen
- 1. Erlaubnis des Vermieters
- 2. Ausnahmen
- 3. mietvertraglicher Ausschluss
- IV. Haustierhaltung
- V. Musik/ Lärm
- VI. Parabolantenne
- VII. Untervermietung
- VIII. Sonstiges
- IX. Ergebnis
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Mietgebrauch und seine Grenzen im deutschen Mietrecht. Sie analysiert die Rechtspositionen von Mieter und Vermieter und beleuchtet die verschiedenen Aspekte, die den zulässigen Gebrauch einer Mietsache definieren. Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den möglichen Konflikten, die im Zusammenhang mit dem Mietgebrauch auftreten können.
- Rechtsstellung von Mieter und Vermieter bezüglich des Mietgebrauchs
- Auswirkungen von Hausordnungen auf den Mietgebrauch
- Zulässige und unzulässige Nutzungen der Mietsache (z.B. berufliche Nutzung, Haustiere, Untervermietung)
- Bedeutung von vertraglichen Vereinbarungen
- Konfliktlösung und rechtliche Möglichkeiten bei Streitigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
A. Allgemeines: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die rechtliche Verpflichtung des Vermieters zum Gewähren des Mietgebrauchs gemäß § 535 Abs. 1 S.1 BGB erläutert. Es werden die Interessengegensätze zwischen Mieter und Vermieter in Bezug auf den Gebrauch der Mietsache angesprochen und die Bandbreite möglicher Konflikte, von der Installation einer Parabolantenne bis zur Untervermietung, dargelegt. Die Hauptpflicht des Vermieters, den Gebrauch aktiv zu ermöglichen und nicht nur passiv zu dulden, wird betont. Gleichzeitig wird die Pflicht des Mieters, den vertragsgemäßen Gebrauch einzuhalten, hervorgehoben. Die gegenseitigen Verpflichtungen werden auch im Hinblick auf den Fall beleuchtet, dass der Vermieter im selben Haus wohnt.
B. Hausordnung: Die Hausordnung wird als ergänzende Vertragsbestimmung für Mehrfamilienhäuser erklärt. Ihr Zweck liegt in der Aufrechterhaltung von Ordnung, Sicherheit und Hausfrieden. Die Arbeit erläutert, wie Hausordnungen rechtlich wirksam Bestandteil des Mietvertrags werden und welche Anforderungen an deren Formulierung und Gestaltung gestellt werden (z.B. die Unwirksamkeit von Klauseln, die die Beweislast ungerechtfertigt verschieben). Der Gleichheitsgrundsatz bei der Aufstellung einer Hausordnung wird betont, und die Wirkung der Hausordnung sowohl im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter als auch unter den Mietern untereinander wird dargestellt.
C. Mietgebrauch: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Inhalt und Umfang des Mietgebrauchs, der primär aus dem Mietvertrag resultiert. Es wird klargestellt, dass der Mieter zum Gebrauch berechtigt, aber nicht verpflichtet ist. Die Bedeutung der Vertragsauslegung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und Verkehrssitte wird hervorgehoben. Die §§ 138 und 242 BGB werden als absolute Grenzen des zulässigen Mietgebrauchs genannt.
D. Einzelfälle: Dieses Kapitel analysiert verschiedene konkrete Szenarien des Mietgebrauchs, darunter die Besonderheiten im Wohnungseigentum, die Nutzung der Wohnung, Mischnutzungen (z.B. berufliche Nutzung), Einbauten des Mieters, die Aufnahme von Personen (einschließlich nichtehelicher Lebenspartner und der rechtlichen Aspekte des Ausschlusses im Mietvertrag), die Haustierhaltung, Musik/Lärm, die Installation von Parabolantennen, die Untervermietung sowie weitere Aspekte wie Garten, Heizung, Balkon, Schlüssel, Treppenhaus, Müll, Rauchen und das Spielen von Kindern. Für jeden dieser Aspekte wird der jeweilige rechtliche Rahmen und die möglichen Konflikte zwischen Mieter und Vermieter eingehend erörtert.
Schlüsselwörter
Mietgebrauch, Mietrecht, Vermieter, Mieter, Hausordnung, Wohnungseigentum, Vertragsauslegung, Mischnutzung, Untervermietung, Haustiere, Lärm, Parabolantenne, BGB, § 535 BGB, § 541 BGB, § 1004 BGB, § 543 BGB.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mietgebrauch im deutschen Mietrecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht umfassend den Mietgebrauch und seine Grenzen im deutschen Mietrecht. Sie analysiert die Rechtspositionen von Mietern und Vermietern und beleuchtet verschiedene Aspekte, die den zulässigen Gebrauch einer Mietsache definieren. Die Arbeit befasst sich mit rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Konflikten im Zusammenhang mit dem Mietgebrauch.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Rechtsstellung von Mietern und Vermietern bezüglich des Mietgebrauchs, die Auswirkungen von Hausordnungen, zulässige und unzulässige Nutzungen der Mietsache (z.B. berufliche Nutzung, Haustiere, Untervermietung), die Bedeutung von vertraglichen Vereinbarungen und Konfliktlösung bei Streitigkeiten. Konkrete Einzelfälle wie die Installation einer Parabolantenne, Musik/Lärm, die Aufnahme von Personen oder die Nutzung von Gemeinschaftsflächen werden detailliert behandelt.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Ein allgemeiner Teil legt die rechtlichen Grundlagen dar. Es folgt ein Kapitel zur Hausordnung und ein Kapitel zum Mietgebrauch im Allgemeinen. Der Hauptteil analysiert verschiedene Einzelfälle des Mietgebrauchs, einschließlich Besonderheiten bei Wohnungseigentum und Mischnutzungen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Rolle spielt die Hausordnung im Mietrecht?
Die Hausordnung wird als ergänzende Vertragsbestimmung für Mehrfamilienhäuser erklärt. Sie dient der Aufrechterhaltung von Ordnung, Sicherheit und Hausfrieden. Die Arbeit erläutert die rechtlichen Anforderungen an die Formulierung und Gestaltung einer Hausordnung und deren Wirkung im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter sowie unter den Mietern untereinander.
Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter bezüglich des Mietgebrauchs?
Die Arbeit beleuchtet die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern. Der Mieter hat das Recht, die Mietsache vertragsgemäß zu nutzen, ist aber nicht zur Nutzung verpflichtet. Der Vermieter hat die Pflicht, den vertragsgemäßen Gebrauch zu ermöglichen. Die Arbeit analysiert die Interessengegensätze und möglichen Konflikte zwischen beiden Parteien.
Welche Einzelfälle des Mietgebrauchs werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht zahlreiche Einzelfälle, darunter die berufliche Nutzung der Wohnung, Einbauten des Mieters, die Aufnahme von Personen, Haustierhaltung, Musik/Lärm, Installation von Parabolantennen, Untervermietung und die Nutzung von Gemeinschaftsflächen wie Garten, Balkon und Treppenhaus. Für jeden Fall wird der jeweilige rechtliche Rahmen und die möglichen Konflikte erörtert.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere § 535 BGB (Verpflichtung des Vermieters), § 541 BGB (Nebenpflichten des Vermieters), § 1004 BGB (Beseitigungsanspruch) und § 543 BGB (Vertragsänderung). Weitere relevante Paragraphen werden im Kontext der jeweiligen Einzelfälle genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mietgebrauch, Mietrecht, Vermieter, Mieter, Hausordnung, Wohnungseigentum, Vertragsauslegung, Mischnutzung, Untervermietung, Haustiere, Lärm, Parabolantenne, BGB, § 535 BGB, § 541 BGB, § 1004 BGB, § 543 BGB.
- Citation du texte
- Atif Yildirim (Auteur), 2003, Wohnungsrecht - Mietgebrauch und seine Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14872