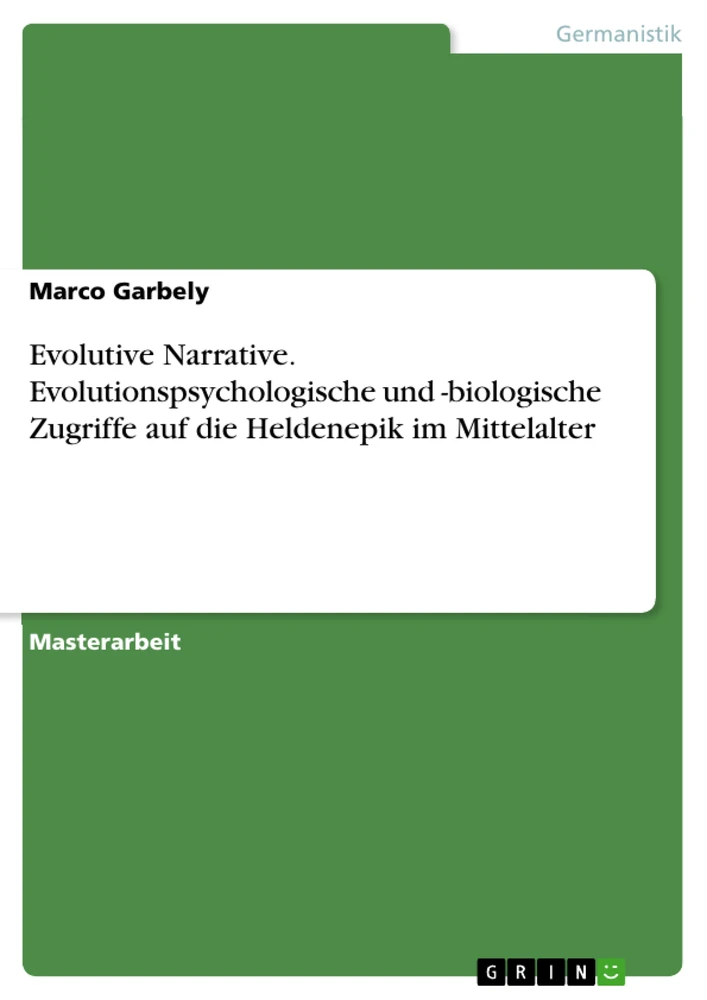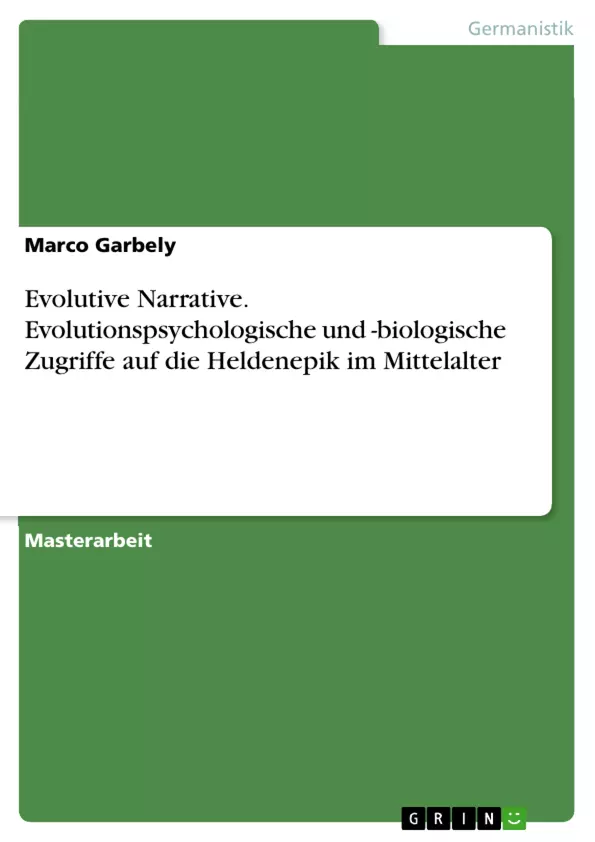"Evolutive Narrative" untersucht die Verbindung zwischen mittelalterlicher Heldenepik und evolutionspsychologischen Prinzipien. Die naturwissenschaftlich motivierte Analyse zeigt, wie narrative Heldentexte des Mittelalters tief in evolutionären Mechanismen verwurzelt sind und wie diese Geschichten grundlegende und früheste menschliche Verhaltensmuster – und damit fundamentale Themen der Phylogenese – widerspiegeln.
Ausgehend von der Annahme, dass literarische Inhalte nicht unabhängig von evolutionspsychologischen und -biologischen Einflüssen betrachtet werden können, bietet die Untersuchung eine interdisziplinäre Analyse bekannter mittelhoch- und frühneuhochdeutscher Heldenepen, darunter das "Rolandslied", das "Nibelungenlied", der "Alexanderroman", "Otnit" und "Wolf Dietrich".
Dabei werden u. a. folgende Fragen beantwortet: Wie werden im «Rolandslied» xenophobisch motivierte Erzählstrukturen aus evolutionärer Perspektive dargestellt? Wie gestaltet sich die Emotionsdramaturgie Karls und Rolands? Welche Partnerselektionsstrategien verfolgen die Figuren Kriemhild und Brünhild? Welche evolutionären Schönheitsideale werden im "Alexanderroman" thematisiert? Welche biologischen Funktionen erfüllen familiäre Konflikte und Inzestthemen in "Otnit" und "Wolf Dietrich"?
Die Ergebnisse zeigen, dass mittelalterliche Heldenepen ihre bis heute anhaltende breite Rezeption durch die Nutzung evolutionär verankerter Topoi erreicht haben, einem evolutionär kohärenten Narrativ stellenweise jedoch zuwiderlaufen: Biologische Realität und poetische Imaginationen beginnen zu interferieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 Einführung in das Forschungsprogramm der evolutionären Literaturwissenschaft
- 1.2 Mittelalterliche Heldenepik in evolutionärer Perspektive
- 1.3 Forschungsfragen, -stand und Zielsetzung
- 2 POETIK DER SOZIALITÄT IM <ROLANDSLIED>
- 2.1 sîn lant, daz was fraissam, daz liut, daz ist grimme: Xenophobisch motivierte Ingroup- und Outgroup-Konstruktionen
- 2.2 wie grôze in got lônet, mîn trechtîn, die brüederlîchen mit ain ander sîn!: Verwandtschaftspräferenz und familiale Argumentationsfiguren
- 2.3 Der keiser zurnte harte. mit gestreichtem barte: Moderne kaiserliche und kämpferische Emotionsdramaturgien
- 2.4 dîn muoter ist mîn wîb. mîn sun Baldewîn scholde din bruoder sîn: Evolutionäre Störfälle im Spannungsfeld zwischen evolutionärer Logik und christlicher Heilsgeschichte
- 3 SEXUELLE SELEKTION UND STATUS IM <NIBELUNGENLIED>
- 3.1 vil manigen puneiz rîchen man vor den juncvrouwen vant: Räume der intra- und intersexuellen Selektion im Turnier und Krieg
- 3.2 swer ir minne gerte, der muose âne wanc driu spil angewinnen: Genderrelativ divergierende Partnerselektionsstrategien
- 3.3 Kriemhilt niht langer lie, vor des kuniges wîbe inz münster si dô gie: Status als identitätsstiftendes Universalkonzept
- 3.4 dô hiez si ir bruoder nemen sînen vil schoenen lîp: Zufall und Schicksal, biologische Logik und evolutionäre Störmomente
- 4 EXKURS: EVOLUTIONÄRE ÄSTHETIK IM ‹STRASSBURGER ALEXANDER›
- 4.1 Sus lussame sache is al der werlt unkunt: Ästhetisierung durch die Gestaltung anthropophiler Landschaftsstrukturen
- 4.2 Ih ne sach nie von wîbe scôner antluzze mê, noh ougen also wol stê: Erotisierte Koppelung natürlich-urwüchsiger mit weiblicher Schönheit
- 5 PROBLEME DER GENETIK UND GENEALOGIE IM ‹OTNIT› UND ‹WOLF DIETRICH›
- 5.1 wenn im die muoter stirbet, so will er die tochter nemen: Inzest als Störfaktor und organisierendes Motiv zugleich
- 5.2 ir sagt mir wer ich selber und mein geschlächte sei: Gestörte genealogische Strukturen
- 5.3 wo namest du das kindelein, du namests von dem teufel!: Vaterschaftsunsicherheit als evolutionäres Narrativ
- 6 SYNTHESE: ERGEBNISSE DER FALLSTUDIEN UND FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Heldenepik des Mittelalters aus evolutionspsychologischer und -biologischer Perspektive. Ziel ist es, die literarischen Werke anhand evolutionärer Konzepte zu analysieren und mögliche Zusammenhänge zwischen literarischen Motiven und menschlichen Verhaltensmustern aufzuzeigen. Die Arbeit erforscht, wie evolutionäre Prinzipien wie soziale Selektion, sexuelle Selektion und Verwandtschaftsselektion in den Texten manifest werden.
- Evolutionäre Literaturwissenschaft und ihre Anwendung auf mittelalterliche Texte
- Soziale Strukturen und Konflikte in der mittelalterlichen Heldenepik im Lichte der Evolutionspsychologie
- Rollen von Geschlecht und Status in der Partnerwahl und Sozialdynamik
- Einfluss evolutionärer Prinzipien auf narrative Strukturen und ästhetische Gestaltung
- Analyse von Inzest und genealogischen Problemen aus evolutionärer Sicht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Forschungsprogramm der evolutionären Literaturwissenschaft ein und erläutert die Anwendung evolutionspsychologischer und -biologischer Konzepte auf die mittelalterliche Heldenepik. Sie definiert die Forschungsfragen und die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die Heldenepen im Kontext der menschlichen Evolution zu untersuchen und die evolutionären Wurzeln literarischer Motive aufzudecken. Die Arbeit setzt sich mit der Debatte auseinander, ob und wie ein naturwissenschaftlicher Ansatz mit geisteswissenschaftlichen Methoden kombiniert werden kann, um ein umfassenderes Verständnis literarischer Werke zu erlangen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Betrachtung der Heldenepen als Ausdruck menschlicher Verhaltensmuster, die durch evolutionäre Prozesse geformt wurden.
2 Poetik der Sozialität im <Rolandlied>: Dieses Kapitel analysiert das <Rolandlied> anhand von evolutionspsychologischen Konzepten wie Ingroup- und Outgroup-Dynamiken, Verwandtschaftsselektion und Emotionsregulation. Die Analyse untersucht, wie die Darstellung von Konflikten, Loyalität und sozialem Verhalten im Epos mit evolutionären Prinzipien zusammenhängt und welche Rolle die evolutionär bedingten Verhaltensweisen für das Verständnis der Erzählung spielen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie soziale Strukturen und Konfliktsituationen in der Darstellung der Textes evolutionär motiviert sein können und welche Bedeutung diese für die literarische Gestaltung haben.
3 Sexuelle Selektion und Status im <Nibelungenlied>: Dieses Kapitel wendet die Konzepte der sexuellen Selektion und des Status auf das <Nibelungenlied> an. Es analysiert, wie die Darstellung von Beziehungen, Konkurrenz und Macht im Epos mit evolutionären Prinzipien der Partnerwahl und Statusfindung in Verbindung steht. Es werden die Strategien der Partnerwahl, sowohl männlicher als auch weiblicher Figuren, im Kontext der evolutionären Psychologie untersucht. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung von Status und Macht als Faktoren im sozialen und romantischen Wettbewerb und ihre Auswirkungen auf das narrative Geschehen und die Charaktere.
4 Exkurs: Evolutionäre Ästhetik im ‹Strassburger Alexander›: Dieses Kapitel betrachtet die evolutionäre Ästhetik anhand des ‹Strassburger Alexander›. Die Analyse untersucht, wie die Darstellung von Landschaften und Frauenbildern im Epos mit evolutionär bedingten ästhetischen Präferenzen und die anthropophilen Landschaftsstrukturen korrelieren. Die erotische Komponente der Darstellung weiblicher Schönheit wird dabei im Zusammenhang mit evolutionären Mechanismen interpretiert. Der Fokus liegt darauf, wie die ästhetische Gestaltung des Textes mit evolutionären Prinzipien verbunden ist und welche Rolle die Evolution bei der Gestaltung und Wahrnehmung der Schönheit spielt.
5 Probleme der Genetik und Genealogie im ‹Otnit› und ‹Wolf Dietrich›: Dieses Kapitel untersucht die Themen Inzest, genealogische Strukturen und Vaterschaftsunsicherheit in den Epen ‹Otnit› und ‹Wolf Dietrich›, unter der Lupe evolutionspsychologischer Perspektiven. Die Analyse befasst sich mit den Motiven von Inzest als Störfaktor und zugleich als organisierendes Element der Erzählung, den gestörten genealogischen Strukturen und der evolutionären Bedeutung der Vaterschaftsunsicherheit. Der Fokus liegt darauf, wie diese Themen im Lichte der Evolutionspsychologie interpretiert und verstanden werden können, und welche Rolle sie im Gesamtkontext der Epen spielen.
Schlüsselwörter
Evolutionäre Literaturwissenschaft, Evolutionspsychologie, Heldenepik, Mittelalter, <Rolandlied>, <Nibelungenlied>, ‹Strassburger Alexander›, ‹Otnit›, ‹Wolf Dietrich›, Soziale Selektion, Sexuelle Selektion, Verwandtschaftsselektion, Status, Partnerwahl, Inzest, Genealogie, Ästhetik, Narrative Strukturen.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Evolutionäre Ansätze in der mittelalterlichen Heldenepik
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Heldenepik des Mittelalters (insbesondere das Rolandlied, das Nibelungenlied, den Strassburger Alexander, Otnit und Wolf Dietrich) aus evolutionspsychologischer und -biologischer Perspektive. Ziel ist die Analyse literarischer Werke anhand evolutionärer Konzepte und die Aufdeckung möglicher Zusammenhänge zwischen literarischen Motiven und menschlichen Verhaltensmustern.
Welche evolutionären Prinzipien werden untersucht?
Die Arbeit erforscht die Manifestation evolutionärer Prinzipien wie soziale Selektion, sexuelle Selektion und Verwandtschaftsselektion in den untersuchten Texten. Es wird untersucht, wie diese Prinzipien die Handlung, die Charaktere und die narrative Struktur beeinflussen.
Welche konkreten Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung führt in die evolutionäre Literaturwissenschaft und die Forschungsfragen ein. Es folgen Kapitel zur Analyse des Rolandlieds (Sozialität, Ingroup/Outgroup-Dynamiken, Verwandtschaftsselektion), des Nibelungenlieds (sexuelle Selektion, Status, Partnerwahl), des Strassburger Alexander (evolutionäre Ästhetik), und Otnit und Wolf Dietrich (Inzest, Genealogie, Vaterschaftsunsicherheit). Ein abschließendes Kapitel synthetisiert die Ergebnisse.
Wie wird die evolutionäre Perspektive auf die Texte angewendet?
Die Analyse verbindet geisteswissenschaftliche Methoden mit einem naturwissenschaftlichen Ansatz. Evolutionäre Konzepte dienen als Interpretationsrahmen, um literarische Motive und Handlungsstrukturen zu beleuchten und ein umfassenderes Verständnis der Texte zu ermöglichen. Es wird untersucht, inwieweit die dargestellten Verhaltensweisen und Konflikte mit evolutionär bedingten menschlichen Verhaltensmustern übereinstimmen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Evolutionäre Literaturwissenschaft, Evolutionspsychologie, Heldenepik, Mittelalter, Rolandlied, Nibelungenlied, Strassburger Alexander, Otnit, Wolf Dietrich, Soziale Selektion, Sexuelle Selektion, Verwandtschaftsselektion, Status, Partnerwahl, Inzest, Genealogie, Ästhetik, Narrative Strukturen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit synthetisiert die Ergebnisse der Fallstudien und zieht ein Fazit, welches die Bedeutung evolutionärer Prinzipien für das Verständnis der mittelalterlichen Heldenepik zusammenfasst. Es wird aufgezeigt, wie evolutionäre Konzepte zu einem vertieften Verständnis der literarischen Werke beitragen können.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler*innen und Studierende der Literaturwissenschaft, der Evolutionspsychologie und verwandter Disziplinen, die sich für die Anwendung evolutionärer Ansätze in den Geisteswissenschaften interessieren.
- Quote paper
- Marco Garbely (Author), 2020, Evolutive Narrative. Evolutionspsychologische und -biologische Zugriffe auf die Heldenepik im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1491483