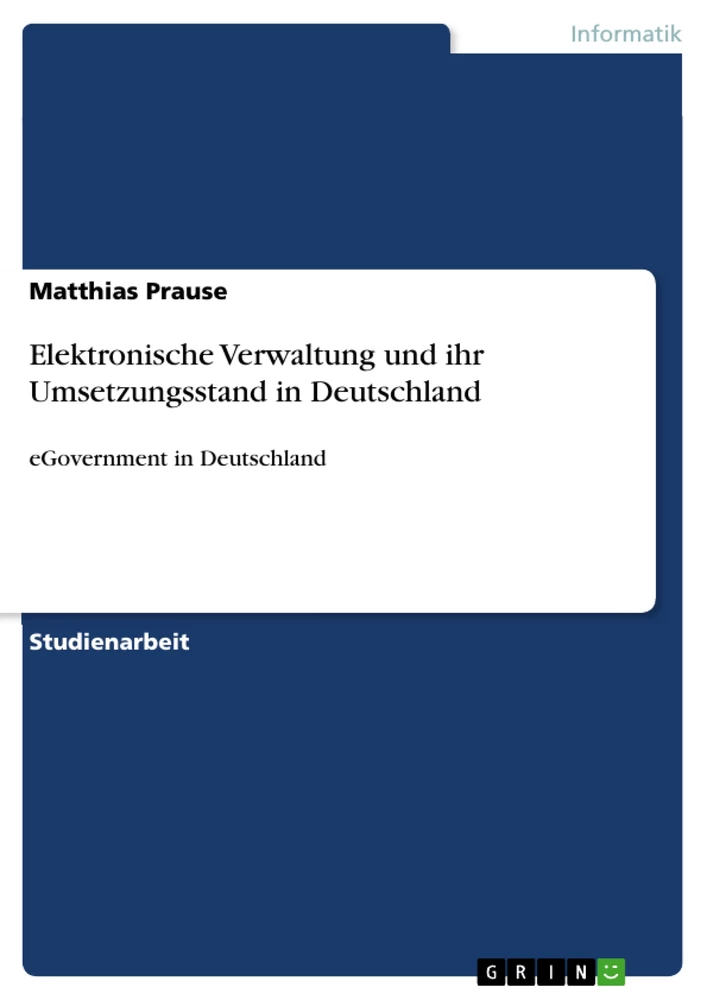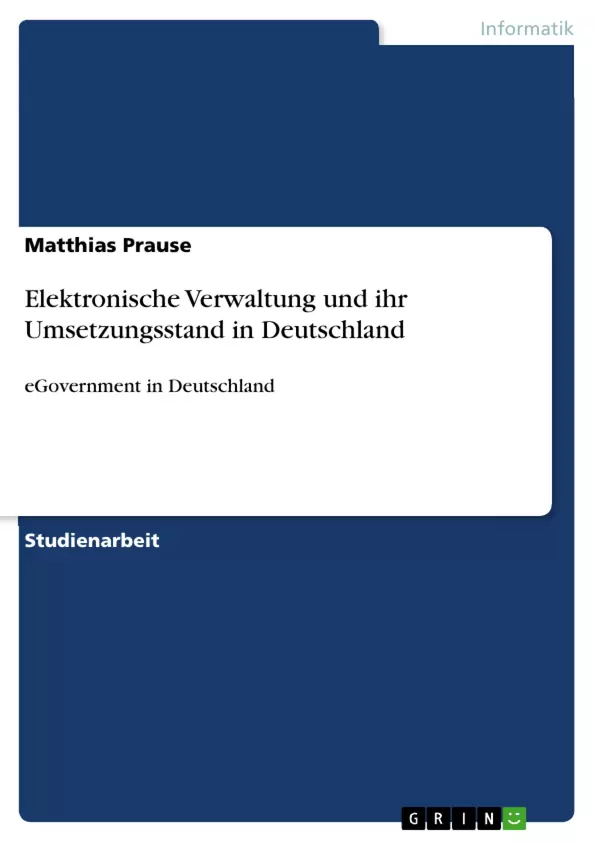Der Begriff der Elektronischen Verwaltung oder auch des Electronic Government (kurz: E-Government) „bezeichnet den Einsatz von Internet-Technologie durch staatliche Institutionen. Dies ermöglicht es der Verwaltung, mit anderen Verwaltungsorganisationen, privatwirtschaftlichen Unternehmen oder den Bürgern zu kommunizieren und Dienstleistungen abzuwickeln.“ So lautet eine von vielen Definitionsmöglichkeiten von E-Government, da sich bis heute weder in der Praxis noch in der Forschung auf eine einheitliche Definition geeinigt werden konnte.
Im Allgemeinen wird unter E-Government die Durchführung und Vereinfachung von Prozessen (Dienstleistungen) innerhalb der Verwaltung durch den Einsatz neuer Kommunikations- und Informationstechniken verstanden. Diese Prozesse basieren auf elektronischen Abläufen zwischen Verwaltung und Anwender, welche man als Transaktionen bezeichnet. Je nachdem, um welche Art Anwender es sich dabei konkret handelt, gibt es verschiedene Formen von E-Government. Diese werden in Kapitel 2.1 näher beschrieben.
Bei der Entwicklung des E-Government, die Mitte der Neunziger Jahre begann, ist die Transaktionsphase allerdings schon der dritte Schritt. Sie stellt aber die eigentliche Hürde dar, die es bei der Einführung von E-Government zu bewältigen gilt. Voraus gehen ihr die Informations- und die Kommunikationsphase. Diese beiden Phasen unterscheiden sich dahingehend von der Transaktionsphase, dass es keine interaktive Beziehung zwischen Anwender und Verwaltung gibt. Es werden lediglich statische Informationen über das Internet geliefert (Informationsphase) bzw. Dokumente zum Download angeboten (Kommunikationsphase).
In der Bundesrepublik Deutschland haben die Vorreiterprojekte, mit denen sich Kapitel 3 näher beschäftigt, teilweise die Transaktionsphase erreicht.
Doch die Entwicklung von E-Government soll keineswegs mit der Transaktionsphase abgeschlossen sein. Vielmehr soll ein völlig neues Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung entstehen, welches unter den Begriff E-Partizipation fällt.3 Darin nehmen die Bürger aktiv am politischen Entscheidungsprozess teil. Ein Beispiel hierfür wäre die öffentliche Diskussion über ein geplantes Gesetz auf der Internetseite einer Behörde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der elektronischen Verwaltung
- 2.1 Formen von E-Government
- 2.1.1 G2C (Government-to-Citizen)
- 2.1.2 G2B (Government-to-Business)
- 2.1.3 G2G (Government-to-Government)
- 2.2 Dienstleistungen im E-Government
- 2.2.1 Überblick
- 2.2.2 Dienstleistungstypen
- 2.2.3 Klassifizierungsmodell
- 2.2.3.1 Dimensionen
- 2.2.3.2 Erläuterung mittels Beispiel
- 2.3 Nutzen von E-Government
- 2.4 Hindernisse und auftauchende Probleme
- 2.1 Formen von E-Government
- 3. E-Government in Deutschland
- 3.1 Initiativen zum Forcieren von E-Government
- 3.1.1 BundOnline 2005
- 3.1.2 Deutschland-Online
- 3.2 Weitere Entwicklung
- 3.2.1 Aktuelle Situation
- 3.2.2 Ausblick
- 3.1 Initiativen zum Forcieren von E-Government
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Stand der elektronischen Verwaltung (E-Government) in Deutschland. Sie beleuchtet die Grundlagen von E-Government, verschiedene Formen der E-Government-Interaktion (G2C, G2B, G2G) und die damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Initiativen zur Förderung von E-Government in Deutschland analysiert und der aktuelle Entwicklungsstand bewertet.
- Definition und Formen von E-Government
- Dienstleistungen und Nutzen von E-Government
- Herausforderungen und Probleme bei der Implementierung von E-Government
- Analyse von E-Government-Initiativen in Deutschland (BundOnline 2005, Deutschland-Online)
- Der aktuelle Stand und zukünftige Perspektiven von E-Government in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des E-Government ein und definiert den Begriff. Sie betont die fehlende einheitliche Definition und skizziert die drei Phasen der E-Government-Entwicklung: Information, Kommunikation und Transaktion. Die Arbeit fokussiert auf den aktuellen Stand in Deutschland, insbesondere auf die erreichten Transaktionsphasen, und Ausblick auf die E-Partizipation.
2. Grundlagen der elektronischen Verwaltung: Dieses Kapitel legt die Basis für das Verständnis von E-Government. Es beschreibt detailliert die verschiedenen Formen der E-Government-Interaktion: G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business) und G2G (Government-to-Government). Für jede Form werden konkrete Beispiele genannt, wie z.B. die Reservierung von Wunschkennzeichen online oder die E-Vergabeplattform des Bundes. Es werden die jeweiligen Vorteile und Herausforderungen jeder Form beleuchtet und die Bedeutung der Optimierung von Verwaltungsabläufen im Kontext von G2G hervorgehoben.
3. E-Government in Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den deutschen Kontext. Es analysiert wichtige Initiativen wie BundOnline 2005 und Deutschland-Online, um die Bemühungen zur Förderung von E-Government aufzuzeigen. Die aktuelle Situation wird bewertet und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben. Der Fokus liegt auf der Erörterung der Herausforderungen und des Potentials für zukünftige Verbesserungen im deutschen E-Government-System.
Schlüsselwörter
E-Government, elektronische Verwaltung, G2C, G2B, G2G, BundOnline 2005, Deutschland-Online, Online-Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltungsabläufe, Optimierung, Herausforderungen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: E-Government in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema E-Government in Deutschland. Sie beinhaltet eine Einleitung, die Grundlagen der elektronischen Verwaltung, eine detaillierte Betrachtung der verschiedenen Formen der E-Government-Interaktion (G2C, G2B, G2G) und der damit verbundenen Dienstleistungen. Zusätzlich analysiert sie Initiativen zur Förderung von E-Government in Deutschland, bewertet den aktuellen Entwicklungsstand und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Die Arbeit bietet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Formen der E-Government-Interaktion werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die drei Hauptformen der E-Government-Interaktion: G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business) und G2G (Government-to-Government). Für jede Form werden konkrete Beispiele und die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert.
Welche deutschen E-Government-Initiativen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Initiativen "BundOnline 2005" und "Deutschland-Online", um die Bemühungen zur Förderung von E-Government in Deutschland aufzuzeigen.
Welche Aspekte des E-Governments werden im Detail untersucht?
Die Hausarbeit untersucht detailliert folgende Aspekte: Definition und Formen von E-Government, Dienstleistungen und Nutzen von E-Government, Herausforderungen und Probleme bei der Implementierung, Analyse der genannten deutschen Initiativen, den aktuellen Stand und zukünftige Perspektiven von E-Government in Deutschland.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: E-Government, elektronische Verwaltung, G2C, G2B, G2G, BundOnline 2005, Deutschland-Online, Online-Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Verwaltungsabläufe, Optimierung, Herausforderungen, Deutschland.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen der elektronischen Verwaltung und E-Government in Deutschland. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel, die die verschiedenen Aspekte des Themas detailliert behandeln. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Navigation.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, den Stand des E-Governments in Deutschland zu untersuchen und die verschiedenen Facetten dieses komplexen Themas zu beleuchten. Sie soll ein umfassendes Verständnis der Grundlagen, Herausforderungen und zukünftigen Entwicklungen vermitteln.
Für welche Zielgruppe ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema E-Government in Deutschland auseinandersetzen möchten. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der Thematik.
- Arbeit zitieren
- Matthias Prause (Autor:in), 2006, Elektronische Verwaltung und ihr Umsetzungsstand in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149216