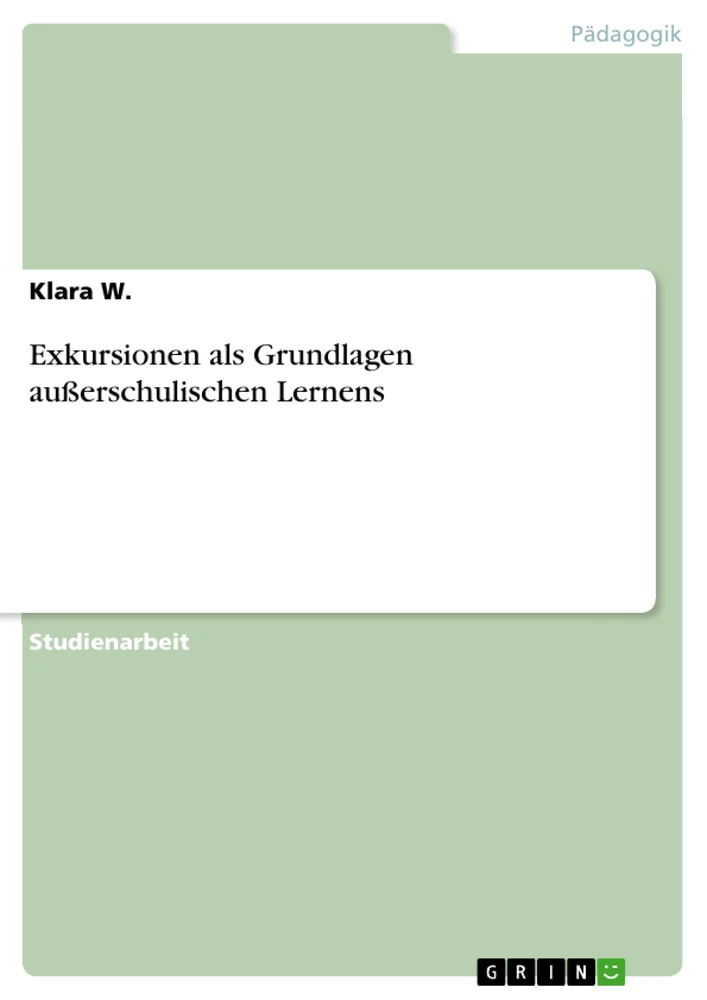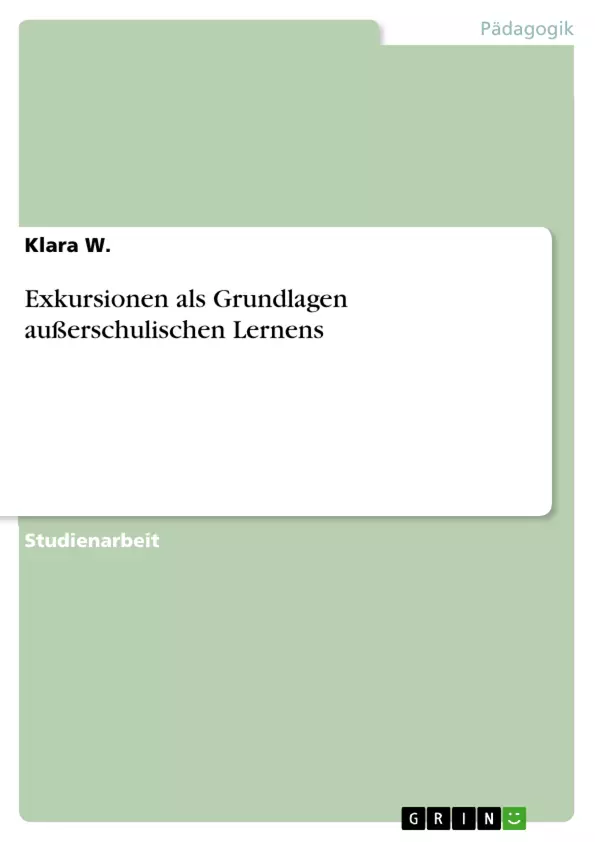Im folgenden Bericht werden zwei Exkursionen, welche im Rahmen der Regionalen Erkundungen des Studienganges Sachunterricht durchgeführt wurden, kritisch und wissenschaftsgestützt reflektiert. Dabei wird untersucht, ob die Exkursion und der damit verbundene Lernort für den Sachunterricht geeignet ist. Bereits im Lehrplan ist dargestellt, dass die Bildung im Fach Sachunterricht neben dem Unterricht in der Schule auch an außerschulischen Lernorten geschehen kann. Als außerschulischen Lernort wird hierbei prinzipiell alles verstanden, was schulgebunden als Lernen initiiert und an einem außerhalb des Schulgeländes befindenden Ort, stattfindet. Die Grundfrage, die man sich daher bei den Exkursionen stellen muss, ist, ob dieser Ort für das schulgebundene Lernen geeignet ist und somit Bildung an diesem Ort, unter Voraussetzung eines vorbereiteten pädagogisch-didaktischen Konzeptes, möglich ist. Diese Frage eindeutig zu beantworten, ist durch die vielen uneinheitlichen Definitionen von Bildung, schwer möglich. Daher orientiere ich mich im Folgenden an die Ansprüche des Perspektivrahmens: Perspektivrahmen Sachunterricht, sowie den drei Elementen grundlegender Bildung nach Glöckel. Die drei Elemente grundlegender Bildung sind demnach: aus der Lebenswelt der Kinder, fachliche Relevanz und überdauernde Bedeutung. Zudem stelle ich den Lernzuwachs bzw. die Bildungsmöglichkeit dem Organisations-, Zeit- und Geldaufwand gegenüber
Einleitung
Im folgenden Bericht werde ich zwei Exkursionen, welche ich im Rahmen der Regionalen Erkundungen des Studienganges Sachunterricht durchgeführt habe, kritisch und wissenschaftsgestützt reflektieren. Dabei untersuche ich, ob die Exkursion und der damit verbundene Lernort für den Sachunterricht geeignet ist. Bereits im Lehrplan ist dargestellt, dass die Bildung im Fach Sachunterricht neben dem Unterricht in der Schule auch an außerschulischen Lernorten geschehen kann (vgl. Lehrplan 2020).
Als außerschulischen Lernort wird hierbei prinzipiell alles verstanden, was schulgebunden als Lernen initiiert und an einem außerhalb des Schulgeländes befindenden Ort, stattfindet (vgl. Studtmann 2017, S. 16 f.).
Die Grundfrage, die man sich daher bei den Exkursionen stellen muss ist, ob dieser Ort für das schulgebundene Lernen geeignet ist und somit Bildung an diesem Ort, unter Voraussetzung eines vorbereiteten pädagogisch-didaktischen Konzeptes (vgl. Baar / Schönknecht 2018, S. 18), möglich ist. Diese Frage eindeutig zu beantworten, ist durch die vielen uneinheitlichen Definitionen von Bildung, schwer möglich. Daher orientiere ich mich im Folgenden an die Ansprüche des Perspektivrahmens (vgl. GDSU (2013): Perspektivrahmen Sachunterricht), sowie den drei Elementen grundlegender Bildung nach Glöckel (vgl. Thomas 2018: 37). Die drei Elemente grundlegender Bildung sind demnach: aus der Lebenswelt der Kinder, fachliche Relevanz und überdauernde Bedeutung. Zudem stelle ich den Lernzuwachs bzw. die Bildungsmöglichkeit dem Organisations-, Zeit- und Geldaufwand gegenüber (vgl. Dühlmeier 2014, S. 31).
1. Exkursion
Meine erste Exkursion ging am 08.12.2021 in das Deutsche Fussballmuseum nach Dortmund (vgl. DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH, Ausstellung).
Der thematische Schwerpunkt dieser Exkursion lag auf der historischen Perspektive des Sachunterrichts (vgl. GDSU (2013): Perspektivrahmen Sachunterricht). Nach dem neuen Definitionsvorschlags des Internationalen Museumsrats handelt es sich bei einem Museum um einen ständigen, öffentlichen Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte, in welchem u.a. Bildung ermöglicht wird (vgl. ICOM (1 .Juni 2022)). Diese mögliche Bildung werde ich im Folgenden kritisch untersuchen.
Das Museum ist durch die zentrale Lage direkt am Hauptbahnhof sehr gut erreichbar. Dadurch ist eine Anreise für Schulen in Dortmund, aber auch aus anderen Städten, mit geringen Aufwand möglich ist. Das Museum ist der Kategorie einer Geschichtskultur einzuordnen, welche die Auseinandersetzung mit dem deutschen Fußball, seiner Geschichte und die damit verbundene Kultur, anregen soll. Geschichtskultur meint die Gesamtheit aller Präsentationen und Verarbeitung von Geschichte, die uns gegenwärtig umgeben (in Anlehnung an Pandel). Geschichtskultur sollte dabei stets hinterfragt werden, da diese individuelle Motive verfolgt und das Museum die Darstellung von der Geschichte in der Gegenwart maßgeblich beeinflusst. Dabei sollte immer auch die Standortwahl, hier vorliegend Dortmund, hinterfragt werden. Warum wurde Dortmund als Standort ausgewählt und nicht z.B. Gelsenkirchen? Welche Motive verfolgt Dortmund mit dem Museum? Auf solche Fragen wird es nicht nur eine Antwort geben, jedoch ist es wichtig, dass die Lehrkraft das kritische Hinterfragen von Geschichtskultur bei den Schülerinnen anregt. So kann den Schülerinnen bewusst werden, dass Geschichtskultur selten nur geschichtliche und bildende Ziele verfolgt, sondern auch z.B. soziologische und ökonomische Ziele (vgl. Dimensionen von Geschichtskultur nach Pandel). Daher ist es für den vorliegenden Ort wichtig, dass die Lehrkraft sich bereits vorher über den Ort und die damit verbunden Entstehungsgeschichte informiert.
Der Aufbau des Museums ist sehr bewusst gewählt, da es den Ablauf eines Fußballspieles widerspiegelt. Dies wurde zum Bespiel dadurch sichtbar, dass man die Ausstellung über einen „Tunnel“ erreicht, welcher dem Tunnel im Stadion gleicht. Das Raumkonzept stellt dadurch einen direkten Bezug zur Thematik des Museums her, wodurch man mit dem Eintritt in die Ausstellung mühelos in die Fußballwelt eintauchen kann. Die Exkursion war in Form einer Führung durchgeführt worden, bei welcher immer wieder an einzelnen ausgewählten Stationen angehalten wurde und genaueres berichtet wurde. Das Museum beinhaltet auffällig viele Soundeffekte und Bilder. Durch die Musik erzeugt das Museum diverse Emotionen. Zudem befinden sich im Museum vielzählige Exponate, die die dargelegten Fakten greifbar machen und stützen. Eines der Highlights des Museums ist der Raum der Goldenen Generation, hier kann die Weltmeisterschaft 2014 auf einer 360 Grad Leinwand, in Form eines Fußballes, bestaunt werden sowie die Schatzkammer mit den Pokalen.
Fraglich ist nun aber, in wie weit die dargestellte deutsche Fussballgeschichte für die Schülerinnen des Sachunterrichts relevant ist. Zudem ist zu prüfen, ob das Deutsche Fußballmuseum ein Konzept verfolgt, welches Bildung, vor allem im Bezug auf Grundschulkinder möglich macht. Zunächst einmal untersuche ich die fachliche Relevanz. Thematisch geht es hier um die Geschichte des deutschen Fußballs. Laut Lehrplan geht es im Sachunterricht hinsichtlich der historischen Perspektive um den Bereich Zeit und Wandel (vgl. Landesinstitut für Schule, Bereiche, Inhalte und Kompetenzerwartungen (2021)). Hierbei liegt der Fokus nicht auf spezifische historische Ereignisse, mit denen die Schülerinnen in der Grundschule konfrontiert werden sollen, sondern es geht vielmehr um die grundsätzlichen Kompetenzen, die in der Auseinandersetzung mit Vergangenem entwickelt werden sollen. Demnach gibt es auch für die Geschichte des deutschen Fußballs eine fachliche Relevanz für den Sachunterricht. Am Beispiel Fußball kann z.B. das Wunder von Bern thematisiert werden. Hier kann zum Einem der erste Weltmeistertitel bewundert werden und zum Anderen, im Sinne des Sachunterrichts, die historischen Rahmenbedingungen erörtert werden. Hierbei könnten die Schülerinnen z.B. Vermutungen aufstellen, warum der Sieg „das Wunder von Bern“ genannt wird. Es kann darüber spekuliert werden, welche Auswirkungen dieser Sieg nicht nur für den Fußball hatte, sondern auch für das Land. Das Deutsche Fußballmuseum bietet durch die Vielfalt der Stationen gute Möglichkeiten besonders spezifische Themen, die für die jeweilige Altersgruppe relevant und greifbar sind, auszuwählen. Hierdurch lässt sich auch die Lebenswelt der Kinder gut integrieren. Als Lehrkraft muss daher im Vorfeld ermittelt werden, ob es gerade besonders präsente Themen in der Lebenswelt der Kinder gibt, die vielleicht mit dem Museumsbesuch aufgegriffen werden könnten. Hier wäre z.B die aktuellen Diskussionen um die gleiche Bezahlung der Frauen im Fußball relevant oder allgemein, um auch junge Schülerinnen einzubeziehen, grundsätzlich die Vorurteile, dass Fußball einer Männersport sei. Eine weitere, gut geeignete Station für die Bearbeitung mit Schülerinnen der Grundschule stellt die Station mit dem Fernseher dar. Jedes Schulkind hat tagtäglich mit der Medienwelt zu tun und die meisten Schulen sind mittlerweile mit digitalen Tafeln ausgestattet. In der Station im Museum steht jedoch lediglich ein kleiner Röhrenfernseher. Die Kinder können sich hier Vorort hineinversetzen, wie „primitiv“ die früheren Möglichkeiten waren, Fußball gemeinsam zuschauen. Hieran kann dann thematisch mit den Schülerinnen erkundet werden, wie sehr die Technik einem Wandel unterliegt und wie dies auch die damalige Lebenswelt und demnach auch die heutige maßgeblich beeinflusst und prägt. Die Kinder könnten davon erzählen, was sie nach der Schule machen und in wieweit sich dies unterscheiden würde, wenn es all diese Technik nicht geben würde. Die Kindern könnten somit ihre eigene Lebenswelt mit der Vergangenheit abgleichen. Vielleicht finden sie sogar auch Nachteile der heutigen Medien? Zuletzt stellt sich die Frage, der überdauernden Bedeutung. Das Museum stellt hierbei einen Grundstein für die Auseinandersetzung mit vielen fachlichen und vor allem auch aktuellen Themen. So können dabei auch Themen wie z.b. das Frauenbild besprochen werden kann, ein Thema, welches auch in Zukunft noch von großer Bedeutung sein wird. Ein weiteres, in Deutschland stets präsentes, und auch in Zukunft bestehendes Thema stellt der Nationalstolz dar, welcher aufgrund der Historik kaum, außer zur Ereignisse des Sportes, sichtbar gezeigt wird. Das Museum schafft durch die Verknüpfung mit dem Thema Fußball, den vielen Soundeffekten und Bildern, zusätzlich, dass Schülerinnen grundsätzlich für den Besuch eines Museums begeistert werden. Dadurch könnte langfristig bei den Schülerinnen ein sehr wichtiger Grundstein für das Interesse an Bildung gelegt werden.
Ingesamt sehe ich, unter Berücksichtigung der drei Elemente der grundlegenden Bildung nach Glöckel, das Museum der Deutschen Fußballgeschichte als einen geeigneten außerschulischen Lernort im Sachunterricht.
Fußball ist ein aktuelles Phänomen, mit einer vielschichtigen Geschichte. Das Thema Fußball sehe ich hierbei jedoch nicht als Schwerpunkt der Bildung, sondern eher als einen roten Pfaden, welcher es möglich macht, viele aktuelle Themen am Beispiel Fußball im Wandel der Zeit zu untersuchen. Dadurch wird den Schülerinnen der Begriff „Wandel“ greifbar und es ermöglich ihnen, ein erstes historisches Interesse und Bewusstsein aufzubauen. Somit schafft dieser Lernort neben der historischen Perspektive auch eine perspektivübergreifende Bildung, wodurch auch die übergeordneten Ziele des Sachunterrichts angesprochen werden (vgl. Lehrplan Sachunterricht (2021), S.179-180).
Unterstützung bietet das Museum den Schulen mit dem didaktisch-konzipierten Projekttag zum Thema Homophobie und Vielfalt, an welchem Schulklassen kostenlos teilnahmen können (vgl. DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH, Homepage: Schule im Museum). Als unterstützendes Material benutzt das Museum Boxen mit unterschiedlichen Gegenständen, mit denen sich die Kinder selbstständig auseinander setzen können und anhand derer Themen besprochen werden. Bei den Projekttagen ist jedoch zu beachten, dass die Lehrkraft dieses im Vorfeld didaktisch überprüfen und gegebenenfalls Änderungen erwägen kann.
Abschließend lässt sich somit sagen, dass das Deutsche Fußballmuseum einen außerschulischen Lernort darstellt und auch in Abwägung zum geringen Aufwand, dem kostenlosen, didaktisch-konzipierten Projekttag sowie der gut erreichbaren Lage des Museums, für eine Exkursion mit einer Grundschulklasse geeignet ist.
2. Exkursion
Meine zweite Exkursion fand am 07.07.2022 statt. Für diese Exkursion ging es ca. eine Stunde mit der Bahn von Dortmund nach Düsseldorf in die Dauerausstellung „Düsseldorfer Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus“. Durch lediglich einem Umstieg am Hauptbahnhof ist die Anreise aus Dortmund nicht sehr komplex, jedoch sollte die Reisedauer, gerade mit jungen Schulklassen, gut überlegt werden und im Verhältnis zum Bildungsgewinn der Exkursion stehen. Diesen Bildungsgewinn werde ich im Folgenden untersuchen und bewerten.
Die Ausstellung ist kein reines Museum, sondern eine Mahn- und Gedenkstätte. Demnach liegt der Fokus hier auf das Gedenken der Opfer, sowie das Mahnen an die Besucherinnen, dass sich die hier dargestellte Geschichte nicht wiederholen sollte (vgl. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas: Erinnerungsorte - Definitionen). Zusätzlich liegt die Mahn- und Gedenkstätte an einem Ort mit direktem historischen Bezug zum Nationalsozialismus. An diesem Ort befand sich zur Zeit des Nationalsozialismus das Polizeipräsidium (vgl. Landeshauptstadt Düsseldorf, Die Geschichte des Hauses Mühlenstraße 29).
Der Schwerpunkt dieser Exkursion lag in der sozialwissenschaftlichen Perspektive des Sachunterrichtes. Laut Lehrplan steht die Demokratie und die Gesellschaft in der sozialwissenschaftliche Perspektive im Mittelpunkt (vgl. Lehrplan 2021). Hierbei sollen sich die Schülerinnen mit der Vielfalt der Gesellschaft, den verschiedenen Meinungen sowie den Lebensumständen der Menschen und der Demokratiebildung auseinandersetzen. Die Mahn- und Gedenkstätte erscheint hierbei auf dem ersten Blick eher auf die Historie und damit auf die historische Perspektive gerichtet zu sein. Daher werde ich im Folgenden den Ort hinsichtlich der Bildungsmöglichkeit im Bereich der sozialwissenschaftlichen Perspektive, unter Berücksichtigung der drei Elemente grundlegender Bildung nach Glöckel (vgl. Thomas 2018: 37), kritisch reflektieren.
Das Museum erstreckt sich über vier Räumlichkeiten, sowie dem Highlight, der original erhaltenden Luftschutzbunker. Letzteres ermöglicht den Schülerinnen einen direkten und unverfälschten Einblick in die damalige Situation und stellt den Abschluss des Besuches dar. Der Bunker wird nur nach vorheriger Absprache mit der Lehrkraft besucht, da z.B. Schülerinnen mit eigenen Fluchterfahrungen nicht unbedingt den Bunker betreten sollten.
Die Exkursion begann in einem Raum mit diversen Säulen, auf welcher verschiedenen Kinder und Jugendliche samt deren Biographien abgebildet sind. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass alle dargestellten Informationen auf eine Vielzahl von Quellen zurückzuführen sind, welche im hauseigenen Archiv aufbewahrt und ständig, durch z.B. Interviews von Zeitzeugen, erweitertet werden. Jede Säule erzählt die individuelle Sicht eines Kindes oder Jugendlichen aus der Zeit des Nationalsozialismus in Düsseldorf. Wie das Museum selbst sagt, wurde hier versucht, die Vielfalt der damalige Gesellschaft abzubilden und nicht nur die Stereotypen (vgl. Landeshauptstadt Düsseldorf, Mahn- und Gedenkstätte: Die Ausstellung). Alle Säulen sind hierbei individuell mit eigenen Bildern, Zitaten und originalen Quellen gestaltet. Die Gemeinsamkeit, bei allen dargestellten Personen besteht in deren festen individuell verfolgten Motiven und Überzeugungen, welche sie zu ihrer damaligen Haltung für oder gegen die Regierung beweget hat. Der Fokus liegt darauf, die Haltungen und Handlungen greifbar und verstehbar zu machen. Da die Säulen sehr viel Text beinhalten, hat das Museum für die Arbeit mit Schulklassen sogenannte „Memory-Boxen“ erstellt. Mit Hilfe dieser Boxen, welche jeweils zur dargestellten Person passende Gegenstände enthält, können Schülerinnen versuchen die Profile und ihrer Merkmale zu erschließen. Als Beispiel für einen Gegenstand wäre die Bibel zu nennen. Der zugehörige Junge hatte sich damals nicht der Regierung unterworfen, weil er einzig und allein dem Glauben unterworfen sein wollte. Die Schülerinnen können bei der Bibel selbst Vermutungen anstellen, was der Gegenstand mit der Person und mit der daraus resultierenden Haltung zu tun hatte. Dabei werden die Kindern angeregt, Quellen zu interpretieren und dadurch Informationen selbst zu rekonstruieren und sich zu erschließen, (vgl. GDSU (2013): Perspektivrahmen Sachunterricht, DAH: historische Perspektive) Grundsätzlich stellt das Thema Nationalsozialismus ein sehr sensibles Thema dar und sollte daher gerade bei Grundschulkindern gut überlegt sein. Doch das Museum hat genau deswegen sein Konzept so ausgelegt, dass sich auch jüngerer Schülerinnen mit diesem Thema auseinandersetzen können. Es geht dabei primär darum, dass die Kindern lernen, Handlungen zu hinterfragen, und z.B. nicht darum, welche Folgen z.B. der gläubige Junge durch den Widerstand zu befürchten hatte. Gleichzeitig kann gerade durch eine solche Vergangenheit den Schülerinnen verdeutlich werden, dass das heutige Deutschland und die damit verbundene Demokratie nicht immer Bestand hatte und daher auch nicht selbstverständlich ist. Die Kinder können hierbei auf das Privileg der freien Meinung in Deutschland hingewiesen werden.
Für Schulklassen bietet die Mahn- und Gedenkstätte Führungen, bei welchen die thematischen Schwerpunkte vorher mit der Lehrkraft abgesprochen werden. Dabei können besonders die aktuellen und präsenten Themen der jeweiligen Klasse berücksichtigt werden. Als Beispiel kann das Thema Flucht genannt werden. Dies war damals und ist auch heute sehr aktuell. Hierzu gibt es in der Mahn- und Gedenkstätte eine entsprechende Station, an welcher ein damaliger Fluchtweg rekonstruiert wird. Gerade der aktuelle Ukraine-Konflikt verdeutlicht die Prägnanz dieser Thematik.
Zusammenfassend ergibt sich somit die fachliche Relevanz hinsichtlich der sozialwissenschaftlichen Perspektive in der Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Menschen und den damit verbunden Meinungen. Letzteres stellt auch heute eines der Hauptprivilegien der Demokratie dar. Der Lebensweltbezug kann durch die individuellen Schwerpunktsetzung bei der Exkursion durch die Klasse festgelegt und gesichert werden. Zudem lässt sich gerade für Düsseldorfer Schulen hervorheben, dass bewusst die Kinder und Jugendlichen aus Düsseldorf dargestellt sind und somit ein direkter Ortsbezug hergestellt werden kann. Dies macht nochmal bewusst, dass die Ereignisse zeitlich gesehen weit weg sind, jedoch räumlich dort stattfanden, wo die Schülerinnen heute leben. Die überdauernde Bedeutung liegt allein dadurch vor, dass sich bis heute Auswirkungen aus der Zeit des Nationalsozialismus wiederfinden lassen. Dies beginnt mit dem Thema, warum man überall in Deutschland Stolpersteine als Andenken an die Juden finden kann oder warum der Hitlergruß verboten ist. Letzteres ist als eigene Thematik in der Mahnstätte aufgegriffen, damit die Kindern sensibilisiert werden, was an dieser Geste nicht ok ist. Neben der sozialwissenschaftlichen Perspektive schafft der Ort viele perspektivübergreifende Bildungsmöglichkeiten. Die historische Perspektive kann durch die grundsätzliche Thematik des Nationalsozialismus sowie durch die Meomory-Boxen angesprochen werden. Jedoch legt die Mahn- und Gedenkstätte selbst Wert darauf, dass der Fokus nicht auf die historischen Fakten oder die Chronologie der Ereignisse liegt, sondern auf das Schaffen eines Bewusstseins für die damalige Zeit.
Ingesamt bietet die Mahn- und Gedenkstätte ein großes Angebot für die Arbeit mit jungen Schülerinnen. Zum Einen sind bewusst nicht zu harte Bilder abgebildet und die Biographien von jungen Menschen dargestellt und zum Anderen gibt es hier einige Möglichkeiten didaktisch konzipierter Bildungsangebote. Diese reichen von Führungen, über Workshops z.B. zum Thema „Heimat verlieren“, bis hin zur Spurensuche in der Stadt (vgl. Flyer: Angebote der Mahn- und Gedenkstätte, 2022). Alle Angebote sind für Schulklassen kostenlos. Als zusätzliches Angebot hat das Museum noch einen Koffer mit didaktischen Arbeitsmaterialen zusammengestellt, der kostenlos von Schulklassen ausgeliehen werden kann. Hierdurch besteht die Möglichkeit, das Thema auch aus der Ferne, ohne weite Anreise, im Sachunterricht zu thematisieren oder auch die Thematik vor der Exkursion vor- oder danach nachzubereiten (vgl. Baar/Schönknecht 2018, S.87).
Abschließend kann gesagt werden, dass die Mahn- und Gedenkstätte einen sehr geeigneten außerschulischen Lernort für die sozialwissenschaftliche Perspektive darstellt. Das Thema Nationalismus wird hier in einer guten Balance zwischen wahr und dennoch kindergerecht präsentiert. Der Aufwand für Dortmunder Schulen ist durch die Anreise etwas höher, jedoch ist ein solcher, speziell an Kinder gerichteter Lernort sehr selten und daher die Anreise wert.
Literatur:
- Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Erinnerungsorte - Definitionen, S.1, https://www.stiftung-denkmal.de/wp-content/uploads Erinnerungsorte_ARB_SEK_2.pdf (27.07.2022)
- Baar, Robert/Schönknecht, Gudrun (2018): Außerschulische Lernorte: Didaktische und methodische Grundlagen. Weinheim, Basel.
- Dühlmeier, Bernd (2014): Grundlagen außerschulischen Lernens. In: ders. (Hrsg.): Mehr außerschulische Lernorte in der Grundschule. Neun Beispiele für den fachübergreifenden Sachunterricht. 3. Auflage. Baltmannsweiler, S. 6- 47.
- DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH: Außerschulischer Lernort: Bildungsangebote im Fußballmuseum https://www.fussballmuseum.de/angebote/ schule-im-museum (29.07.2022)
- Dr. Fleermann, Bastian (2015): Düsseldorfer Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus, https://www.gedenkstaettenforum.de/uploads/media/ GedRund180-15-20.pdf (30.07.2022)
- Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU) (Hrsg.) (2013): Perspektivrahmen Sachunterricht, vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Bad Heilbrunn.
- ICOM Deutschland: Der ICOM Advisory Council hat den finalen Vorschlag zur neuen Museumsdefinition ausgewählt (2022), https://icom-deutschland.de/de/ component/content/article/31-museumsdefinition/520-der-icom-advisory-council- hat-den-finalen-vorschlag-zur-neuen-museumsdefinition-ausgewaehlt.html? Itemid=114 (28.07.2022)
- Landeshauptstadt Düsseldorf, der Oberbürgermeister (2015): Die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf: https://www.duesseldorf.de/mahn-und- gedenkstaette.html; https://www.duesseldorf.de/mahn-und-gedenkstaette/ ausstellung.html (15.08.2022)
- Landeshauptstadt Düsseldorf, der Oberbürgermeister (2015): Die Geschichte des Hauses Mühlenstraße 29; https://www.duesseldorf.de/mahn-und-gedenkstaette/ gedenkstaette/hausgeschichte.html (29.07.2022)
- Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW), Lehrplannavigator Primarstufe (NEU) - Sachunterricht: Bereiche, Inhalte und Kompetenzerwartungen, https:// www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-primarstufe/ sachunterricht/kompetenzen/bereiche-inhalte-und-kompetenzerwartungen.html (29.07.2022)
- Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW), Lehrplannavigator Primarstufe (NEU) - Sachunterricht: Aufgaben und Ziele, https://www.schulentwicklung.nrw.de/ lehrplaene/lehrplannavigator-primarstufe/sachunterricht/aufgaben-ziele/aufgaben- und-ziele-des-faches.html (15.08.2022)
- Lehrplan Sachunterricht (2021), Auszug aus Heft 2012 der Schriftenreihe „Schule in NRW“, Sammelband: Lehrpläne Primarstufe, RdErl. d. Ministeriums für Schule und Bildung v. 01.07.2021, https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/ lehrplan/292/ps_lp_su_einzeldatei_2021_08_02.pdf (15.08.2022)
- Thomas, Bernd (2018): Der Sachunterricht und seine Konzeptionen. Historische und aktuelle Entwicklungen. 5., durchgesehene Auflage. Bad Heilbrunn.
- Studtmann, Katharina (2017): Außerschulisches Lernen im Politikunterricht. Schwalbach/Ts.
- Pandel, Hans-Jürgen (2013): Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis. Schwalbach/Ts .: Wochenschauverlag.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine kritische und wissenschaftlich fundierte Reflexion zweier Exkursionen, die im Rahmen des Studiengangs Sachunterricht durchgeführt wurden. Es untersucht, ob die Exkursionen und die damit verbundenen Lernorte für den Sachunterricht geeignet sind.
Welche Exkursionen werden betrachtet?
Die erste Exkursion führte am 08.12.2021 in das Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund. Die zweite Exkursion fand am 07.07.2022 in die Dauerausstellung „Düsseldorfer Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus“ in Düsseldorf statt.
Welche Kriterien werden zur Bewertung der Exkursionen verwendet?
Die Exkursionen werden anhand des Perspektivrahmens für den Sachunterricht, der drei Elemente grundlegender Bildung nach Glöckel (Lebensweltbezug, fachliche Relevanz, überdauernde Bedeutung) und des Verhältnisses von Lernzuwachs zum organisatorischen Aufwand bewertet.
Was wird über das Deutsche Fußballmuseum gesagt?
Das Deutsche Fußballmuseum wird als geeigneter außerschulischer Lernort für den Sachunterricht angesehen, insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Perspektive. Es ermöglicht die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen am Beispiel Fußball und fördert das historische Interesse und Bewusstsein der Schüler.
Was wird über die Gedenkstätte "Düsseldorfer Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus" gesagt?
Die Gedenkstätte wird als ein sehr geeigneter außerschulischer Lernort für die sozialwissenschaftliche Perspektive betrachtet. Sie ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Menschen und Meinungen im Kontext des Nationalsozialismus und sensibilisiert für die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten.
Welche Angebote gibt es für Schulen in der Gedenkstätte?
Die Gedenkstätte bietet Führungen, Workshops und Spurensuche in der Stadt an, die thematisch auf die Bedürfnisse der Schulklassen abgestimmt werden können. Außerdem gibt es einen Koffer mit didaktischen Arbeitsmaterialien, der kostenlos ausgeliehen werden kann.
Wie wird die Anreise zu den Lernorten bewertet?
Die Anreise zum Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird aufgrund der zentralen Lage als unproblematisch eingeschätzt. Die Anreise zur Gedenkstätte in Düsseldorf ist etwas aufwendiger, aber aufgrund der hohen Qualität des Lernortes lohnenswert.
Welche Rolle spielt die kritische Auseinandersetzung mit Geschichtskultur?
Es wird betont, dass Lehrkräfte Schülerinnen dazu anregen sollen, Geschichtskultur kritisch zu hinterfragen und sich der individuellen Motive hinter der Darstellung von Geschichte bewusst zu werden.
Was sind die wesentlichen Schlussfolgerungen?
Beide Lernorte bieten wertvolle Bildungsmöglichkeiten im Sachunterricht. Das Deutsche Fußballmuseum eignet sich besonders für die Vermittlung historischer Kompetenzen, während die Gedenkstätte "Düsseldorfer Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus" einen wichtigen Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Bildung und zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus leistet.
- Quote paper
- Klara W. (Author), 2022, Exkursionen als Grundlagen außerschulischen Lernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1493764