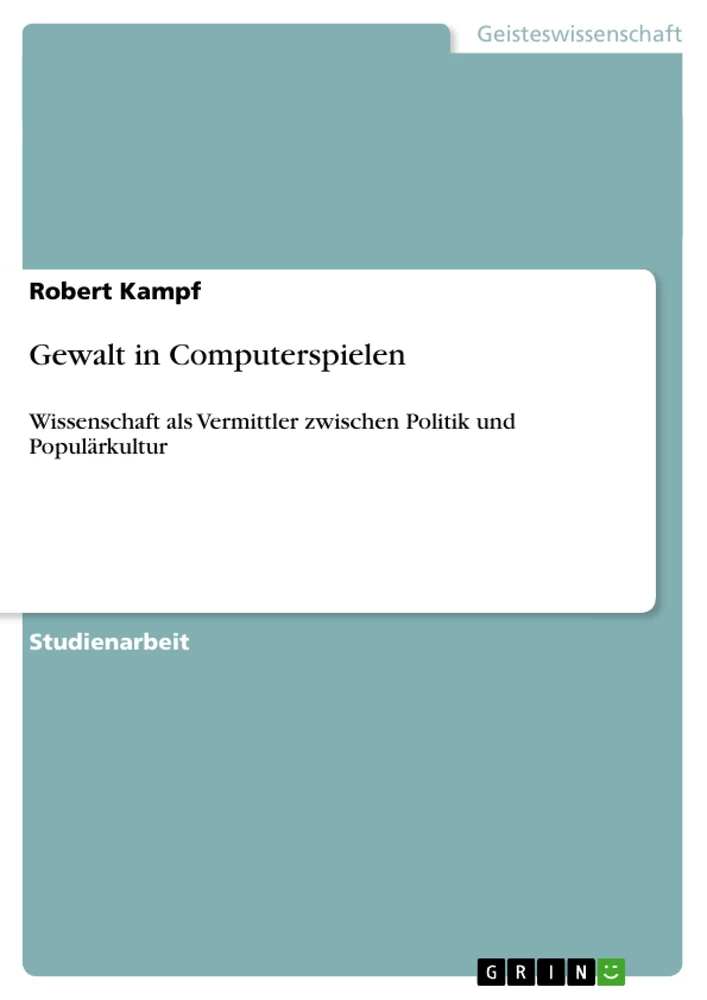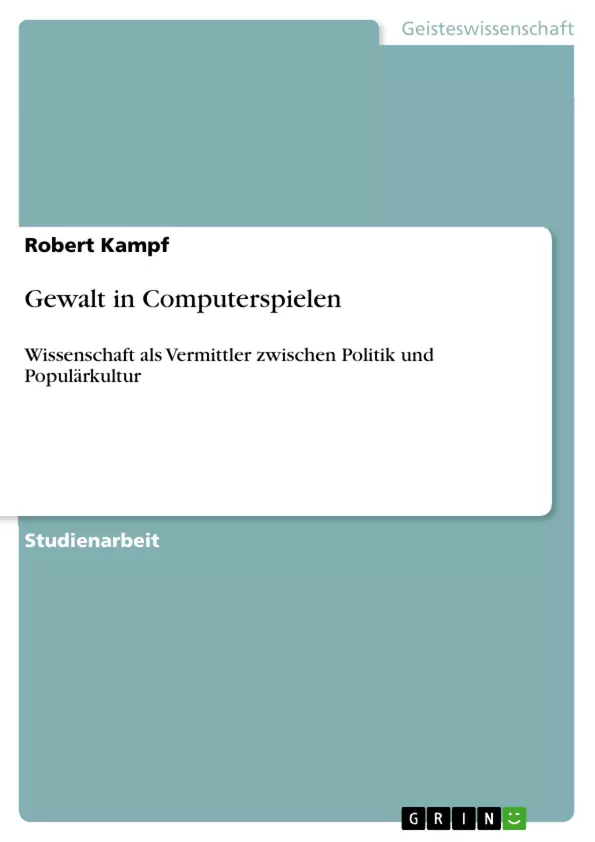Ein bekanntes Problem bei der Beobachtung von Diskursen, ist dass die Auswahl, des zu betrachtenden Phänomens, subjektiv erfolgt und die Auswahl bereits eine wissenschaftliche Objektivität auszuschließen scheint. Wenn in den Medien jedoch eine Häufung in der Berichterstattung festzustellen ist, so ist auch von einem Interesse auf Seite der Rezipienten auszugehen. Die Teilnehmer eines solchen Diskurses, im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, zu beobachten und selbst zum Teilnehmer zu werden, kann dabei Aufschluss über die Funktionsweise öffentlicher Diskurse geben und evtl. Ergebnisse auf einer wissenschaftlichen Metaebene liefern. Zumindest kann sie einen Einblick in die verschiedenen Aspekte der Thematik leisten und die beobachteten Probleme konkretisieren.
Die aktuelle Diskussion, um das Thema Gewalt in Computerspielen, ist beispielhaft dafür, wie ein zuvor kaum beachtetes Problem, durch einzelne medienwirksame Ereignisse katalysiert, in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses tritt. Zudem zeigt sich hier, wie stark sich mediale Verzerrung und selektive Berichterstattung auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auswirken kann, und zudem wie Politiker die Aufmerksamkeit nutzen können, um sich in den Medien zu positionieren.
Ziel der Arbeit ist es herauszustellen, welche Rolle der Politik, der Wissenschaft und der Spielergemeinschaft, im Diskurs um Gewalt in Spielen, zuteil wird, und auf welche Weise sie in den Medien vertreten sind. Darüber hinaus soll sich der Frage gewidmet werden, ob es sich bei Nutzern von Spielen mit Gewaltinhalt tatsächlich um eine Minderheit bzw. Subkultur in unserer Gesellschaft handelt. Im Anschluss daran werden die erarbeiteten Teilaspekte gesamtgesellschaftlich in einen Kontext gebracht, um daraus eine Aufgabenstellung, vor allem an die Wissenschaft, aber auch die Politik und Pädagogik in Deutschland, zu formulieren. Eine Intervention seitens der Wissenschaft erscheint mir unabdingbar, da der Streit um Computerspiele mit Gewaltinhalt, aufgrund mangelnder Objektivität und fehlender wissenschaftlicher Beurteilungskriterien, außer Kontrolle zu geraten droht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diskurse
- Politischer Diskurs in den Medien
- Wissenschaft zwischen Verantwortung und Mittel zum Zweck
- Spielergemeinschaft - Gesellschaft in der Gesellschaft
- Exkurse
- Exkurs Teil I: Andere Länder - andere Diskurse
- Exkurs Teil II: Sebastian Bosse
- Schlussfolgerungen
- Schlussfolgerungen zu Gewalt in Spielen
- Kontextualisierung von Gesellschaft, Wissenschaft und Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die aktuelle Diskussion um Gewalt in Computerspielen und beleuchtet die Rolle der Politik, der Wissenschaft und der Spielergemeinschaft in diesem Diskurs. Sie untersucht, wie diese Akteure in den Medien vertreten sind und ob Nutzer von Spielen mit Gewaltinhalt tatsächlich eine Minderheit oder Subkultur in unserer Gesellschaft darstellen. Darüber hinaus werden die erarbeiteten Teilaspekte gesamtgesellschaftlich in einen Kontext gebracht, um daraus eine Aufgabenstellung für die Wissenschaft, Politik und Pädagogik in Deutschland zu formulieren.
- Analyse des Diskurses um Gewalt in Computerspielen
- Rolle der Politik, Wissenschaft und Spielergemeinschaft im Diskurs
- Medienrepräsentation der Akteure
- Definition der Spielergemeinschaft als Minderheit oder Subkultur
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Wissenschaft, Politik und Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema Gewalt in Computerspielen als ein aktuelles Problem vor, das durch medienwirksame Ereignisse in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt ist. Sie zeigt, wie stark sich mediale Verzerrung und selektive Berichterstattung auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auswirken können und wie Politiker die Aufmerksamkeit nutzen können, um sich in den Medien zu positionieren. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Politik, der Wissenschaft und der Spielergemeinschaft im Diskurs zu beleuchten und die Frage nach der Zugehörigkeit von Spielern mit Gewaltinhalt zu einer Minderheit oder Subkultur zu untersuchen.
Diskurse
Politischer Diskurs in den Medien
Dieses Kapitel analysiert den politischen Diskurs um Gewalt in Computerspielen in den Medien. Es zeigt, wie Politiker durch die mediale Berichterstattung über Amokläufe und die damit verbundene Debatte um Gewaltspiele, ein Verbot solcher Spiele forderten. Der Fokus liegt dabei auf der medialen Verzerrung und der Reduzierung der Komplexität des Themas durch den Begriff „Killerspiel“, der von Politikern geprägt wurde.
Wissenschaft zwischen Verantwortung und Mittel zum Zweck
Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Wissenschaft im Diskurs um Gewalt in Computerspielen. Es zeigt, wie wissenschaftliche Studien sowohl zur Untermauerung von Behauptungen über Zusammenhänge zwischen Gewaltspielen und Aggression bei Jugendlichen genutzt werden, als auch, wie diese Studien gezielt in Auftrag gegeben werden, um dem aktuellen gesellschaftlichen Interesse gerecht zu werden. Es wird zudem auf die Problematik von Aufmerksamkeitsverzerrung durch Medien und die unterschiedlichen Interpretationen von wissenschaftlichen Ergebnissen hingewiesen.
Exkurse
Exkurs Teil I: Andere Länder - andere Diskurse
Dieser Exkurs vergleicht den deutschen Diskurs um Gewalt in Computerspielen mit anderen Ländern und zeigt, wie die Debatte in verschiedenen Ländern unterschiedlich geführt wird.
Exkurs Teil II: Sebastian Bosse
Dieser Exkurs stellt die Arbeit eines Experten auf dem Gebiet der Computerspiele und Gewalt vor und zeigt dessen Sicht auf das Thema.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Gewalt in Computerspielen, Diskursanalyse, Medienrepräsentation, Politik, Wissenschaft, Spielergemeinschaft, Minderheit, Subkultur, Medienkompetenz, Aggression, und Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Debatte um Gewalt in Computerspielen oft unsachlich?
Die Diskussion wird häufig durch mediale Verzerrung und selektive Berichterstattung geprägt, wobei Begriffe wie „Killerspiel“ die Komplexität des Themas politisch reduzieren.
Welche Rolle spielt die Politik in diesem Diskurs?
Politiker nutzen oft medienwirksame Ereignisse wie Amokläufe, um durch Verbotsforderungen Aufmerksamkeit zu generieren und sich öffentlich zu positionieren.
Sind Gamer eine Subkultur oder eine Minderheit?
Die Arbeit untersucht, ob Nutzer von Spielen mit Gewaltinhalt tatsächlich eine gesellschaftliche Minderheit darstellen oder ob Computerspiele bereits ein integraler Bestandteil der modernen Massenkultur sind.
Wie geht die Wissenschaft mit dem Thema Gewaltspiele um?
Wissenschaftliche Studien werden oft als „Mittel zum Zweck“ genutzt, um bestehende Thesen zu untermauern, wobei objektive Beurteilungskriterien oft fehlen.
Gibt es Unterschiede im Diskurs zwischen verschiedenen Ländern?
Ja, die Arbeit zeigt in einem Exkurs, dass die Debatte in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern oft restriktiver und emotionaler geführt wird.
- Citation du texte
- Robert Kampf (Auteur), 2007, Gewalt in Computerspielen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149458