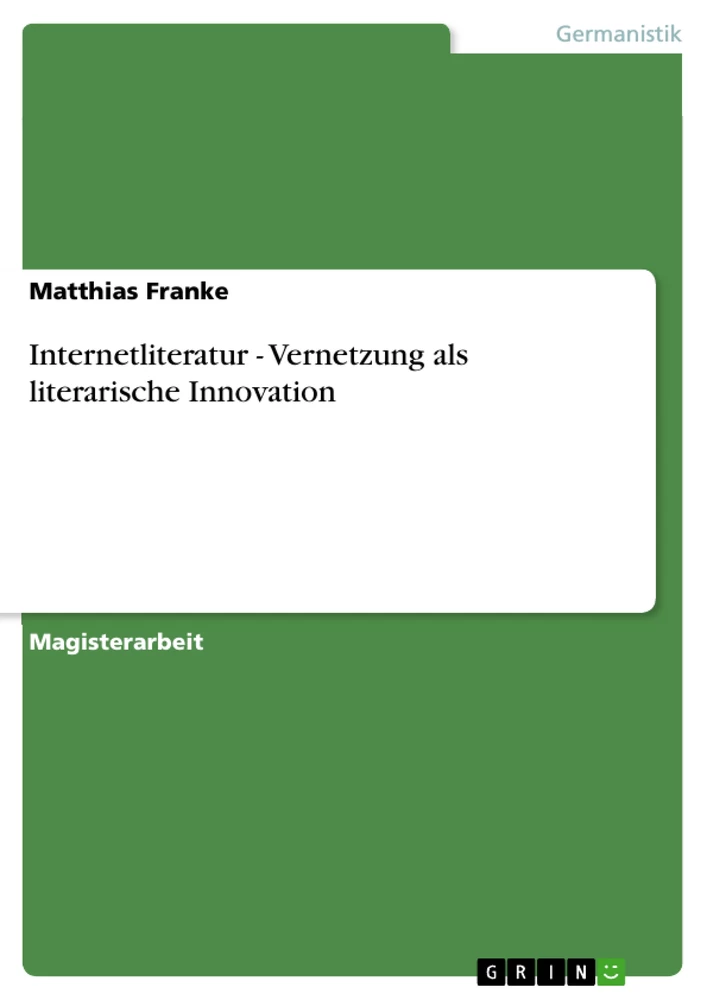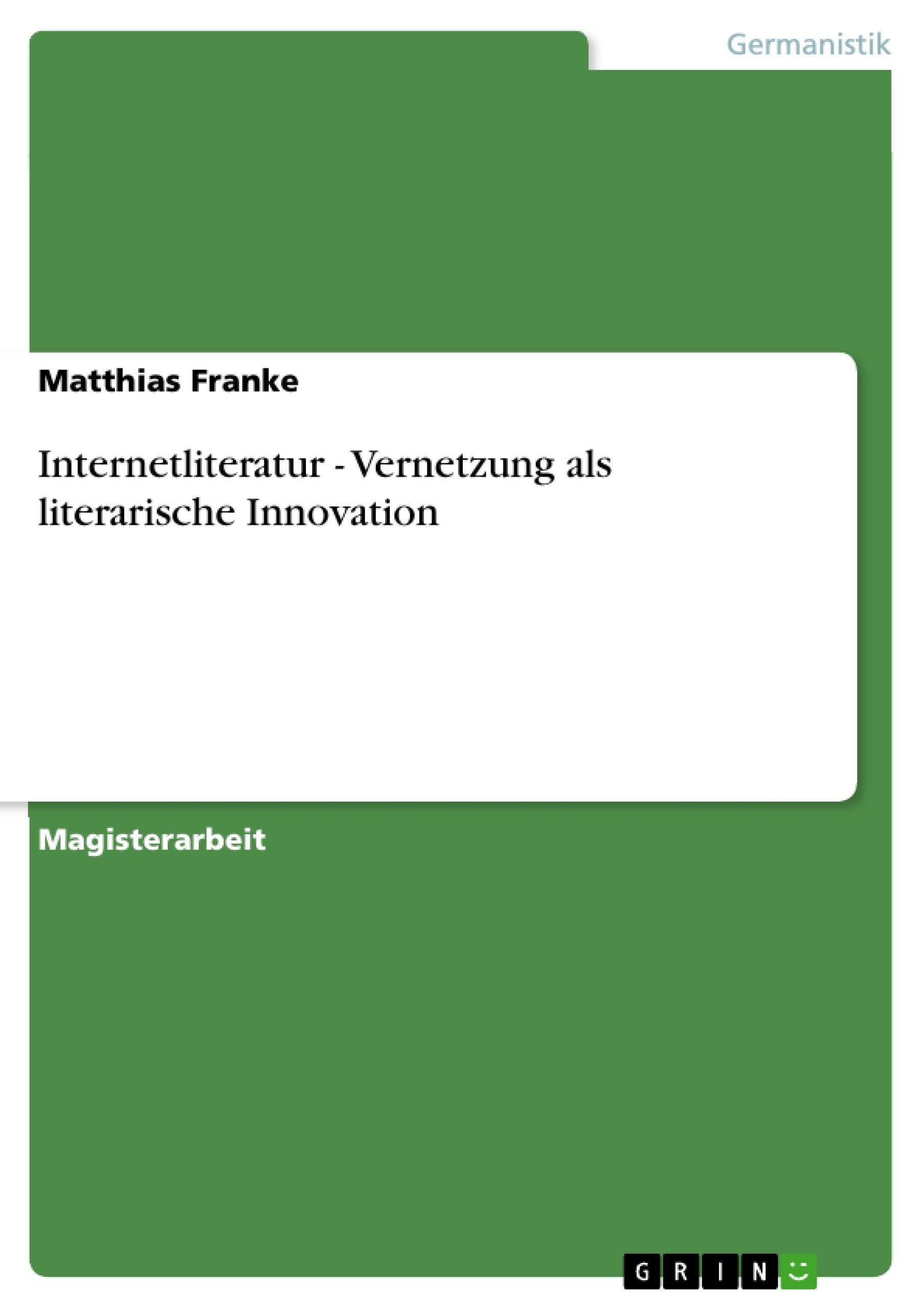Das Verhältnis zwischen der Literatur und elektronischen Medien verändert sich ständig. Für die Literaturwissenschaft bleibt es daher dauerhaft von Interesse. Literatur verarbeitet inhaltlich und formal die Auswirkungen der Technisierung. Doch die Form der Literaturvermittlung durch den Buchdruck verändert sich durch die elektronischen Medien kaum. Erst die Verbreitung der Computertechnik scheint nennenswerte Auswirkungen auf die Literaturproduktion selbst zu haben. Schon die Benutzung des Computers als Schreibgerät verändert die Art zu schreiben.
Schrift und Literatur am Computer sind lediglich elektrische Impulse, die nach Belieben manipuliert werden können. Die Schrift kann nicht wie gewohnt auf dem Papier einer Buchseite fixiert werden, sondern bleibt in einem Zustand ständiger Veränderbarkeit. Dadurch ermöglicht die Computertechnik neue Formen des Umgangs mit dem Text. Hyperlinks verknüpfen verschiedene Textsegmente miteinander, die durch multimediale, räumliche und bewegliche Darstellungsformen ergänzt werden. Literarische Projekte werden innerhalb des Internets publiziert, dessen Kommunikationsangebot den Leser über die Gestalt des Werks entscheiden lässt. All dies zeitigt veränderte Bedingungen für die Produktion, die Rezeption und die Form von Texten. Solche Veränderungen sind das Thema dieser Arbeit. Doch fehlt es bisher einem Instrumentarium, das die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Literatur am Computer ermöglicht.
Die Forschung geht zwar auffällig einmütig davon aus, dass die Elektronisierung von Schrift einen Paradigmenwechsel mit sich bringt. Doch bisher wurden die zahlreichen theoretischen Ausführungen nur durch wenige Untersuchungen ergänzt, die sich der literarischen Praxis zuwenden und konkrete Projekte einer Literatur im Internet analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Die Voraussetzungen der Vernetzung. Der Computer als digitales Schriftmedium
- Die relevanten medientheoretischen Konzeptionen
- Die medientheoretische Konzeption von Michael Heim
- Die medientheoretische Konzeption von Friedrich Kittler
- Die medientheoretische Konzeption von Michael Giesecke
- Die Vernetzung der Texte. Die digitale Schriftlichkeit von Hypertext
- Die theoretische Konzeption von Hypertextsystemen
- Die technische Konzeption von Hypertextsystemen
- Die Vernetzung als Kunst. Der fiktionale Hypertext
- Der fiktionale Hypertext in der Theorie
- Die Hypertextualität des Palimpsestes
- Das Lesen und Schreiben von Hypertext
- Der fiktionale Hypertext in der Praxis
- Die „imaginäre Bibliothek“ von Heiko Idensen und Matthias Krohn
- Die Abhängigkeit des Hypertexts von der Buchkultur
- Die konzeptionellen Probleme des fiktionalen Hypertexts
- Die Internetliteratur. Die Entstehung einer Literatur der Vernetzung
- Literaturwettbewerbe
- Modell einer Ästhetik der Internetliteratur. Die medieninhärenten Wechselwirkungen
- Ästhetik und Technik. Literaturprojekte der Semiosphäre
- Theorie
- Multimediale Internetliteratur
- Die Kombination aus Text und Bild
- „Die Aaleskorte der Ölig“ von Dirk Günther und Frank Klötgen
- „Trost der Bilder“ von Jürgen Daiber und Jochen Metzger
- Die Kombination aus Text und Ton
- „Looppool“ von Bastian Boettcher
- Die Projektion sprachlicher Strukturen auf die technische Ebene des Hypertexts
- „Zeit für die Bombe“ von Susanne Berkenheger
- „Hilfe“ von Susanne Berkenheger
- Schlussfolgerungen
- Computerheuristik als Objekt der Kunst
- Kommunikation und Technik. Literaturprojekte der Kommunikationssphäre
- Theorie
- Psychotechnologie
- Kognitive Wechselwirkungen
- Mitschreibeprojekte
- Thematisch ungebundene Mitschreibeprojekte
- „Baal lebt“
- „Assoziationsblaster“ von Dragan Espenschied und Alvar Freude
- „Beim Bäcker“
- Thematisch gebundene Mitschreibeprojekte
- „TanGo“ von Martina Kieninger
- 23:40" von Guido Grigat
- „Generationenprojekt\" von Jan Ulrich Hasecke
- Schlussfolgerungen
- Die Visualisierung der Vernetzung
- „IO_lavoro immateriale“
- Schlussfolgerungen
- Kreativität im virtuellen Raum
- Die Bedeutung des Computers als digitales Schriftmedium und seine Auswirkungen auf die Literatur
- Die Rolle des Hypertexts und seiner technischen und theoretischen Konzeptionen in der Internetliteratur
- Die Herausforderungen und Chancen der Vernetzung im Kontext von Literatur und Kunst
- Die Entwicklung einer spezifischen Ästhetik der Internetliteratur
- Die Analyse von verschiedenen Beispielen und Projekten der Internetliteratur
- Das erste Kapitel befasst sich mit den Voraussetzungen der Vernetzung und dem Computer als digitales Schriftmedium. Es untersucht verschiedene medientheoretische Konzeptionen und analysiert die Möglichkeiten der digitalen Schriftlichkeit von Hypertext.
- Das zweite Kapitel widmet sich dem fiktionalen Hypertext und untersucht seine theoretischen und praktischen Aspekte. Es beleuchtet die „imaginäre Bibliothek“ von Heiko Idensen und Matthias Krohn sowie die Abhängigkeit des Hypertexts von der Buchkultur.
- Das dritte Kapitel behandelt die Entstehung der Internetliteratur als eine Literatur der Vernetzung und zeigt die Bedeutung von Literaturwettbewerben in diesem Prozess auf.
- Das vierte Kapitel skizziert die medieninhärenten Wechselwirkungen und die Entwicklung einer Ästhetik der Internetliteratur.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit Literaturprojekten der Semiosphäre, die die Kombination von Text mit Bild und Ton sowie die Projektion sprachlicher Strukturen auf die technische Ebene des Hypertexts untersuchen. Es analysiert verschiedene Beispiele wie „Die Aaleskorte der Ölig“, „Trost der Bilder“, „Looppool“, „Zeit für die Bombe“ und „Hilfe“.
- Das sechste Kapitel analysiert Literaturprojekte der Kommunikationssphäre, die die Interaktion zwischen Autor und Leser in den Vordergrund stellen. Es beleuchtet die Themengebiete Psychotechnologie, kognitive Wechselwirkungen und Mitschreibeprojekte wie „Baal lebt“, „Assoziationsblaster“, „Beim Bäcker“, „TanGo“, „23:40" und „Generationenprojekt“.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Internetliteratur“ befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung einer neuen literarischen Form, die durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung und des Internets geprägt ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Internetliteratur, Hypertext, digitale Schriftlichkeit, Vernetzung, Ästhetik, Kommunikation, Semiosphäre, Literaturprojekte, Medieninhärenten Wechselwirkungen, Computerheuristik, Mitschreibeprojekte, Psychotechnologie, Kognitive Wechselwirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Internetliteratur?
Internetliteratur bezeichnet literarische Werke, die digital produziert und im Internet publiziert werden. Sie nutzt spezifische digitale Möglichkeiten wie Hyperlinks, Multimedia und interaktive Kommunikation.
Wie verändert der Computer die Literaturproduktion?
Der Computer macht Schrift zu manipulierbaren elektrischen Impulsen. Texte sind nicht mehr statisch wie auf Papier, sondern bleiben in einem Zustand ständiger Veränderbarkeit und Vernetzung.
Welche Rolle spielt der Hypertext in der digitalen Literatur?
Hypertext ermöglicht die nicht-lineare Verknüpfung von Textsegmenten. Leser können über Links eigene Wege durch das Werk wählen, was die traditionelle Rolle von Autor und Leser verändert.
Was sind Mitschreibeprojekte im Internet?
Mitschreibeprojekte wie der "Assoziationsblaster" sind kollaborative Literaturformen, bei denen Leser aktiv am Text mitschreiben und so die Gestalt des Werks mitbestimmen können.
Was ist multimediale Internetliteratur?
Hierbei wird Text mit anderen Medien wie Bild und Ton kombiniert (z. B. "Looppool"), oder sprachliche Strukturen werden direkt auf die technische Ebene des Hypertexts projiziert.
Welche Medientheoretiker werden im Kontext der digitalen Schriftlichkeit genannt?
Die Arbeit bezieht sich auf die medientheoretischen Konzeptionen von Michael Heim, Friedrich Kittler und Michael Giesecke.
- Quote paper
- Matthias Franke (Author), 2001, Internetliteratur - Vernetzung als literarische Innovation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14946