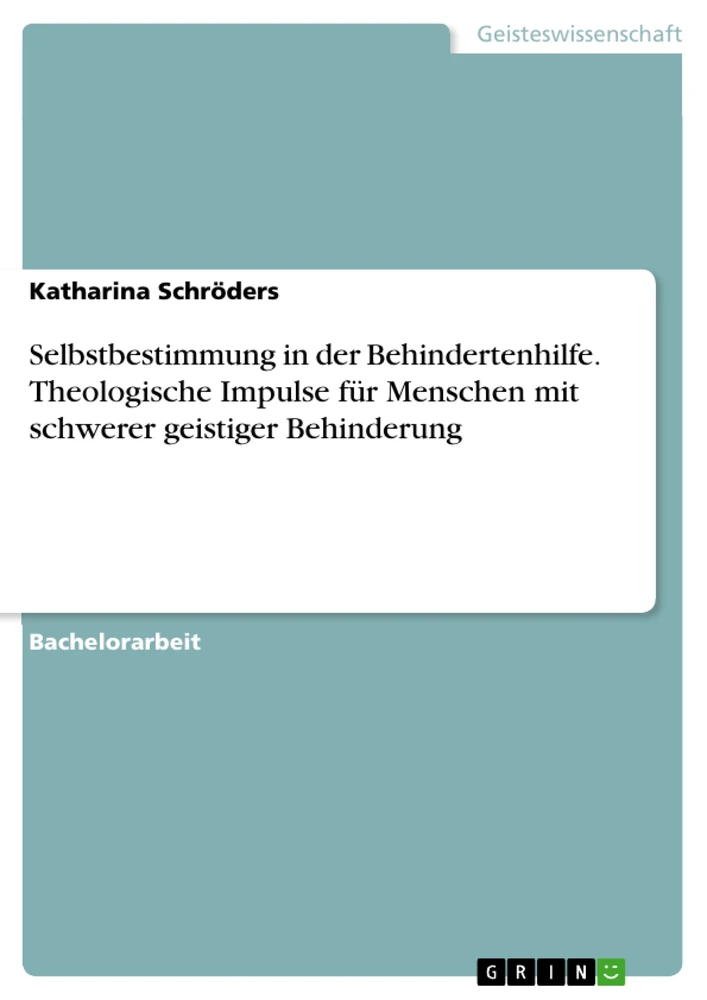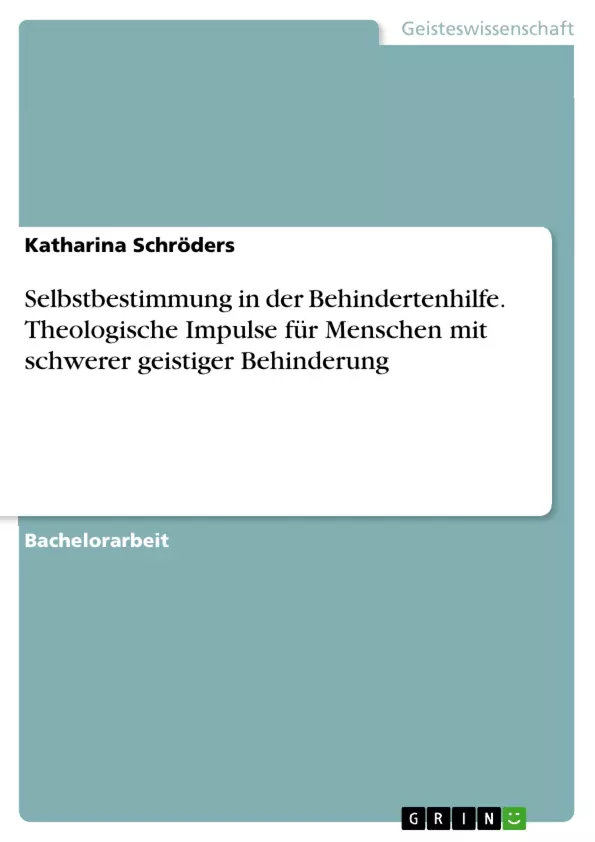Die Selbstbestimmung ist ein zentrales Paradigma in der diakonischen Behindertenhilfe, doch seine Anwendung auf Menschen mit schwerer geistiger Behinderung ist komplex. Diese Arbeit untersucht die Wurzeln dieses Paradigmas und die Rolle philosophischer und theologischer Anthropologien in seiner Etablierung. Sie hinterfragt die unkritische Übernahme der Selbstbestimmungsmaxime und beleuchtet die daraus resultierenden Herausforderungen für die Teilhabe und soziale Anerkennung dieser Klient:innengruppe. Im Fokus steht die inklusive theologische Anthropologie von Hans Reinders, deren Ansatz in "Receiving the Gift of Friendship" das Leben mit schwerer geistiger Behinderung nicht als defizitär betrachtet. Die Arbeit zielt darauf ab, neue Impulse für eine diakonische Praxis zu liefern, die über die Orientierung an Selbstbestimmung hinausgeht und blinde Flecken adressiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paradigma der Selbstbestimmung in der Hilfe für Menschen mit (einer schweren geistigen) Behinderung
- Begründung von Hilfe und Konsensbegriff Menschenwürde
- Inhaltliche Begründung der Menschenwürde in der Personalität
- Würde und Personalität in der Philosophie
- Würde und Personalität in der Theologie
- Ethische Orientierungen in der Behindertenhilfe
- Spezifische Handlungsorientierungen in der Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung
- Kritische Diskussion des Paradigmas der Selbstbestimmung
- Strategien zur Universalisierung von Menschenwürde
- Warum die Grenzen des Paradigmas der Selbstbestimmung bestehen bleiben
- Hans Reinders' inklusive theologische Anthropologie und Ethik
- Gottebenbildlichkeit als extrinsische Relationalität
- Personalität als ekstatisches Sein im Abendmahl
- Ethik der wahren Freundschaft
- Freundschaft als ultimatives Gut
- Empfangen als höchstes Prinzip
- Die Mission von Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung
- Kritik
- Probleme eines ontologischen Personbegriffes
- Beschränkung auf den christlichen Kontext
- Gegenstimme zum Paradigma der Selbstbestimmung
- Vereinbarkeit mit evangelischen Grundgedanken
- Receiving the Gift of Friendship - Mögliche Impulse für die diakonische Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung
- Neu gewichtete Deutung der Professionsziele von Sozialer Arbeit in der Perspektive von Freundschaft als höchstem Gut
- Unmöglichkeit der Deckung von wahrer Freundschaft und professioneller Dienstleistung
- Neue Gewichtung der Deutungen von Teilhabe, Inklusion und Gerechtigkeit in der Perspektive von Freundschaft als höchstem Gut
- Positive Folgerungen von Teilhabe und Inklusion
- Soziale Anerkennung und kulturelle Gleichwertigkeit als Teile von Gerechtigkeit
- Vermehrte Möglichkeiten für den Empfang von wahrer Freundschaft durch Community Care
- Vermehrte Möglichkeiten für den Empfang von wahrer Freundschaft in Jürgen Moltmanns Diakonentum aller Gläubigen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Impulse theologische Anthropologien, die bewusst inklusiv sein wollen, für die diakonische Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung liefern könnten, um die blinden Flecken einer vorrangigen Orientierung an Selbstbestimmung auszugleichen. Dabei werden die anthropologischen Vorannahmen und Ideale sowie Leitlinien für die Praxis kritisch hinterfragt, um die Folgen einer unkritischen Übernahme des geltenden Paradigmas der Selbstbestimmung in die diakonische Ethik aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die gegenwärtige Situation der Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung im Kontext des Paradigmas der Selbstbestimmung, stellt dieses Paradigma in Frage und erforscht alternative Perspektiven aus der theologischen Anthropologie.
- Kritik des Paradigmas der Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe
- Inklusive theologische Anthropologie und Ethik nach Hans Reinders
- Mögliche Impulse für die diakonische Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung
- Bedeutung von Freundschaft, Teilhabe, Inklusion und Gerechtigkeit in der diakonischen Praxis
- Relevanz von Community Care und dem Diakonentum aller Gläubigen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Forschungsgegenstand der Arbeit vor. Kapitel 2 untersucht das Paradigma der Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe und analysiert seine philosophischen und theologischen Grundlagen. Es werden die ethischen Orientierungen und Handlungsorientierungen in der Behindertenhilfe beleuchtet und die Grenzen des Paradigmas der Selbstbestimmung im Hinblick auf Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung aufgezeigt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der inklusiven theologischen Anthropologie und Ethik von Hans Reinders. Es werden Reinders' Konzepte der Gottebenbildlichkeit, der Personalität als ekstatisches Sein im Abendmahl und der Ethik der wahren Freundschaft erläutert. Die Kritik an Reinders' Werk konzentriert sich auf die Frage nach der Vereinbarkeit seiner Ansätze mit dem Paradigma der Selbstbestimmung und den christlichen Kontext. Kapitel 4 erforscht mögliche Impulse aus Reinders' Werk für die diakonische Hilfe für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung. Es werden die Bedeutung von Freundschaft, Teilhabe, Inklusion und Gerechtigkeit in der Perspektive von Reinders betrachtet. Die Kapitel 4.4 und 4.5 befassen sich mit den Möglichkeiten von Community Care und dem Diakonentum aller Gläubigen, um Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung mehr Teilhabe und soziale Anerkennung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Selbstbestimmung, Behindertenhilfe, theologische Anthropologie, Inklusion, Teilhabe, Freundschaft, Gerechtigkeit, Community Care, Diakonentum aller Gläubigen, Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Hans Reinders.
- Citation du texte
- Katharina Schröders (Auteur), 2022, Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe. Theologische Impulse für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1494891