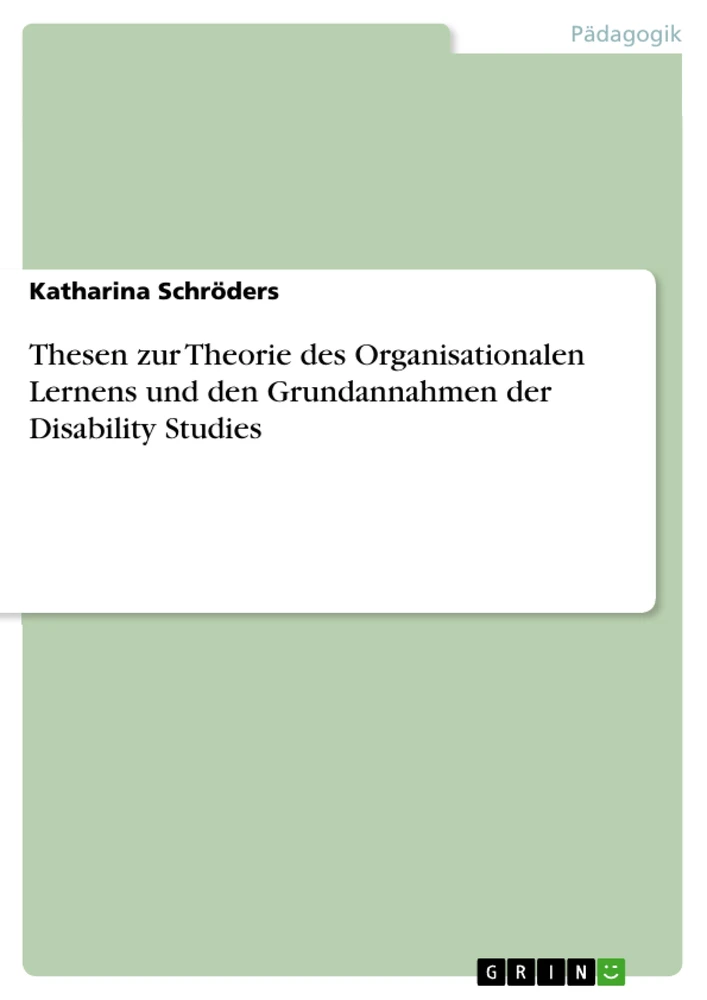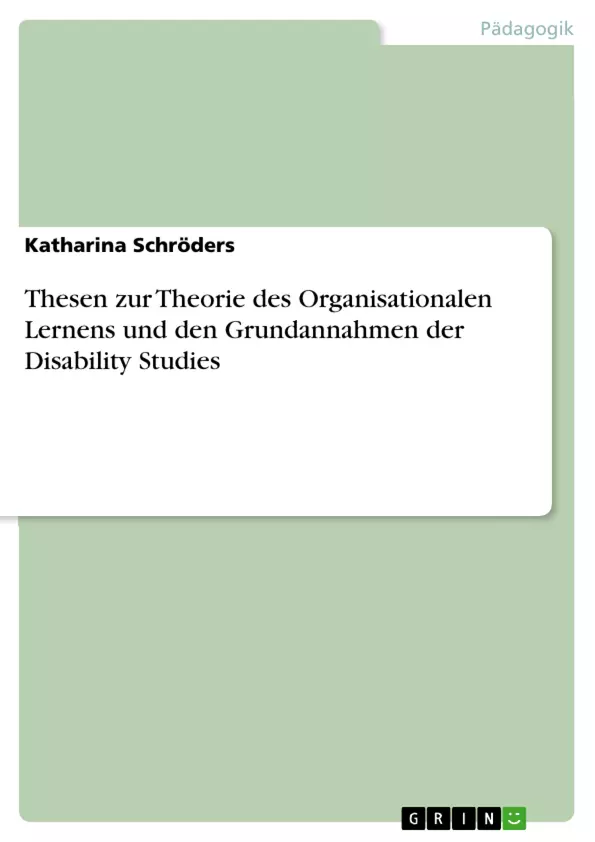Dieses Thesenpapier untersucht zwei zentrale Themenfelder: Organisationales Lernen und die Beziehung zwischen Behinderung und Institutionen. Im ersten Teil werden grundlegende Thesen zum Organisationalen Lernen vorgestellt, basierend auf den Arbeiten von Chris Argyris und Donald A. Schön. Lernen wird dabei als Veränderung der handlungsleitenden Theorien einer Organisation verstanden, mit einer pädagogischen Perspektive, die den Lernprozess als ganzheitlich und erfahrungsbasiert begreift. Das Lernen wird zudem in verschiedene Dimensionen wie Wissen, Können und Leben-Lernen ausdifferenziert. Der zweite Teil behandelt die Konzepte der Disability Studies, die Behinderung in medizinischen, sozialen und kulturellen Modellen verorten. Es wird die Wechselwirkung von Organisation und Institution analysiert, wobei Institutionen als normativ geprägte Regelsysteme verstanden werden, die Veränderungsprozesse in der Behindertenhilfe beeinflussen und teilweise behindern können.
Inhaltsverzeichnis
- Thema 1: Organisationales Lernen
- These 1: Gemäß Chris Argyris und Donald A. Schön vollzieht sich Organisationales Lernen in der Veränderung der handlungsleitenden Theorien einer Organisation.
- These 2: In einer pädagogischen Sicht auf Organisationales Lernen wird Lernen als ganzheitlicher, erfahrungsbasierter, mustermimetischer Prozess verstanden.
- These 3: Organisationales Lernen kann ausdifferenziert werden in Wissen-, Können-, Leben- und Lernen-Lernen.
- Thema 2: Behinderung & Institution
- These 1: In den Disability Studies wird unterschieden zwischen einem individuell-medizinischen, einem sozialen und einem kulturellen Modell von Behinderung.
- These 2: In Anlehnung an ein institutionelles Organisationsverständnis kann Organisation definiert werden als ein konkretes menschliches Sozialgebilde, das aus Mitgliedern, Regeln, Artefakten und Prozeduren besteht und ,,sich als kulturelle Praxis generiert und (re)aktualisiert". Eine Institution ist ein normatives Regelsystem mit gesellschaftlicher Geltung. Institution und Organisation stehen zueinander in Wechselwirkung.
- These 3: Eine empirische Sichtung zeigt, dass trotz bereits geschehener, erfolgreicher Veränderungsprozesse in wohnbezogenen Diensten für behinderte Menschen das Wesen der Hilfen einer gewissen Veränderungsresistenz unterliegt. Diese Veränderungsresistenz kann erklärt werden durch die prägende Kraft von gesellschaftlich etablierten Institutionen auf die Behindertenhilfe.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Thesenpapier zielt darauf ab, verschiedene Aspekte des organisatorischen Lernens und die Auswirkungen von Institutionen auf die Behindertenhilfe zu beleuchten. Es wird argumentiert, dass organisatorisches Lernen nicht nur kognitiv, sondern auch erfahrungsbasiert und performativ ist, und dass es verschiedene Arten des Lernens gibt, die in einem Lernprozess beteiligt sein können.
- Die Rolle handlungsleitender Theorien im organisationalen Lernen
- Die Bedeutung von Praxismustern und mimetischen Erfahrungen im organisationalen Lernen
- Die verschiedenen Modelle von Behinderung (individuell, sozial, kulturell)
- Die Wechselwirkungen zwischen Organisationen und Institutionen
- Die Herausforderungen und Ambivalenzen in der Behindertenhilfe, insbesondere im Hinblick auf die Dominanz stationärer Betreuungsangebote
Zusammenfassung der Kapitel
Thema 1: Organisationales Lernen
Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Konzept des organisationalen Lernens. Argyris und Schön stellen dar, dass organisatorisches Lernen durch die Veränderung der handlungsleitenden Theorien einer Organisation erfolgt. Diese Theorien sind Denkvorstellungen über die Organisation und ihre Mitglieder, die in den Köpfen der einzelnen Mitglieder existieren. Eine Veränderung dieser Theorien erfolgt durch bewusste Denk- und Handlungsprozesse, die durch Erfahrungen ausgelöst werden. Es werden zwei Arten des Lernens unterschieden: Einschleifen- und Doppelschleifen-Lernen.
Die zweite These erweitert den Lernbegriff aus pädagogischer Sicht und betont die Rolle von Erfahrungen, Praxismustern und mimetischen Lernprozessen. Der organisationspädagogische Ansatz von Göhlich umfasst auch die kognitiven Elemente des Lernens, erweitert den Lernbegriff jedoch um die Veränderung von Praxismustern, die in der Interaktion zwischen den Mitgliedern einer Organisation stattfinden.
Die dritte These differenziert organisationales Lernen in vier Dimensionen: Wissen-, Können-, Leben- und Lernen-Lernen. Jede Dimension impliziert einen unterschiedlichen Lerngegenstand, Lernmodus und Verhältnis zwischen dem Lernenden und dem Zu Lernenden.
Thema 2: Behinderung & Institution
Der zweite Abschnitt behandelt das Thema Behinderung und die Rolle von Institutionen. Es wird erläutert, dass in den Disability Studies verschiedene Modelle von Behinderung diskutiert werden, darunter das individuell-medizinische Modell, das soziale Modell und das kulturelle Modell. Jedes Modell betrachtet Behinderung aus unterschiedlichen Perspektiven und hat unterschiedliche Implikationen für das Verständnis von Behinderung und für die Gestaltung von Unterstützungsmaßnahmen.
Die zweite These definiert Organisation als ein konkretes, menschliches Sozialgebilde, das aus Mitgliedern, Regeln, Artefakten und Prozeduren besteht. Organisationen stehen in Wechselwirkung mit Institutionen, die als gesellschaftlich gültige Handlungsregeln und -normen verstanden werden.
Die dritte These untersucht die Veränderungsresistenz in der Behindertenhilfe. Trotz erfolgter Veränderungsprozesse, die ambulante Leistungen vor stationäre Leistungen favorisieren, dominieren in der Praxis stationäre Angebote weiterhin. Diese Dominanz wird durch die prägende Kraft von gesellschaftlich etablierten Institutionen erklärt, die die Behindertenhilfe beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Thesenpapiers sind organisatorisches Lernen, handlungsleitende Theorien, Praxismuster, mimetisches Lernen, Behinderung, Disability Studies, Institution, Organisationsverständnis, Veränderungsresistenz und Behindertenhilfe.
- Citar trabajo
- Katharina Schröders (Autor), 2019, Thesen zur Theorie des Organisationalen Lernens und den Grundannahmen der Disability Studies, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1494903