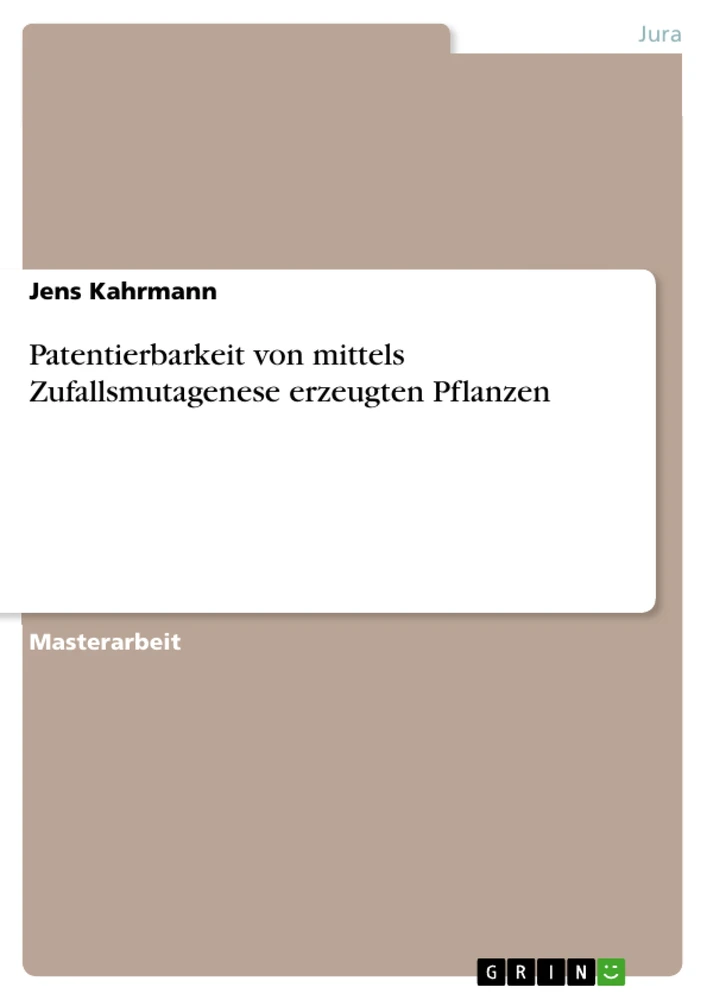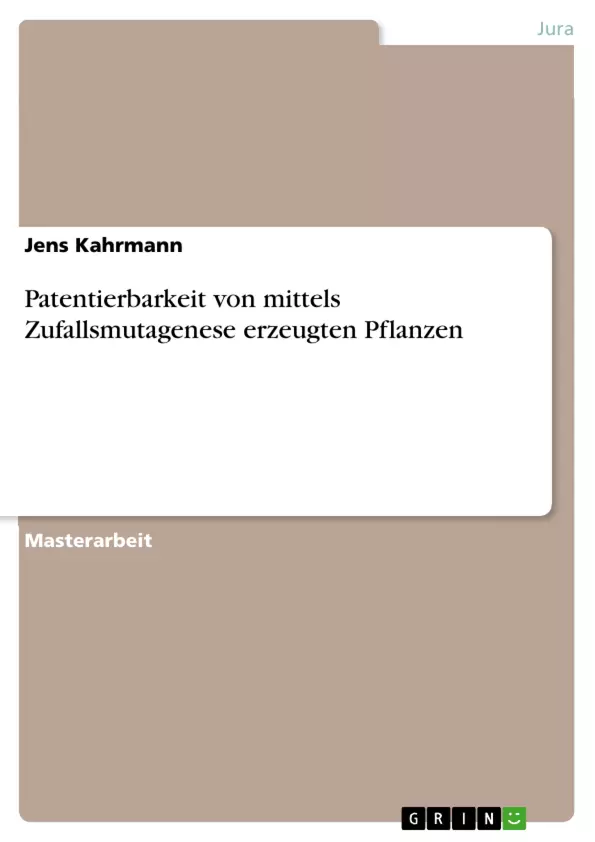In der Arbeit werden die biologischen Grundlagen und die Bedeutung der Pflanzenzüchtung mittels Zufallsmutagenese (auch „ungerichtete Mutagenese“ genannt), gewissermaßen einer Jahrzehnte alten Form der Gentechnik, für die (ökologische) Landwirtschaft dargestellt.
Anschließend wird der Zusammenhang zwischen der Diskussion um Patente auf Pflanzen und der Debatte über die Regulierung der (Agro-)Gentechnik aufgezeigt und zugleich beide Regelungsmaterien voneinander abgegrenzt. In ihrem Hauptteil beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage der Patentierbarkeit der mittels Mutagenese erzeugten Pflanzen. Dabei geht es unter anderem um die Tatbestandsmerkmale der Erfindung und der erfinderischen Tätigkeit.
Der zentrale Fokus wird indes auf die Interpretation der Ausschlussvorschrift in Art. 53 lit. b) S. 1 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) zu „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ gelegt, wobei auch die relevante einschlägige Rechtsprechung nachgezeichnet wird. Die Arbeit geht auch darauf ein, ob die Rückausnahme des Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ beim Einsatz von in vitro durchgeführter Zufallsmutagenese von Bedeutung sein kann und endet schließlich mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung...1
B. Zufallsmutagenese und ihre Bedeutung in der Landwirtschaft...2
I. Definition und Grundlagen der Mutagenese...2
II. Praktische Durchführung der Zufallsmutagenese...3
III. Hohe landwirtschaftliche Bedeutung der Zufallsmutagenese...6
IV. Aktuelle Patenterteilungen auf durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen...8
C. Verzahnung der Debatten um Gentechnikrecht und Patente auf Pflanzen...9
I. Situation bis 2018...9
II. Situation nach dem EuGH-Urteil von 2018...10
III. Aktuelle Diskussion um Patente auf Pflanzen...11
IV. Gründe für Differenzierung zwischen Patent- und Gentechnikrecht...12
D. Patentierbarkeit von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen...13
I. Allgemeine Patenterteilungsvoraussetzungen...14
1. Erfindung...15
a) Technizität...16
b) Ausführbarkeit...17
aa) Technische Brauchbarkeit...17
bb) Wiederholbarkeit...18
cc) Zwischenergebnis...19
c) Entdeckung als Gegensatz zur Erfindung...19
aa) Auffindung induzierter Mutationen als bloße Entdeckung?...19
bb) Stellungnahme...20
2. Neuheit...21
3. Erfinderische Tätigkeit...22
a) Kriterium der ungewissen Erfolgsaussichten...23
b) Subsumtion...25
4. Gewerbliche Anwendbarkeit...26
II. Offenbarung...26
III. Kein Einsatz von im Wesentlichen biologischen Verfahren...27
1. Unterschiedliche Interpretationen vom Terminus iWbV...28
a) Jede Erbgutveränderung ist biologisch...28
b) Jeder biologische Verfahrensschritt führt zu iWbV...28
c) Konventionelle Züchtung entspricht iWbV...28
d) Gewichtung biologischer Faktoren im Züchtungsverfahren...29
e) Wesentlichkeit des technischen Anteils...29
f) iWbV nur bei ausschließlicher Nutzung von Naturphänomenen...30
g) Einfügen eines Merkmals in das Genom...30
h) Stellungnahme...32
2. Kritik an der Verwerfung der gesetzlichen Definition...34
3. Anwendbarkeit der Rückausnahme für mikrobiologische Verfahren...35
a) Pflanzenzüchtung ist nicht mikrobiologisch...36
b) Veränderung von Pflanzenzellen ist mikrobiologisch...36
c) Rechtsprechung...37
d) Unanwendbarkeit der Rückausnahme...38
E. Patentschutz für Pflanzen durch Patentierung des Verfahrens der Zufallsmutagenese?...39
F. Fazit...40
Literatur- und Quellenverzeichnis
Ann, Christoph
Patentrecht, 8. Auflage, München 2022.
Benkard, Georg
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, hrsg. v. Bacher, Klaus, 12. Auflage, München 2023
(zitiert: Benkard-PatG/Bearbeiter).
Benkard, Georg
Europäisches Patentübereinkommen, hrsg. v.
Beckedorf, Ingo/Ehlers, Jochen
, 4. Auflage, München 2023
(zitiert: Benkard-EPÜ/Bearbeiter).
Beier, Friedrich-Karl/Straus, Joseph
Frage 61: Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen
Bericht im Namen der deutschen Landesgruppe,
GRUR 1983, 100 - 103.
Bioland e.V.
Freie Fahrt für Gentechnik und Patente, Pressemitteilung vom 22.6.2023, https://www.bioland.de/presse/pressemitteilungen/news-detail/freie-fahrt-fuer-gentechnik-und-patente , abgerufen: 31.3.2024.
Bouma, Josef/Ohnoutka, Zdeněk
Importance and application of the mutant 'Diamant' in spring barley breeding, in: IAEA (Hrsg.), Plant Mutation Breeding for Crop Improvement Vol. 1, Wien 1991, S. 127 - 133 (zitiert: Bouma/Ohnoutka, Plant Mutation Breeding for Crop Improvement).
Blanke-Roeser, Constantin
Einheitspatent und einheitliches Patentgericht,
NJW 2023, 135 - 137.
Bostyn, Sven J. R.
Do you want biological or essentially biological vegetables?,
Bio Science Law Review 2006/2007, 146 - 155.
Bostyn, Sven J. R.
Patentability of Plants: At the Crossroads between Monopolizing Nature and Protecting Technological Innovation?,
The Journal of World Intellectual Property 2013, 105 - 149.
Buchholz, Georg
Kommissionsvorschlag einer Verordnung über neue genomische Techniken (NGT): Zur Verletzung des Vorsorgeprinzips, Rechtliche Stellungnahme im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/gentechnik/pdf/Gruene_im_Bundestag_Gutachten__Vereinbarkeit_des_Kommissionsvorschlags_zu_NGT_mit_dem_Vorsorgeprinzip.pdf ,
abgerufen: 31.3.2024.
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.
Branchenreport 2023, https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Broschuere_2023/BOELW_Branchenreport2023.pdf , abgerufen: 31.3.2024.
Büscher, Wolfgang/Dittmer, Stefan/Schiwy, Peter (Hrsg.)
Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht: Kommentar, 3. Auflage, Köln 2015
(zitiert: Büscher/Dittmer/Schiwy/Bearbeiter).
Cockbain, Julian/Sterckx, Sigrid
Quis custodet custodes? Referral G‐3/19 before the EPO Enlarged Board of Appeal and the imperative of challenging the board's interpretation of Art. 53(b) EPC, The Journal of World Intellectual Property 2020, 679 - 711.
de Vries, Hugo
Die Mutationstheorie, Band 1, Leipzig 1901.
Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina
Für eine wissenschaftsbasierte Regulierung von mittels neuer genomischer Techniken gezüchteten Pflanzen in der EU, Ad-hoc-Stellungnahme vom 19.10.23, https://www.dfg.de/resource/blob/318918/ba61b1e44d3c2bc30b8adec469ea56b7/231103-dfg-leopoldina-genomtechnik-pflanzen-data.pdf , abgerufen: 31.3.2024 (zitiert: Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Ad-hoc Stellungnahme).
Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina
Statement of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Research Foundation) and the German National Academy of Sciences Leopoldina regarding the proposal of the European Commission for an EU regulation on plants obtained by new genomic techniques, https://www.dfg.de/resource/blob/289576/300ff7085ac66b7ff03177849008a13f/statement-genomic-techniques-data.pdf , abgerufen: 31.3.2024 (zitiert: Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Statement).
Die Grünen/EFA im Europäischen Parlament
Deregulierung bedroht Ökologie und Ökobranche, Pressemitteilung vom 6.2.2024, https://www.greens-efa.eu/de/artikel/press/deregulation-threatens-ecology-and-the-organic-sector , abgerufen am 22.3.2024.
Dudenredaktion (Hrsg.)
Duden – Das Bedeutungswörterbuch, 5. Auflage, Berlin 2018.
EFSA Panel on GMO
In vivo and in vitro random mutagenesis techniques in plants, EFSA Journal 19:11 (2021), 1 - 30.
European Parliamentary Research Service
Plants produced by new genomic techniques, Second edition, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754549/EPRS_BRI(2023)754549_EN.pdf , abgerufen: 31.3.2024.
Faltus, Timo
Mutagene(se) des Gentechnikrechts, ZUR 2018, 524 - 534.
Fitzner, Uwe
Der patentrechtliche Schutz mikrobiologischer Erfindungen,
Berlin 1982.
Fitzner, Uwe/Kubis, Sebastian u. a. (Hrsg.)
Beck’scher Online-Kommentar Patentrecht, 31. Edition (Januar 2024), München 2024 (zitiert: BeckOK/Bearbeiter).
Gersmann, Hanna
Pflanzen im Scherenschnitt, taz.de vom 5.7.2023, https://taz.de/Patente-auf-Lebensmittel/!5942021/ ,
abgerufen am: 31.3.2024.
Godt, Christine
Technology, Patents and Markets: The Implied Lessons of the EU Commission’s Intervention in the Broccoli/Tomatoes Case of 2016 for Modern (Plant) Genome Editing, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2018, 512 - 535.
Götting, Horst-Peter/Hofmann, Franz/Zech, Herbert
Gewerblicher Rechtsschutz, 12. Auflage, München 2024.
Greene, Elizabeth A./Codomo, Christine A. u. a.
Spectrum of Chemically Induced Mutations From a Large-Scale Reverse-Genetic Screen in Arabidopsis, Genetics 164 (2003),
731 - 740.
Hase, Yoshihiro/Akita, Yusuke u. a.
Development of an efficient mutagenesis technique using ion beams: Toward more controlled mutation breeding,
Plant Biotechnology 29 (2012), 193 - 200.
Haedicke, Maximilian
Patentrecht, 5. Auflage, Köln 2021.
Haedicke, Maximilian/
Timmann, Henrik (Hrsg.)
Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, München 2020.
Hülsbergen, Kurt-Jürgen/Schmid, Harald u. a.
Umwelt- und Klimawirkungen des ökologischen Landbaus,
Berlin 2023.
Ingelbrecht, Ivan/Jankowicz-Cieslak, Joanna B. u. a.
Chemical Mutagenesis, in: Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P./Jankuloski, Ljupcho (Hrsg.), Manual on Mutation Breeding, 3. Auflage, Wien 2018, S. 51 - 82 (zitiert: Ingelbrecht/Jankowicz-Cieslak u. a. , Manual on Mutation Breeding).
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV)
Der Schutz von Pflanzensorten in der Diskussion über biotechnologische Erfindungen (Dok. UPOV/INF/11), Genf 1985.
Jestaedt, Bernhard
Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 939 - 944.
Jung, Christian/Till, Bradley
Mutagenesis and genome editing in crop improvement: perspectives for the global regulatory landscape,
Trends in Plant Science 26 (2021), 1258 - 1269.
Keine Patente auf Saatgut! e.V.
Correct legal interpretation of Article 53(b), EPC, within the
context of the EU patent directive 98/44,
http://www.no-patents-on-seeds.org/sites/default/files/news/Interpretation%20Art%2053%20%28b%29%20_NPoS_0.pdf
, abgerufen am 31.3.2024
(zitiert: Keine Patente auf Saatgut! e.V.).
Keine Patente auf Saatgut! e.V.
Einspruch gegen Mais-Patent, Pressemitteilung, https://www.no-patents-on-seeds.org/de/news/mais-patent , abgerufen am 31.3.2024 (zitiert: Keine Patente auf Saatgut! e.V., Pressemitteilung).
Keine Patente auf Saatgut! e.V.
Was muss geändert werden?, https://www.no-patents-on-seeds.org/de/hintergrund/was-muss-geaendert-werden , abgerufen am 31.3.2024 (zitiert: Keine Patente auf Saatgut! e.V., Was muss geändert werden?).
Kirchner, Ernst
Zur Frage der Wiederholbarkeit bei Pflanzenzüchtungserfindungen, GRUR 1951, 572 - 574.
Kock, Michael Andreas
Patenting non-transgenic plants in the EU, in: Matthews, Duncan/Zech, Herbert (Hrsg.), Research handbook on intellectual property and the life sciences, Cheltenham, Northampton 2017,
S. 132 - 159 (zitiert: Kock, Research handbook on intellectual property and the life sciences).
Kock, Michael Andreas
New Rules for Plants from Essentially Biological Processes, Life Science Recht 2018, 54 - 58.
Kock, Michael Andreas/Morgan, Gareth
Broccoli and Tomato: A never ending story?,
Bio Science Law Review 16(3), 123 - 128.
Kock, Michael Andreas/Zech, Herbert
Pflanzenbezogene Erfindungen in der EU – aktueller Stand,
GRUR 2017, 1004 - 1013.
Kock, Michael Andreas
G 3/19 ‘Pepper’ – Patentability of plants obtained by breeding processes. Is this the end?, Bio Science Law Review 17(5), 184 - 201.
Kozjac, Petra/Meglič, Vladimir
Mutagenesis in Plant Breeding for Disease and Pest Resistance, in: Mishra, Rajnikant (Hrsg.), Mutagenesis, Rijeka 2019, S. 195 - 219 (zitiert: Kozjac/Meglič , Mutagenesis).
Koszowski, Bartosz/Goniewicz, Maciej Łukasz u. a.
Genetycznie modyfikowany tytoń – szansaczy zagrożenie dla palaczy? / Genetically modified tobacco – chance or threat for smokers?, Przegląd Lekarski 2007, 908 - 912.
Krauß, Jan
Was sind „im Wesentlichen biologische Verfahren“? – die Entscheidung G 1/08 und G 2/07 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, MittPatAnw 2011, 279 - 283.
Kumar, Vikash/Chauhan, Anjali u. a.
Mutation Breeding in Rice for Sustainable Crop Production and Food Security in India, in: Sivasankar, Shoba/Ellis, Noel u. a. (Hrsg.), Mutation Breeding, Genetic Diversity and Crop Adaptation to Climate Change, Wollingford, Boston 2021, S. 83 - 99 (zitiert: Kumar/Chauhan, Mutation Breeding, Genetic Diversity and Crop Adaptation to Climate Change).
Lange, Peter
Die Natur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur patentfähigen Erfindung, GRUR Int. 1985, 88 - 94.
Larkin, Philip J./Scowcroft, William R.
Somaclonal Variation - a Novel Source of Variability from Cell Cultures for Plant Improvement, Theoretical and Applied Genetics 60 (1981), 197 - 214.
Malek, Olaf/Hames, Claudine
Plant patents an endangered species? –
surprising new developments in the tomato case,
epi Information 2012, 16 - 22.
Marone, Daniela/Mastrangelo, Anna Maria/Borrelli, Grazia Maria
From Transgenesis to Genome Editing in Crop Improvement: Applications, Marketing, and Legal Issues, International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(8), 7122.
Mayr, Jakob
Alter Streit um neue Gentechnik, tagesschau.de vom 5.7.2023, https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-kommission-gentechnik-100.html , abgerufen am 31.3.2024.
Mes, Peter
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: Kommentar, 5. Auflage, München 2020.
Metzger, Axel/Zech, Herbert (Hrsg.)
Sortenschutzrecht: Kommentar, München 2016
(zitiert: Metzger/Zech/Bearbeiter).
Metzger, Axel/Bartels, Marvin
Wirksamkeit und Schutzumfang von Pflanzenpatenten,
ZGE 2018, 123 - 161.
Micke, Alexander/Donini, Basilio/Maluszynski, Miroslaw
Induced Mutations for Crop Improvement,
Mutation Breeding Review 7 (1990), 1 - 41.
Moufang, Rainer
Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz,
Köln u. a. 1987.
Muller, Hermann Joseph
Artificial Transmutation of the Gene, Science 66 (1927), 84 - 87.
Neumeier, Hans
Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen,
Köln u. a. 1990.
Nielen, Stephan/Forster, Brian P. /Badigannavar, Anand
Types of Mutations, in: Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P./Jankuloski, Ljupcho (Hrsg.), Manual on Mutation Breeding, 3. Auflage, Wien 2018, S. 83 - 104 (zitiert: Nielen/Forster/Badigannavar , Manual on Mutation Breeding).
Okamura Masachika/Umemoto, Naoyuki/Onishi, Noboru
Breeding glittering carnations by an efficient mutagenesis system,
Plant Biotechnology 29 (2012), 209 - 214.
Oredsson, Tore
Biological Inventions and Swedish Patent Legislation,
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1985, 229 - 259.
Pihlajamaa, Heli
Patentierbarkeit von pflanzenbezogenen Erfindungen,
GRUR 2022, 949 - 952.
Rogge, Elke
Zur Anwendbarkeit der Grundsätze des Tollwutvirus-Beschlusses des Bundesgerichtshofs auf makrobiologische Erfindungen, insbesondere im Bereich der Pflanzenzüchtungen,
GRUR 1988, 653 - 659.
Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel
Rechtstheorie, 12. Auflage, München 2022.
Rybiński, Wojciech
Influence of Laser Beams on the variability of traits in spring barley, International Agrophysics 14 (2000), 227 - 232.
Sarsu, Fatma/Spencer-Lopes, Maria Madeleine u. a.
Specific Techniques for Increasing Efficiency of Mutation Breeding – In Vitro Methods in Plant Mutation Breeding, in: Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P./Jankuloski, Ljupcho (Hrsg.), Manual on Mutation Breeding, 3. Auflage, Wien 2018, S. 205 - 229 (zitiert: Sarsu/Spencer-Lopes u.a., Manual on Mutation Breeding).
Scarascia-Mugnozza, Gian Tommaso/D’Amato, Francesco u. a.
Mutation Breeding Programme for durum Wheat (Triticum turgidum ssp. Durum Desf.) Improvement in Italy, in: IAEA (Hrsg.), Plant Mutation Breeding for Crop Improvement Vol. 1, Wien 1991, S. 95 - 109 (zitiert: Scarascia-Mugnozza/D’Amato u. a., Plant Mutation Breeding for Crop Improvement).
Schmidt, K.A.
Warum nicht Pflanzenzüchtungspatente?, GRUR 1952, 168 - 176.
Schulte, Rainer (Hrsg.)
Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen: Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 11. Auflage, Hürth 2022 (zitiert: Schulte/Bearbeiter).
Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P. u.a.
Introduction, in: Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P./Jankuloski, Ljupcho (Hrsg.), Manual on Mutation Breeding, 3. Auflage, Wien 2018, S. 1 - 4 (zitiert: Spencer-Lopes/Forster, Manual on Mutation Breeding).
Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Jankuloski, Ljupcho u. a.
Physical Mutagenesis, in: Spencer-Lopes, Maria Madeleine/Forster, Brian P./Jankuloski, Ljupcho (Hrsg.), Manual on Mutation Breeding, 3. Auflage, Wien 2018, S. 5 - 50 (zitiert: Spencer-Lopes/Jankuloski, Manual on Mutation Breeding).
Spranger, Tade Matthias
Zur neuen ständigen Rechtsprechung des EuGH im europäischen Gentechnikrecht, EuZW 2023, 854 - 858.
Stadler, Lewis John
Mutations in Barley Induced by X-Rays and Radium,
Science 68 (1928), 186 - 187.
Stauder, Dieter/Luginbühl, Stefan (Hrsg.)
Europäisches Patentübereinkommen: Kommentar, 9. Auflage, Köln 2023 (zitiert: Singer/Stauder/Luginbühl/Bearbeiter).
Sterckx, Sigrid/Cockbain, Julian
Exclusions from patentability, Cambridge 2012.
Stevenson, Angus (Hrsg.)
Oxford Dictionary of English, 3. Auflage, Oxford 2010.
Tai, Thomas H./Chun, Areum
u. a.
Effectiveness of Sodium Azide Alone Compared to Sodium Azide in Combination with Methyl Nitrosurea for Rice Mutagenesis, Plant Breeding and Biotechnology 4 (2016), 453 - 461.
Then, Christoph
Dissenting opinion expressing disagreement with the majority opinion of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering in regard to the report on plant patents, in: EU Kommission (Hrsg.), Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering, 17. Mai 2016, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18604/ , abgerufen am 31.3.2024 (zitiert: Then, Dissenting Opionion).
Todd, Albert John
Performance of disease resistant peppermint mutants in the USA, Mutation Breeding Newsletter 36 (1990), 14 - 15.
Tollenaar, Dirk
Untersuchungen über Mutation bei Tabak,
Genetica 20 (1938), 285 - 294.
Udage, Ashan Chathuranga
Introduction to plant mutation breeding: Different approaches and mutagenic agents, The Journal of Agricultural Sciences –
Sri Lanka 16 (2021), 466 - 483.
van de Wiel, Clemens/Schaart, Jan u.a.
Traditional Plant Breeding Methods, Wageningen 2010.
van Harten, Anton M.
Mutation Breeding, Cambridge 1998.
Voigt, Brigitte
Genomediterung = Gentechnik, Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 25.7.2018 – C-528/16, ZLR 2018, 654 - 663.
von Pechmann, Eckehart
Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente,
GRUR 1985, 717 - 725.
von Pechmann, Eckehart
Ausschöpfung des bestehenden Patentrechts für Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen- und Tierzüchtung unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs – Tollwutvirus,
GRUR 1987, 475 - 481.
Wanner, Bettina/Monconduit, Hervé u. a.
CJEU renders decision on the interpretation of the GMO Directive, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2019, 90 - 92.
Zech, Herbert
Noch nicht ausführbare Erfindungen – Patentschutz für Zukunftstechnologien?, ZGE 2010, 314 - 330.
Zech, Herbert
Life Sciences and Intellectual Property: Technology Law Put to the Test, ZGE 2015, 1 - 14.
Zech, Herbert
Einführung in das Technikrecht, Trier 2021.
A. Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Forschungsfrage, inwieweit Pflanzen patentierbar sind, die mit dem Pflanzenzüchtungsverfahren der Zufallsmutagenese gewonnen wurden. Es gibt mehrere Gründe, sich mit diesem Thema zu befassen:
Am 5. Juli 2023 hat die Europäische Kommission (Kommission) einen Vorschlag für eine Verordnung zur Regulierung von Pflanzen, die mit bestimmten Verfahren neuer genomischer Techniken (NGT) gewonnen wurden (sog. NGT-Pflanzen), veröffentlicht. [1] Dadurch wurde die Debatte um Patente auf Pflanzen neu entfacht, [2] da diese NGT-Pflanzen de lege lata unstrittig patentierbar sind. [3]
Die Erteilung von Patenten auf Pflanzen, die mittels Zufallsmutagenese erzeugt werden, wird hingegen zum Teil als rechtswidrig kritisiert, [4] und es wird gefordert, dass die Erteilung von derartigen Patenten durch legislative Klarstellungen künftig verhindert wird. [5] Tatsächlich hat sich das Europäische Parlament (Parlament) in den Änderungsanträgen zum Verordnungsvorschlag für NGT-Pflanzen jüngst für ein Verbot der Patentierung u. a. von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen ausgesprochen. [6]
Das Thema der Patentierbarkeit von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen wurde in jüngerer Vergangenheit auch in Deutschland diskutiert: So gab es etwa einen ausführlichen Meinungsaustausch zwischen Patentrechtsexpertinnen und -experten beim Symposium „Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren – Gestaltungsspielräume und Reformbedarf?“ am 8. Juli 2021 im Bundesjustizministerium (BMJV). Dieser Meinungsaustausch wurde in einem Vermerk des BMJV festgehalten, den der Verfasser infolge eines Antrags nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat. Er ist dieser Arbeit auszugsweise als Anhang mit freundlicher Genehmigung des BMJV beigefügt und wird auch an verschiedenen Stellen referenziert.
In der Arbeit werden zunächst die biologischen Grundlagen und die Bedeutung der Pflanzenzüchtung mittels Zufallsmutagenese (auch „ungerichtete Mutagenese“ genannt), gewissermaßen einer Jahrzehnte alten Form der Gentechnik[7], für die (ökologische) Landwirtschaft dargestellt (B.). Anschließend wird der Zusammenhang zwischen der Diskussion um Patente auf Pflanzen und der Debatte über die Regulierung der (Agro-)Gentechnik aufgezeigt und zugleich beide Regelungsmaterien voneinander abgegrenzt (C.).
In ihrem Hauptteil beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage der Patentierbarkeit der mittels Mutagenese erzeugten Pflanzen (D.). Dabei wird anhand generisch gehaltener Erwägungen dargestellt, inwieweit solche Pflanzen die für die Patentierung nötigen Tatbestandsmerkmale erfüllen, wobei die im Schrifttum geäußerten Kritikpunkte an der Patentierungspraxis innerhalb der jeweiligen Tatbestandsmerkmale thematisiert werden. Dabei geht es unter anderem um die Tatbestandsmerkmale der Erfindung und der erfinderischen Tätigkeit. Der zentrale Fokus wird indes auf die Interpretation der Ausschlussvorschrift in Art. 53 lit. b) S. 1 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) zu „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ gelegt, wobei auch die relevante einschlägige Rechtsprechung nachgezeichnet wird (D. III.). Anschließend wird die Arbeit auch darauf eingehen, ob die Rückausnahme des Art. 53 lit. b) S. 2 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) [8] beim Einsatz von in vitro durchgeführter Zufallsmutagenese von Bedeutung sein kann. (D. III. 3.)
Zu guter Letzt wird erörtert, inwieweit mittels Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen durch Verfahrenspatente auf entsprechende Züchtungsverfahren geschützt werden können. (E.)
Die Arbeit endet schließlich mit einem Fazit (F.).
B. Zufallsmutagenese und ihre Bedeutung in der Landwirtschaft
Zunächst sollen die Grundlagen der Zufallsmutagenese in allgemeinverständlicher Art und Weise dargestellt und die Bedeutung dieser Technik für die heutige Landwirtschaft dargestellt werden.
I. Definition und Grundlagen der Mutagenese
Mutationen sind vererbliche Veränderungen im genetischen Material eines Organismus, die zu neuen, ebenfalls vererbbaren Eigenschaften des Organismus führen und damit einen Motor der Evolution darstellen. [9] Solche Mutationen entstehen natürlicherweise beispielsweise bei Fehlern in der Replikation der Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder durch natürliche Strahlung. [10] Diese Spontanmutationen entstehen allerdings recht selten – in jeder Generation einer Pflanze pro Ort im Genom nur etwa 1x10 -5 bzw. 1x10 -8 mal. [11] Man geht davon aus, dass solche Spontanmutationen überwiegend negative Effekte haben, andererseits haben die mutierten Nachkommen manchmal auch züchterische Vorteile, die sich bereits unsere Vorfahren durch entsprechende Selektion für die Weiterzüchtung unbewusst zu Nutze gemacht haben. [12] So wurde der Mais, wie wir ihn heute kennen, über tausende Jahre durch eine Ansammlung von Spontanmutationen aus der Ursprungspflanze Teosinte entwickelt. [13]
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts formulierte der Botanikprofessor Hugo de Vries die folgende Vision: „Die Kenntnis der Gesetze des Mutirens wird voraussichtlich später einmal dazu führen, künstlich und willkürlich Mutationen hervorzurufen und so ganz neue Eigenschaften an Pflanzen und Thieren entstehen zu lassen.“ [14] In den späten 1920er Jahren konnte dann sowohl in Fruchtfliegen[15], als auch in Mais und Gerste [16] festgestellt werden, dass die Einwirkung von ionisierender Strahlung auf diese Organismen eine mutationsauslösende Wirkung hat. [17] Wie man heute weiß, wird durch den Einsatz derartiger Mutagene das Vorkommen von Mutationen bis zu 1000-fach erhöht. [18]
Züchterische Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Mitte der 1930er Jahre wurde in Indonesien mit der Tabaksorte „Chlorina“ erstmals eine Sorte auf den Markt gebracht, die durch mittels Strahlung künstlich induzierten Mutationen gezüchtet wurde. [19]
Die künstliche Erzeugung zufälliger Mutationen durch mutagene Agenzien wird als Zufallsmutagenese bezeichnet, während das Ergebnis eine Mutante ist, also eine Pflanze mit einer oder mehreren Mutationen, deren Nutzung für die Züchtung dann auch als Mutationszüchtung bezeichnet wird. [20] Es sind die mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen, um die es in dieser Masterarbeit gehen soll, während sowohl natürlich spontan mutierte Pflanzen sowie mittels NGT gezielt mutierte Pflanzen nicht Gegenstand der Ausführungen sind.
II. Praktische Durchführung der Zufallsmutagenese
Die Zufallsmutagenese läuft im Wesentlichen so ab, dass zunächst eine sorgfältige Auswahl des zu mutierenden Pflanzenmaterials getroffen wird, dann die Anwendung des mutagenen Agens stattfindet und danach ein Screening und eine Auswahl der mutierten Pflanzen über mehrere Generationen hinweg erfolgen. [21] Zwar ermöglichte das Aufkommen von Werkzeugen zur DNA-Analyse das Screening nach Genotypen, wodurch die Entdeckung von Mutationen und die Entwicklung mutierter Linien beschleunigt wurde. [22] Aber schon der erste Schritt der Auswahl des zu mutierenden Materials kann weiterhin sehr aufwendig sein: So musste zur Entwicklung einer schillernden Nelke etwa der Genotyp von über 1500 Nelkenlinien analysiert werden, bis nach mehreren Selektionsschritten endlich die eine Linie gefunden wurde, an der die Mutagenese durchgeführt werden sollte. [23]
Die auch negativen Folgen der künstlichen Herbeiführung von Mutationen müssen häufig durch weitere Kreuzungsschritte abgemildert oder beseitigt werden, denn es kommt eher selten vor, dass so genannte Direktmutanten, also Pflanzen, die ohne weitere Kreuzungen nach dem Mutageneseschritt gewonnen werden, letztlich zu der Sorte führen, die in den Verkehr gebracht werden. [24]
Als Mutagen ist die Gammastrahlung am weitesten verbreitet, jedoch gibt es neben weiteren ionisierenden Strahlenarten wie Röntgen- oder Partikelstrahlen (z. B. Betastrahlung) auch nicht-ionisierende Strahlen wie UV-Strahlung, darüber hinaus auch chemische mutagene Agenzien, insbesondere Alkylierungsmittel, z. B. das bekannte Ethylmethansulfonat (EMS), Basenanaloga wie etwa 5-Chloruracil oder Acridinfarbstoffe, zu denen das Acridinorange gehört. [25] Es gibt auch in der Zufallsmutagenese mitunter neue Entwicklungen: So wurde etwa um die Jahrtausendwende vom erfolgreichen Einsatz von Helium-Neon-Lasern berichtet, um phänotypisch wirksame Mutationen in Gerste hervorzurufen. [26]
Generell ist festzustellen, dass unterschiedliche physikalische und chemische mutagene Agenzien leicht unterschiedliche Arten von Mutationen hervorrufen. [27] Das gilt auch, wenn man etwa nur chemische Agenzien vergleicht: So wurde herausgefunden, dass bei der Anwendung von EMS mehr als 99% der Mutationen eine Umwandlung der Basenpaare von Guanin-Cytosin zu Adenin-Thymin darstellen, wobei es eine gewisse örtliche Präferenz gibt, was die direkte Nachbarschaft der mutierten Guanin-Base anbelangt. [28] Während beim Einsatz von Natriumazid als Mutagen die vorherrschende Art der Mutation dieselbe ist wie beim Einsatz von EMS, ist die örtliche Präferenz mit Blick auf die direkte Nachbarschaft der Guanin-Base eine andere, weshalb vorgeschlagen wird, dass es das Spektrum an Mutationen und Phänotypen vergrößern würde, wenn man Mutanten kombinieren würde, die jeweils mit einem anderen Mittel behandelt worden sind. [29]
Der Einsatz der Zufallsmutagenese erfordert in jedem Falle genaue Überlegungen: Die züchtende Person muss bei der Verwendung von Strahlung etwa bestimmen, wie sie die meisten nützlichen Mutationen hervorruft, ohne die Vermehrungsfähigkeit der Pflanze zu zerstören und ohne zu viele unerwünschte Mutationen zu erzeugen. [30] Dabei ist es so, dass unterschiedliche Pflanzenteile verschieden auf Strahlung reagieren und die Reaktion auf zellularer Ebene sehr von den physiologischen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Bestrahlung abhängig ist, aber auch von den Bedingungen vor und nach der Bestrahlung. [31] So haben etwa die Präsenz von Sauerstoff oder der Wassergehalt einen großen Einfluss auf die Wirkung der Bestrahlung – Sauerstoff etwa sorgt für eine bis zu 100-fache Vergrößerung der Strahlenschäden. [32]
Auch bei der chemischen Mutagenese muss die züchtende Person testen, welche Dosis, also welche Konzentration des mutagenen Agens (oder der Kombination mutagener Agenzien) in welcher Dauer auf das Pflanzenmaterial einwirken und welche Temperatur vorherrschen sollte, da diese ebenfalls großen Einfluss auf den Verlauf hat. [33]
Seit den 1960er Jahren werden in der Pflanzenzüchtung In-vitro-Methoden unter anderem in Gestalt der Gewebe- und Zellkulturen eingesetzt. [34] In den 1970er Jahren wurde schließlich auch die In-vitro- Zufallsmutagenese zunehmend populär, da sie einige Vorteile bietet wie eine Platzersparnis, eine In-vitro-Selektion von Mutanten sowie einheitliche und sehr gute phytosanitäre Bedingungen. [35] Mehr als 90 Prozent der in den Verkehr gebrachten In-vitro-Mutagenesesorten gehen auf Strahlungsmutagenese zurück. [36] Der Begriff der In-vitro-Mutagenese wird mitunter nicht nur dann verwendet, wenn die eigentliche Mutagenese in vitro stattfindet, sondern auch, wenn nur in vitro durchgeführte Verfahrensschritte nach der eigentlichen Mutagenese erfolgen (z. B. nur der Selektionsprozess in vitro stattfindet). [37] Im Folgenden meint die In-vitro-Mutagenese jedoch die Anwendung des Mutagens in vitro an Pflanzenzellen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Effekte der Mutagene auf die DNA bei einer Anwendung in vitro nicht von der Anwendung in vivo unterscheiden und die Art der Mutationen eines bestimmten Mutagens ebenfalls dieselben bleiben. [38] Daher können die verschiedenen physikalischen und chemischen Mutagene gleichermaßen in vivo als auch in vitro angewandt werden – lediglich die Dosis, die Dauer der Exposition und das experimentelle Setting mögen sich dabei unterscheiden. [39] Allerdings treten in Zellkulturen zusätzlich auch so genannte somaklonale Variationen, also weitere genetische Veränderungen auf. [40]
III. Hohe landwirtschaftliche Bedeutung der Zufallsmutagenese
Mithilfe der Zufallsmutagenese konnten Verbesserungen der Eigenschaften vieler Pflanzen erreicht werden, wie z. B. Krankheitsresistenzen, größerer Ertrag, Kältetoleranz, frühere Reifung oder optimiertes Wachstum. [41] Ein extrem erfolgreiches Beispiel für die Züchtungsmethode der Zufallsmutagenese war die Entwicklung der Gerstensorte Diamant, die 1965 in der damaligen Tschechoslowakei in den Verkehr gebracht wurde und einen um 11% höheren Ertrag erzielte, als die bereits sehr ertragreiche Elternpflanze. [42] Durch weitere Züchtung entstand daraus die Sorte Trumpf, die im Jahre 1975 70% der gesamten Gerstenfläche in der DDR ausmachte. [43] Ein weiteres Beispiel bildet die Mutationszüchtung von Hartweizen in Italien: Die Kreuzung zwischen der Mutationslinie Cp B144 und einer anderen Linie brachte die Sorte Creso hervor, die 1990 bereits 58% der Hartweizen-Anbaufläche Italiens ausmachte. [44] Es wurde Anfang der 1990er Jahre kalkuliert, dass diese Sorte einen ökonomischen Mehrwert von 180 Millionen Dollar jährlich erbrachte, während das Mutationsprogramm selbst nur einen einstelligen Millionenbetrag kostete. [45] Aus dem Bereich der vegetativ vermehrten Pflanzen ist zum einen das Beispiel der Grapefruit-Sorte Star Ruby zu nennen, die nach ihrer Einführung Anfang der 1970er Jahre in allen Hauptanbaugebieten in großem Stil angepflanzt wurde. [46] Ebenfalls erwähnenswert ist das Beispiel der durch Strahlung gezüchteten Pfefferminzsorten Todd’s Mitcham und Murray Mitcham zu nennen, die gegen die Pilzkrankheit Verticillium-Welke resistent sind und 1989 in den USA mehr als 50% der Anbaufläche für Pfefferminz ausmachten. [47] Die Zufallsmutagenese wurde auch als Mittel zur Bewältigung akuter pflanzengesundheitlicher Problemsituationen eingesetzt: Im Jahre 1999 hatte eine neue Form des Getreideschwarzrostes den Weizen in Uganda befallen, der seinerzeit keinerlei Resistenzen aufwies, woraufhin ab dem Jahre 2009 international Anstrengungen zur Resistenzzüchtung mittels Zufallsmutagenese erfolgten, was nur gut vier Jahre später zur Zulassung einer neuen Sorte führte, die gegen diesen Getreideschwarzrost resistent war. [48]
Die Bedeutung der Zufallsmutagenese auch für die heutige Landwirtschaft resultiert jedoch nicht nur aus diesen Erfolgsgeschichten, sondern auch aus der technischen Entwicklung in der Pflanzenzüchtung im Bereich von NGT: Im Ökolandbau wird der Einsatz von NGT voraussichtlich bis auf Weiteres verboten bleiben – das Parlament hat den das Verbot statuierenden Art. 5 Abs. 2 des eingangs erwähnten Verordnungsvorschlages der Kommission in erster Lesung jedenfalls unangetastet gelassen. Die Zufallsmutagenese hingegen ist nach der europäischen Öko-Verordnung [49] zugelassen als Züchtungsmethode in der ökologischen Produktion, da zwar die Verwendung von genetisch veränderten Organismen (GVO) in Art. 11 verboten ist, GVO in Art. 3
Nr. 58 hier abweichend aber so definiert sind, dass durch Zufallsmutagenese erzeugten Organismen davon nicht erfasst werden. [50] Zwar ist einschränkend zu bemerken, dass nach den privatrechtlichen Norms for Organic Production and Processing des Dachverbandes International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) die Zufallsmutagenese im Rahmen der ökologischen Pflanzenzüchtung strikt verboten ist, [51] während Landwirte zumindest unter bestimmten Umständen allerdings auch auf derart gezüchtete Sorten zurückgreifen dürfen. [52] In Deutschland indes ist ohnehin nur knapp die Hälfte der ökologisch produzierenden Landwirtschaftsbetriebe in einem Anbauverband organisiert, [53] für die anderen gelten also nur die die Zufallsmutagenese nicht einschränkenden Vorgaben der europäischen Öko-Verordnung. Da der Ertragsunterschied zwischen konventionellem und ökologischem Landbau schon jetzt (ohne Einsatz von NGT-Pflanzen im konventionellen Landbau) erheblich ist, wird es als für den Ökolandbau strategisch essenziell angesehen, dass dieser seine Erträge steigert. [54] Da die seit Jahrzehnten praktizierte Zufallsmutagenese auch aktuell immer wieder neue Sorten mit agronomisch vorteilhaften Eigenschaften hervorbringt, [55] ist davon auszugehen, dass sich die Bedeutung dieser Züchtungsmethode als eines der Tools im Werkzeugkasten insbesondere der Öko-Züchterinnen und Öko-Züchter vergrößern wird. Dementsprechend wird es als Aufgabe der Mutationszüchtung angesehen, mutierte Pflanzen auch für die ökologische Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. [56] Nicht vergessen werden darf schließlich, dass die Methoden der Zufallsmutagenese regelmäßig keinen Patentschutz (mehr) genießen, NGT hingegen schon, was zu erheblich höheren Kosten führen kann. [57] Hinzu kommt, dass NGT den Pflanzenzüchterinnen und Pflanzenzüchtern in vielen Ländern aufgrund von rechtlichen Beschränkungen derzeit gar nicht zur Verfügung stehen. [58] Außerdem setzt der Einsatz von Genomeditierungstechniken im Gegensatz zur Zufallsmutagenese voraus, dass bereits bekannt ist, welche Gene verändert werden müssen. [59]
IV. Aktuelle Patenterteilungen auf durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen
Auch in der aktuellen Patenterteilungspraxis spielen durch Zufallsmutagenese erzeugte bzw. laut Beschreibung erzeugbare Pflanzen eine Rolle. Beispiele für in letzter Zeit erteilte europäische Patente, die sich mit dem Online-Suchportal Espacenet des Europäischen Patentamtes (EPA) finden lassen, sind unter anderen:
· Melonenpflanzen, in denen das Gen MELO3C009603 inaktiviert wurde, was erhöhte Fruchterträge zur Folge hat (Europäisches Patent EP3116301 erteilt am 28.12.2022);
· Tomaten mit veränderten Pflanzenhaaren, damit sich dort Milben als biologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahme ansiedeln können, wobei diese Eigenschaft auf Mutationen im SImyc2-Gen zurückzuführen ist (Europäisches Patent EP3182820 erteilt am 5.10.2022);
· Weihnachtssterne mit weißer Blattfarbe, die auf die Mutation des GST-Gens zurückzuführen ist (Europäisches Patent EP3747263 erteilt am 1.11.2023);
· Pflanzen der Gattung Brassica, die durch chemische Zufallsmutagenese von Wildpflanzen eine Herbizidtoleranz erhalten haben (Europäisches Patent EP3243905 erteilt am 16.11.2022);
· Gerste, deren LOX-1-Gen z. B. durch chemische Zufallsmutagenese so verändert wurde, dass das Lipoxygenase-Enzym defekt ist und dadurch ein geschmacklich besseres Bier erzeugt werden kann (Europäisches Patent EP1727905 erteilt am 23.11.2022) sowie
· Weizen, der seinen hohen Stärkegehalt durch Mutationen in den SBEII-Genen erhalten hat (Europäisches Patent EP3539372 erteilt am 3.11.2023).
Derzeit ist unter anderem ein Einspruchsverfahren in Bezug auf das am 15.6.2022 erteilte europäische Patent EP3560330 anhängig, das sich u. a. auf Maispflanzen mit verbesserter Verdaulichkeit erstreckt, die diese Eigenschaft durch eine Mutation des F35H-Gens erhalten, welche laut Beschreibung auch durch Zufallsmutagenese erreicht werden kann. [60] Ein Einspruch gegen das Patent EP2966992 auf Blattsalatsamen, deren Keimfähigkeit bei hohen Temperaturen auf einer durch Zufallsmutagenese induzierten Genmutation beruhen, wurde infolge der mündlichen Verhandlung vom 7.2.2024 von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen. [61]
Nationale Patenterteilungen auf Pflanzenerfindungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt spielen im Übrigen so gut wie gar keine Rolle. [62]
C. Verzahnung der Debatten um Gentechnikrecht und Patente auf Pflanzen
Zur Kontextualisierung des Themas soll anhand der jüngeren Geschichte verdeutlicht werden, wie eng die Debatten um das Gentechnikrecht und das Patentrecht miteinander verzahnt sind.
I. Situation bis 2018
Infolge des Aufkommens von NGT war teilweise angenommen worden, dass genomeditierte, also z. B. gezielt mutierte Organismen keine GVO seien, soweit diese auch natürlich entstehen könnten. [63] Daher kam es teilweise zur Verflechtung von Argumentationen aus den beiden Rechtsgebieten: Die argumentativ hervorgehobene „Natürlichkeit“ von Organismen mit bestimmten durch Genomeditierung erzeugten genetischen Veränderungen wurde bisweilen nämlich als Gegensatz zur Technizität als Voraussetzung für die Erteilung von Patenten ins Feld geführt. [64]
Im Jahre 2018 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese vermeintliche Dichotomie [65] allerdings aufgelöst, indem er entschieden hat, dass alle mittels Verfahren oder Methoden der Mutagenese erzeugten Organismen GVO im Sinne der Definition in Artikel 2 Nr. 2 der Richtlinie 2001/18/EG [66] sind. [67] Gleichzeitig entschied er, dass (nur) die Organismen, die mit Verfahren oder Methoden der Mutagenese erzeugt wurden, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit langem als sicher gelten, gem. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/18/EG vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen sind. [68] Damit wurde klargestellt, dass die mit den seit langem angewandten Verfahren der Zufallsmutagenese erzeugten Organismen zwar per definitionem GVO, aber vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2001/18/EG und de facto vom ganzen europäischen Gentechnikrecht ausgenommen sind. [69] Demgegenüber führt jedwede Form der Genomeditierung von Organismen zu deren Einordnung als gentechnikrechtlich regulierte GVO. [70] Im Jahre 2023 schließlich hat der EuGH in einem Folgeurteil [71] die Reichweite der gentechnikrechtlichen Ausnahmevorschrift für durch Mutagenese erzeugte Organismen weiter präzisiert. [72]
II. Situation nach dem EuGH-Urteil von 2018
Das gentechnikrechtliche Grundsatzurteil des EuGH aus dem Jahr 2018 sorgte für eine Reaktion der europäischen Gesetzgebungsorgane. Beauftragt durch den Rat der Europäischen Union [73] legte die Kommission eine Studie zum Status neuartiger genomischer Verfahren im Unionsrecht vor, in der sie schlussfolgerte, dass das bestehende Gentechnikrecht für bestimmte NGT und ihre Produkte nicht zweckmäßig ist und dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt angepasst werden muss. [74] Die Kommission veröffentlichte sodann am 5.7.2023 einen Vorschlag für eine Verordnung zu NGT-Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel. [75] Kern des Vorschlages ist es, NGT-Pflanzenzüchtungen, soweit sie anhand gesetzlich fixierter Kriterien bezogen auf Art und Umfang der genetischen Veränderungen als äquivalent zu herkömmlichen Pflanzenzüchtungen angesehen werden können, aus dem Anwendungsbereich des Gentechnikrechts herauszunehmen (Art. 5 Abs. 1, Art. 3 Nr. 7). Diese Äquivalenz ist lediglich in einem schlanken Verfahren anhand gesetzlich definierter Kriterien behördlich festzustellen, und dann kann (vorbehaltlich der Einhaltung anderer einschlägiger Vorschriften) ein Inverkehrbringen solcher Pflanzen erfolgen (Art. 4 Abs. 1, Art. 7).
III. Aktuelle Diskussion um Patente auf Pflanzen
Dieser Verordnungsvorschlag hat die Diskussionen über die Patente auf Pflanzen neu entfacht, [76] obwohl er zunächst gar keine Regelung zum Patentrecht enthielt. In der Begründung des Vorschlages erwähnt die Kommission jedoch, dass Interessenvertretungen aus dem Bereich der Pflanzenzucht und Bauernverbände angemahnt hätten, dass der Zugang von Züchtenden zu patentiertem genetischem Material und der Zugang der Landwirtinnen und Landwirte zu Pflanzenvermehrungsmaterial aus NGT-Pflanzen sichergestellt werden müsse, da bestimmte NGT-Pflanzen nicht von herkömmlich gezüchteten Pflanzen zu unterscheiden seien. [77] Der Verordnungsvorschlag ist teilweise auf scharfe Kritik gestoßen – in der öffentlichen Debatte wurde behauptet, er hebele das Vorsorgeprinzip aus, und die Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen würde ein „Riesenproblem“ für kleine Züchtende und Landwirtinnen und Landwirte darstellen. [78] Mitunter wird ungeachtet des genannten EuGH-Urteils aus dem Jahre 2018 weiterhin argumentiert, dass die Erzeugnisse konventioneller Pflanzenzüchtung nicht patentierbar seien, gentechnische Verfahren bzw. deren Produkte hingegen schon. [79] Es wird auch spekuliert, dass die (deklaratorische) Regelung in Art. 3 Nr. 2 des Verordnungsvorschlages, wonach NGT-Pflanzen genetisch veränderte Pflanzen, also GVO im Sinne des Gentechnikrechts seien, eingefügt worden sei, um die Patentierbarkeit zu gewährleisten. [80] Ferner wird eine Kausalität dergestalt angenommen, dass die vorgeschlagene Lockerung des Gentechnikrechts für NGT-Pflanzen einer zunehmenden Patentierung Tür und Tor öffne. [81]
Es ist somit festzustellen, dass gerade in den aktuellen politischen Debatten die Rechtsbereiche des Patentrechts und des Gentechnikrechts vermischt werden. [82] Dies hat Auswirkungen auch auf das Gesetzgebungsverfahren: Das Parlament hat sich am 7.2.2024 in erster Lesung dafür ausgesprochen, dass Bestimmungen (Art. 4a bzw. Art. 33a Nr. 1 lit. a)) in den Verordnungsvorschlag der Kommission aufgenommen werden, wonach NGT-Pflanzen und deren Teile ebenso wie durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen nicht patentierbar sein sollen und dafür auch die Richtlinie 98/44/EG entsprechend geändert werden soll. [83] Begründet wird dies ausweislich der eingefügten Erwägungsgründe 1a und 45a damit, dass vor dem Hintergrund einer Monopolstellung großer Unternehmen im Bereich des Saatgutes die Patentierung von Erzeugnissen neuer genomischer Techniken verboten werden müsse, um die Handlungsfreiheit der Landwirtinnen und Landwirte zu schützen und eine Abhängigkeit von privaten Unternehmen zu verhindern. Das umfassende Züchtungsprivileg im Sortenschutz sichere dabei den Zugang zu genetischem Material am besten.
IV. Gründe für Differenzierung zwischen Patent- und Gentechnikrecht
Die sozioökonomischen Erwägungen des Parlaments sollen an dieser Stelle nicht bewertet werden, wohl soll aber die nun auch seitens des EU-Gesetzgebers betriebene Vermischung der Rechtsgebiete Gentechnikrecht und Patentrecht kommentiert werden.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Leopoldina haben bereits darauf hingewiesen, dass das europäische Gentechnikrecht als Nutzungserlaubnisrecht und das Patentrecht als einem Nutzungsausschließungsrecht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. [84] Patentierungsvoraussetzungen sind unabhängig von den regulatorischen Anforderungen an GVO. [85] Eine Patentierung von NGT-Pflanzen könnte bei Vorliegen der jeweiligen Patentierungsvoraussetzungen daher auch beim Beibehalten des gentechnikrechtlichen Status Quo erfolgen. Zwar können nicht jegliche Zusammenhänge zwischen dem Gentechnikrecht und dem Patentrecht geleugnet werden. Immerhin können beide Rechtsgebiete dem Technikrecht zugeordnet werden, wobei das Patentrecht die Entwicklung von Technologie und ihre Verbreitung positiv beeinflusst und das Gentechnikrecht die inhärenten Risiken dieser spezifischen Technologie einhegt, indem sie deren Anwendung steuert. [86] Trotzdem sind unterschiedliche Ebenen berührt: Beim Patentrecht geht es um die Entwicklung neuer Technologien, und beim technischen Sicherheitsrecht – hier in Gestalt des Gentechnikrechts –, geht es um die Anwendung von Technik. [87] Dies spricht im Grundsatz durchaus für eine getrennte Behandlung. Hinzu kommt, dass der Verordnungsvorschlag der Kommission gemäß Erwägungsgrund 10 von dem Ansinnen getragen ist, die Entwicklung und das Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen und ihren Erzeugnissen zu ermöglichen – er soll also nicht nur ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für die Umwelt gewährleisten, sondern auch den Einsatz dieser Technik fördern. Eine solche Förderungsfunktion kommt auch Patenten zu [88] – Patente in diesem Bereich im selben Atemzug verbieten zu wollen, hätte also einen tendenziell gegenläufigen Effekt. Zudem wird damit die Technikneutralität des Patentrechts weiter beschnitten, obwohl gerade sie gewährleisten soll, dass am Markt bzw. in der Praxis über die Nützlichkeit einer Technik entschieden wird. [89] Zu berücksichtigen ist auch, dass das EPÜ von den Patentverbotsvorschriften des in der legislativen Diskussion befindlichen Verordnungsvorschlages nicht direkt betroffen wäre, und dessen Verbotsvorschriften allein die Rechtslage nicht umfassend ändern könnten. [90]
All das spricht dafür, die beiden Regelungskreise voneinander unabhängig zu diskutieren. Es sollte die von der Kommission angekündigte breitere Marktanalyse, in der die Auswirkungen analysiert werden, die die Patentierung von Pflanzen und nötige Lizensierungen auf die Innovation in der Pflanzenzüchtung und den Zugang von Züchtern zu genetischem Material haben[91], abgewartet werden, bevor patentrechtliche Fakten geschaffen werden.
D. Patentierbarkeit von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen
Bevor auf die Einzelfragen eingegangen wird, sei zunächst knapp die Systematik der unterschiedlichen im Folgenden zitierten Vorschriften erläutert: Das europäische und das deutsche Patentrecht sind eng verwoben und entsprechen einander weitgehend. [92] Das EPÜ ist ein internationales Übereinkommen, das detaillierte patentrechtliche Regelungen enthält und ermöglicht, durch eine einzige Anmeldung beim EPA ein in allen 38 Mitgliedstaaten des EPÜ gültiges (europäisches) Patent zu erhalten. [93] Die Wirkungen dieses so genannten Bündelpatents richten sich dagegen überwiegend dem jeweiligen nationalen Patentrecht [94] – in Deutschland also insbesondere nach dem Patentgesetz (PatG)[95]. Die Ausführungsordnung zum EPÜ (AOEPÜ) [96] ist gem. Art. 164 Abs. 1 EPÜ Bestandteil des EPÜ, wobei die Bestimmungen des EPÜ gem. Art. 164 Abs. 2 EPÜ bei mangelnder Übereinstimmung den Regeln der AOEPÜ vorgehen. Die AOEPÜ sorgt für erforderliche Konkretisierungen des EPÜ und für eine gewisse Flexibilität. [97] Wichtig ist zudem noch die europäische Biotechnologierichtlinie 98/44/EG[98], die den EU-Mitgliedstaaten gem. Art. 1 Abs. 1 Vorgaben für das nationale Patentrecht mit Blick auf biotechnologische Erfindungen macht. Gem. Regel 26 Abs. 1 S. 2 AOEPÜ ist die Richtlinie 98/44/EG ergänzend zu den Vorschriften der AOEPÜ für Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, heranzuziehen. Aufgrund dieser Verflechtungen werden im Folgenden auch alle diese Vorschriften zitiert. Am 1.6.2023 ist zudem das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht [99] in Kraft getreten. [100] Seitdem gibt es die Möglichkeit der Erteilung europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten. [101] Da die damit verbundenen neuen Regelungen keine Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen haben, finden sie hier allerdings keine weitere Erwähnung.
I. Allgemeine Patenterteilungsvoraussetzungen
In diesem Abschnitt wird erörtert, inwieweit Pflanzen, die mittels Zufallsmutagenese erzeugt werden, die allgemeinen patentrechtlichen Voraussetzungen erfüllen können. Gem. Art. 52 Abs. 1 EPÜ und § 1 PatG werden Patente erteilt für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Aus Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 98/44/EG bzw. Regel 26 Abs. 1 S. 1 der AOEPÜ ergibt sich, dass europäische Patente auch biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben können. Diese Erfindungen werden in Regel 26 Abs. 2 AOEPÜ definiert als Erzeugnisse, die aus biologischem Material bestehen oder dieses enthalten bzw. als Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird. Biologisches Material wiederum ist gem. Art. 2 Abs. 1 lit. a) Richtlinie 98/44/EG bzw. Regel 26 Abs. 3 AOEPÜ jedes Material, das genetische Information enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Das deutsche Recht regelt entsprechendes in § 1 Abs. 2 S. 1 PatG in Verbindung mit § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG. Dass Pflanzen grundsätzlich patentierbar sind, ergibt sich zudem auch ganz explizit aus Art. 4 Abs. 2 RL 98/44/EG, Regel 27 lit. b) AOEPÜ und § 2a Abs. 2 Nr. 1 PatG. Für die Patentierbarkeit im konkreten Fall müssen die im folgenden genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, und es dürfen keine Ausschlussgründe greifen.
1. Erfindung
Der Begriff der Erfindung ist nicht legaldefiniert, jedoch wird der erste Leitsatz der Rote-Taube-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) als gängige Definition für den Anwendungsbereich einer patentfähigen Erfindung angesehen. [102] Danach kann für „eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“ Patentschutz erteilt werden. [103] Dieser Ansatz wurde vom BGH in der Folge bestätigt und weiter ausdifferenziert. [104] Es wird dem folgend vielfach angenommen, dass Erfindungen einen schöpferischen Charakter haben, also etwas Neues schaffen müssen, das zugleich Gegenstand einer technischen Lehre sein muss. [105] Diese technische Lehre muss dabei praktische Anweisungen für die Fachperson geben, wie eine bislang nicht gelöste Aufgabe oder Problemstellung mit eindeutig bestimmten Mitteln gelöst werden kann. [106]
Die Schaffung einer Kulturpflanze, die eine bestimmte agronomische Eigenschaft aufweist wie z. B. die Steigerung des Ertrages, eine erhöhte Krankheitsresistenz o. Ä. (Schöpfung), kann daher mit einer für Fachpersonen hinreichenden Beschreibung durch welche und auf welchem Weg erzeugte Mutation im Genom diese Eigenschaft erhalten wurde (technische Lehre), das Merkmal der Erfindung erfüllen.
a) Technizität
Dass eine Erfindung nur im Bereich der Technik patentiert werden kann, ergibt sich aus dem Wortlaut von § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ, wonach Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt werden. Auch als dies im PatG noch nicht explizit niedergelegt war, wurde die Technizität einer Erfindung stets vorausgesetzt: [107] Der BGH hat dies seinerzeit unter anderem aus der Tatsache hergeleitet, dass schon damals im Gesetz niedergelegt war, dass am Patentamt und am Patentgericht die so genannten technischen Mitglieder in einem Zweig der Technik sachverständig sein müssen. [108] Nach verbreiteter Auffassung ist das Merkmal der Technizität im Erfindungsbegriff enthalten und manifestiert sich in der bereits erwähnten „Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs“. [109] Es scheint danach kaum möglich, das Merkmal der Technizität von dem Begriff der Erfindung zu trennen. [110] Selbst soweit die Technizität in der Literatur als eigenständiges Tatbestandsmerkmal einer patentierbaren Erfindung angesehen wird, [111] wird dieses jedenfalls dann als erfüllt angesehen, wenn die Erfindung einem klassischen Gebiet der Technik zuzurechnen ist, wozu seit jeher etwa die Chemie oder die Ingenieurswissenschaft, [112] inzwischen aber auch die Biologie gezählt werden. [113]
Somit bleibt festzuhalten: Wenn etwa die mutagene Wirkung bestimmter Agenzien zielgerichtet eingesetzt wird, um die Anfälligkeit der DNA für derartige physikalische bzw. chemische Einwirkungen auszunutzen mit dem Ergebnis, dass das genetische Material einer Pflanze so verändert wird, dass damit eine bestimmte phänotypische Ausprägung einhergeht, werden Naturkräfte in planmäßiger Weise genutzt und zwar auf dem Feld der Biologie. Welcher Auffassung zur Definition der Technizität man auch folgt – sie wird mit Blick auf einen planmäßigen und systematischen Einsatz der Zufallsmutagenese stets vorliegen.
b) Ausführbarkeit
Eine Erfindung muss aber auch ausführbar ein, was nur dann der Fall ist, wenn sie realisierbar und jederzeit wiederholbar ist. [114] Die Ausführbarkeit unterteilt sich also in die Elemente technische Brauchbarkeit und Wiederholbarkeit. [115]
Es ist umstritten, wie das Erfordernis der Ausführbarkeit, das in
Art. 83 EPÜ und § 34 Abs. 4 PatG explizit angesprochen wird, dogmatisch
einzuordnen ist.
[116]
Das EPA prüft die Wiederholbarkeit erst im Rahmen der Offenbarung,
[117]
die keine Patentierungsvoraussetzung ist.
[118]
Da jedoch beim Fehlen der Wiederholbarkeit bzw. der Ausführbarkeit
keine kausale Herbeiführung des auf technischem Gebiet liegenden
Erfolgs möglich ist,
[119]
was – wie vorhin dargestellt – begrifflich ein notwendiger Bestandteil
der Erfindung anzusehen ist, wird diese Auffassung hier abgelehnt.
Überzeugend wird für die dogmatische Einordnung als
Patentierungsvoraussetzung in der Literatur zudem darauf hingewiesen,
dass eine Aufforderung des Patentamts zu einer vollständigen
Offenbarung der Erfindung gem. § 45 Abs. 1 S. 1 PatG nur Sinn machen
kann, wenn diese überhaupt möglich ist, was aber voraussetzt, dass eine
ausführbare und mithin auch wiederholbare Erfindung vorliegt.
[120]
Die patentwürdige Bereicherung der Technik liegt schließlich in der
Offenbarung einer wiederholbaren Lehre zur Erreichung eines
angestrebten Ergebnisses.
[121]
Richtigerweise ist die Ausführbarkeit daher als Bestandteil des
Erfindungsbegriffes anzusehen.
aa) Technische Brauchbarkeit
Notwendig für die Ausführbarkeit ist zum einen die technische Brauchbarkeit. [122] Diese fehlt, wenn der angestrebte technische Erfolg prinzipiell nicht zu erreichen ist, weil z. B. gegen Naturgesetze verstoßen wird, womit es sich dann um eine so genannte Nicht-Erfindung handelt. [123] Mit Blick auf existierende Pflanzen, die durch Zufallsmutagenese gewonnen werden, ergeben sich insoweit keine Schwierigkeiten und es ist grundsätzlich von einer technischen Brauchbarkeit auszugehen.
bb) Wiederholbarkeit
Problematischer ist das Tatbestandsmerkmal der Wiederholbarkeit. Dieses wird so verstanden, dass die erfolgreiche Nacharbeitung der Erfindung nicht vom Zufall abhängig sein darf. [124] Dementsprechend wird für Patente auf Pflanzen, die mithilfe der Zufallsmutagenese erzeugt wurden, teilweise argumentiert, dass eine Wiederholbarkeit eben nicht bestehe. [125] Bereits in der Vergangenheit wurde in der patentrechtlichen Literatur jedoch die Auffassung vertreten, dass eine Wiederholbarkeit im Bereich von Pflanzenzüchtungserfindungen jedenfalls dann nicht erforderlich sei, wenn für die Nutzung der Erfindung durch die Allgemeinheit gar keine Wiederholung des Zuchtvorganges erforderlich ist, etwa wenn Gegenstand der Patentierung eine vererbbare Eigenschaft der Pflanze ist. [126]
Dieser Auffassung ist der BGH zwar zunächst in der Rote Taube-Entscheidung entgegengetreten mit dem Argument, dass in einem solchen Fall eine Fachperson die Erfindung nicht nacharbeiten könnte und vielmehr auf das in der Hand des Patentinhabers befindliche Züchtungsergebnis verwiesen würde, was zu einer Art Monopolisierung führte. [127] Später ist der BGH jedoch – im Einklang mit der Auffassung beim EPA [128] – von dieser Rechtsprechung abgerückt und hat für den Patentschutz von Mikroorganismen entschieden, dass die Möglichkeit einer wiederholbaren Neuzüchtung durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden könne. [129] Dies begründete der BGH damit, dass die nacharbeitende Fachperson ohnehin bevorzugt den Organismus vermehren werde, weil dies leichter und sicherer sei, als eine Nachzüchtung durchzuführen. [130] Eine Wiederholbarkeit soll nur dann erforderlich sein, wenn das Patent gerade für das Züchtungsverfahren selbst begehrt werde. [131] Auch wenn sich diese Entscheidung auf Mikroorganismen bezog, ist sie auf höhere biologische Organismen wie Pflanzen übertragbar. [132] Zwar ist mit Blick auf Pflanzen zu berücksichtigen, dass eine Vermehrung regelmäßig nicht in einer vollkommenen genetischen Identität resultieren wird. [133] Dies ist allerdings auch nicht als erforderlich anzusehen, da eine 100%ige genetische Identität für die gewerbliche Verwendung oder die Identifizierung des Organismus nicht erforderlich ist. [134] Der BGH hat darüber hinaus auch allgemein festgestellt, dass im Rahmen der Patentierung von Erzeugnissen die patentwürdige Bereicherung der Allgemeinheit schon dadurch eintritt, dass eine Beschreibung der neuen Beschaffenheit der Sache offenbart wird, sofern der nacharbeitenden Fachperson nur irgendein beliebiger Weg zur Herstellung dieser Sache zur Verfügung steht. [135]
Zweck des Patentrechts ist es, den Erfinder dafür zu belohnen, dass er eine für die Allgemeinheit nützliche Erfindung offenbart hat. [136] Da sich die Nützlichkeit in der Praxis wie oben gezeigt in dem hinterlegten Material manifestiert, bzw. in dem Aufzeigen ganz konkreter Mutationen, die für einen bestimmten erwünschten Phänotyp der Pflanze verantwortlich sind, ist der durch die in der Rechtsprechung erfolgte Lockerung der Anforderungen an die Wiederholbarkeit zuzustimmen.
Im Übrigen ist zu bedenken, dass die Wiederholbarkeit bei Offenbarung der konkreten Mutation jedenfalls durch Verfahren der gezielten Mutagenese etwa mittels CRISPR/Cas-Technik gegeben ist. [137]
cc) Zwischenergebnis
Es bleibt somit festzuhalten, dass das Kriterium der Wiederholbarkeit und damit auch der Ausführbarkeit im Ergebnis keine praktische Hürde für Erzeugnispatente auf durch mit Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen darstellt.
c) Entdeckung als Gegensatz zur Erfindung
Gem. Art. 52 Abs. 2 lit. a) EPÜ und § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG sind Entdeckungen keine Erfindungen im Rechtssinne und unterfallen damit nicht dem Patentschutz. Der Begriff der Entdeckung wird verstanden als das Auffinden von etwas bereits Vorhandenem, beispielsweise in Gestalt von Erscheinungen, Vorgängen, Naturgesetzen oder anderen Dingen. [138]
aa) Auffindung induzierter Mutationen als bloße Entdeckung?
Hinsichtlich der Zufallsmutagenese, konkret der Identifikation induzierter Mutationen mittels PCR-Screening und eines entsprechenden Phänotyps wird vorgebracht, dass dies mehr eine Entdeckung als eine Erfindung sei. [139] Gleiches wurde in der Vergangenheit für Kreuzungszüchtungen geltend gemacht: So wurde argumentiert, dass die Kreuzungszucht eigentlich von der Auslese geprägt sei, denn schon vor der Kreuzung seien ja geeignete Pflanzen zur Kreuzung ausgewählt worden, sodass im Prinzip stets nur Vorhandenes genutzt werde. [140]
bb) Stellungnahme
Den kritischen Stimmen ist zuzugeben, dass dem Züchtungsprozess sicher auch ein entdeckendes Element innewohnt. Entdeckungen sind, soweit es sich um reine Erkenntnisse handelt, vom Patentschutz ausgenommen, jedoch handelt es sich um patentierbare Erfindungen, wenn sie eine Anweisung zum technischen Handeln enthalten. [141] Anders gewendet: „Ein Entdecker wird zum Erfinder, wenn er auf Grund seiner Erkenntnis eine zweckgerichtete Anweisung zu bestimmtem Handeln gibt.“ [142] Gern bemüht wird dabei Beispiel, dass es eine reine Entdeckung ist, wenn man sich des Magnetismus bewusst wird, dass aber die Schaffung einer Kompassnadel eine Erfindung darstellt. [143]
Übertragen bedeutet das für die Zufallsmutagenese: Dass bestimmte Stoffe eine mutagene Wirkung auf Pflanzen haben, ist eine bloße Entdeckung. Schafft man jedoch durch die Anwendung eines Mutagens eine ganz bestimmte Mutation in einer Pflanze, die eine phänotypisch erwünschte Eigenschaft zur Folge hat, handelt es sich bei dieser Pflanze um eine Erfindung.
Hinzu kommt, dass bei der Züchtung mittels Zufallsmutagenese auch nicht nur mit etwas Vorhandenem gearbeitet wird: Durch die Induktion von Mutationen wird ja gerade ein neuer Genotyp geschaffen. Dass eine neu gezüchtete Pflanze grundsätzlich eine Erfindung sein kann und nicht zwingend nur eine Entdeckung darstellt, ergibt sich im Übrigen auch aus der Gesetzeshistorie: Mit Gesetz vom 21.6.1976 [144] wurde das PatG dahingehend geändert, dass gemäß dem seinerzeit neu eingefügten § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG (a.F.) Entdeckungen expressis verbis nicht als Erfindungen gelten können. Gleichzeitig ermöglichte fortan der seinerzeit ebenfalls neu eingefügte § 1a Nr. 2 PatG (a.F.) eine Patentierung von Pflanzensorten, sofern diese nicht im Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz aufgeführt waren. Damit ist klar, dass Pflanzen, die mit den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Methoden erzeugt wurden, zu denen bei Pflanzen die gentechnische Transgenese noch nicht zählte[145], grundsätzlich Erfindungen sein konnten.
Richtigerweise liegt daher in Bereitstellung einer technischen Lehre für die Schaffung von Pflanzen mit erwünschten Eigenschaften mittels Zufallsmutagenese nicht bloß eine die Erfindung ausschließende Entdeckung. Treffender ist vielmehr die Bezeichnung als eine auf „Entdeckung beruhende Erfindung.“ [146]
2. Neuheit
Art. 52 Abs. 1 EPÜ und § 1 Abs. 1 PatG normieren die Neuheit der Erfindung als weitere Patentierbarkeitsvoraussetzung. Diese liegt gem. Art. 54 Abs. 1 EPÜ bzw. § 3 Abs. 1 S. 1 PatG vor, wenn eine Erfindung nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört gem. Art. 54 Abs. 2 EPÜ bzw. § 3 Abs. 1 S. 2 PatG unter anderem alles, was vor dem jeweiligen Stichtag der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Allerdings darf dabei nicht nur der genaue Wortlaut der Veröffentlichung berücksichtigt werden. [147] Nicht als neu gelten auch Abwandlungen, die aufgrund der jeweiligen Publikation für die Fachperson so naheliegend sind, dass sie sich ihr bei der Lektüre ohne weiteres (unbewusst) mit erschließen. [148] Dabei bleiben Erkenntnisse, die der Fachperson erst aufgrund eigener gedanklicher Tätigkeit bewusst werden, unberücksichtigt – so auch der Einsatz von Äquivalenten. [149]
Eine Neuheit wird mit Blick auf die in dieser Arbeit betrachteten Pflanzen jedenfalls dann unproblematisch anzunehmen sein, wenn durch Zufallsmutagenese eine Eigenschaft in eine Pflanze eingebracht wird, die dort vorher nicht bekannt war.
Fraglich ist hingegen, ob auch dann noch eine Neuheit vorliegt, wenn bereits eine Pflanze mit einer auf einer Mutation eines bestimmten Gens beruhenden vorteilhaften Eigenschaft existiert, diese Pflanze auch schon landwirtschaftlich genutzt wird und der Patentanmelder nun diese Mutation identifiziert hat und diese dann per Zufallsmutagenese in eine andere Pflanze mit geeignetem genetischem Hintergrund einbringt.
Für chemische Verbindungen ist anerkannt, dass diese auch dann patentiert werden können, wenn die aus ihnen bestehenden Stoffe einzeln schon verwendet wurden. [150] Außerdem lässt sich schwerlich behaupten, dass die Nutzung der Eigenschaft einer Pflanze gleichzusetzen ist mit der Nutzung einer Mutation eines Gens. [151] Tatsächlich kommt es für die Neuheit auch nicht auf die Existenz des zu patentierenden Objektes an, sondern darauf, ob eine bestimmte Information schon zum Stand der Technik gehört. [152] Soweit es um die Nutzung bereits vorhandener Gene in einem neuen genetischen Hintergrund, d. h. einer neuen Pflanzenart, geht, ist in Literatur und Patenterteilungspraxis daher anerkannt, dass hier eine Neuheit vorliegt. [153] Ob es um ganze Gene oder um bestimmte Mutationen geht, kann jedoch keinen Unterschied machen.
Folglich wird der Einwand der fehlenden Neuheit häufig nicht greifen, soweit es um durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen geht.
3. Erfinderische Tätigkeit
Gemäß Art. 52 Abs. 1 EPÜ und § 1 Abs. 1 PatG bedarf es für die Patenterteilung neben dem Vorliegen der bereits genannten Kriterien einer erfinderischen Tätigkeit. Eine erfinderische Tätigkeit liegt gemäß Art. 56 S. 1 EPÜ und § 4 S. 1 PatG vor, wenn die Erfindung sich für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Ratio dieser Vorgabe ist, dass die Patentierbarkeit auf solche Neuerungen beschränkt werden soll, hinter denen eine besonders anerkennenswerte und kreative Leistung steckt, damit die Freiheit der Allgemeinheit bei der Verwendung technischer Lösungen nicht zu sehr eingeengt wird. [154] Dies bedeutet allerdings nicht, dass einfache Lösungen generell nicht Gegenstand einer erfinderischen Tätigkeit sein könnten – insbesondere die überraschende Einfachheit kann für eine erfinderische Tätigkeit sprechen, zumal wenn Fachleute erstaunt sind, dass die Lösung bislang noch nicht gefunden wurde. [155]
Entscheidend für die Beurteilung ist, ob die Erfindung von einer durchschnittlichen Fachperson aufgrund des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten durch naheliegende Abwandlungen des bereits Vorbekannten aufgefunden werden konnte. [156] Die Rechtspraxis lässt eine eher geringe erfinderische Tätigkeit genügen, da auch kleinteilige bzw. inkrementelle Innovationen geschützt werden sollen. [157]
Für Pflanzenzüchtungen kann keine pauschale Aussage darüber getroffen werden, wann die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt ist. [158] In der Vergangenheit wurde die erfinderische Tätigkeit zumindest bei Kreuzungszüchtungen bezweifelt, da hier nur in naheliegender Weise Elternlinien gekreuzt würden. [159]
a) Kriterium der ungewissen Erfolgsaussichten
Nach der Rechtsprechung beim EPA soll das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit im gentechnischen Bereich davon abhängig sein, dass vor dem Hintergrund des Standes der Technik nicht mit guter Aussicht auf Erfolg erwartet werden kann, eine bestimmte genetische Veränderung herbeiführen zu können. [160]
In einem Fall vor dem EPA ging es etwa um die Patentierung einer gentechnisch veränderten Pflanzenzelle, in die mittels eines Vektors ein Gen zur Expression des Proteins Phaseolin integriert wurde, wobei die DNA-Vektor-Konstruktion und Versuche damit zuvor bereits zum Stand der Technik gehörten. [161] Gleichwohl wurde hier eine erfinderische Tätigkeit mit der Argumentation angenommen, dass zwar der Versuchsaufbau selbst naheliegend war, aber die Erfolgsaussichten ungewiss waren, da schon viele Versuche zuvor fehlgeschlagen waren. [162] Nach den EPA-Richtlinien schließt eine angemessene Erfolgserwartung die erfinderische Tätigkeit aus, die aber nicht vorliegt, wenn für den Erfolg nicht nur technisches Wissen erforderlich ist, sondern auch das Treffen richtiger, nicht trivialer Entscheidungen. [163]
Zwar handelt es sich bei der Zufallsmutagenese wie oben gezeigt auch um Gentechnik, gleichwohl wendet das EPA in derartigen Fällen den Maßstab der Erfolgsaussicht nicht in dieser Form an: Im Falle eines strittigen Patentanspruches auf eine Methode zur Gewinnung von Phaffia rhodozyma-Hefezellen, die in großem Umfang den Farbstoff Asthaxanthin produzieren, bestehend aus einer Behandlung natürlich vorkommender Phaffia rhodozyma-Hefezellen mit zwei chemischen mutagenen Agenzien, betonte die Technische Beschwerdekammer, dass bei Zufallsmethoden wie der Zufallsmutagenese die Erfolgserwartungen als Kriterium nicht zugrunde gelegt werden können, da diese – ohne rationale Grundlage – von gar nicht bis hoch reichen werden und die Erfolgsaussichten, anders als bei besser vorhersagbaren gentechnischen Methoden, nicht basierend auf technischen Fakten bestimmt werden können. [164] Mit Blick auf den Stand der Technik im Anmeldezeitraum habe die Zufallsmutagenese im konkreten Fall für eine Fachperson auch nahe gelegen. [165] Dem Hilfsanspruch, gerichtet auf bestimmte, hinterlegte Hefezellen mangelte es nach Auffassung der Technischen Beschwerdekammer im konkreten Fall hingegen nicht an einer erfinderischen Tätigkeit, da die erfolgreiche Isolierung der Hefezellen überraschende Elemente beinhaltet habe und bislang auch nur Hefezelllinien verfügbar gewesen seien, die wesentlich weniger vom Farbstoff Asthaxanthin produzieren. [166] In einer späteren Entscheidung bezogen auf herbizidtolerante Pflanzen(teile), gewonnen u. a. durch Selektion einer durch Zufallsmutagenese erzeugten Direktmutante in einer Zellkultur berief sich der Patentinhaber darauf, dass die Fachperson bezüglich der erfolgreichen Erzeugung der Pflanze nicht zuversichtlich gewesen wäre – die Technische Beschwerdekammer verwies hingegen darauf, dass es auch hier nicht auf die Erfolgsaussichten ankäme, da es beim Zellkulturverfahren ebenfalls nur um das zufällige Vorhandensein von spontan aufgetretenen oder induzierten Mutationen gehe. [167] Gleichzeitig relativierte die Technische Beschwerdekammer jedoch diesen Befund durch die anschließende Feststellung, dass basierend auf dem Stand der Technik eine gewisse Erfolgserwartung vorhanden war und eine Erfolgsgewissheit für das Verneinen der erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich ist und dem Vorgehen im konkret zu beurteilenden Fall jedenfalls keine Probleme entgegenstanden. [168]
Anhand dieser beiden Entscheidungen ist festzustellen, dass die Rechtsprechungspraxis beim EPA das Kriterium der Erfolgsaussicht nicht komplett unberücksichtigt lässt, sondern vielmehr modifiziert. Danach kann, was sich als (zumindest teilweise) überraschender Erfolg darstellt, eine erfinderische Tätigkeit begründen. [169]
Dieses Kriterium weist freilich eine begriffliche Unschärfe auf. Andererseits wird man durchaus behaupten können, dass alles, was für eine (gewisse) Überraschung sorgt, keine naheliegende Abwandlung des Standes der Technik sein kann. Es handelt sich daher bei dem durch das EPA für Fälle der Zufallsmutagenese modifizierte Kriterium der Erfolgsaussicht durchaus um eine zweckmäßige Definition der erfinderischen Tätigkeit.
b) Subsumtion
Für die Zufallsmutagenese wird gesagt, dass häufig unsicher ist, ob mit ihr in einer bestimmten Pflanze eine bestimmte Eigenschaft hervorgerufen werden kann, weil die Mutabilität auch in Varietäten derselben Pflanzenart variiert. [170] Daher wird ein gewisses Maß an Glück auch als Voraussetzung für ein erfolgreiches Mutationszüchtungsprogramm angesehen [171] und ein Erfolg somit häufig nicht hinreichend absehbar sein. Berücksichtigt man dann noch die Komplexität des Gesamtverfahrens mit den nötigen Überlegungen (dazu oben B. II.) wird man bei Anlegen der o. g. Kriterien der Rechtsprechung jedenfalls nicht pauschal sagen können, dass es für durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen stets an der erfinderischen Tätigkeit mangelt.
Andererseits liegt eine erfinderische Tätigkeit auch nicht stets vor: So hatte die Technische Beschwerdekammer etwa über den Patentanspruch auf eine Hirsepflanze zu entscheiden, in die durch Zufallsmutagenese Mutationen eingeführt wurden, die zu einer Herbizidtoleranz führten. Diese Mutationen am entsprechenden Ort im sog. AHAS-Gen waren zuvor aber bereits durch Zufallsmutagenese in andere Pflanzenarten eingeführt worden, wo sie ebenfalls zur Herbizidtoleranz führten, weshalb die Technische Beschwerdekammer hier nicht von einer erfinderischen Leistung ausging, da die Unsicherheiten bei Zufallsmutagenese in diesem Fall die Fachperson gerade nicht von entsprechenden Versuchen abgehalten hätte. [172] Ebenfalls hat die Technische Beschwerdekammer entschieden, dass es einem gentechnischen Verfahren an einer erfinderischen Tätigkeit mangelt, weil es zuvor bereits erfolgreich in Bakterien angewandt und in der Literatur beschrieben wurde und nun in Pflanzenzellen angewandt wurde, da im konkreten Fall keine Faktoren ersichtlich waren, die eine echte Hürde für den Erfolg des Vorhabens dargestellt hätten. [173]
Es lässt sich somit feststellen, dass es von dem konkreten Einzelfall und insbesondere dem zugrunde liegenden Stand der Technik abhängt, ob durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllen.
4. Gewerbliche Anwendbarkeit
Ein weiteres notwendiges Kriterium für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist gem. Art. 52 EPÜ bzw. § 1 Abs. 1 PatG deren gewerbliche Anwendbarkeit. Eine Erfindung gilt gem. Art. 57 EPÜ bzw. § 5 PatG dann als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschließlich der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann. Erzeugnis- bzw. Sacherfindungen sowie entsprechende Herstellungsverfahren gelten stets als gewerblich anwendbar, da jede Sache in einem in einem Betrieb gewerblich hergestellt werden kann. [174]
Folglich sind auch Verfahren der Pflanzenzüchtung bzw. Pflanzen als Erzeugnisse gewerblich anwendbar im Sinne der Vorschriften.
II. Offenbarung
Die Erfindung muss gem. Art. 83 EPÜ bzw. § 34 Abs. 4 PatG so deutlich und vollständig offenbart werden, dass eine Fachperson sie ausführen kann. Dabei handelt es sich wie oben bereits erwähnt zwar nicht um eine Patentierungsvoraussetzung im engeren Sinne, [175] jedoch um eine praktisch sehr wichtige Anforderung, da deren Fehlen ein Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrund darstellt. [176]
In der Vergangenheit wurde bezweifelt, dass eine hinreichende Offenbarung im Sinne des Patentrechts bei pflanzengenetischen Erfindungen möglich sei, da eine genaue Beschreibung von Pflanzen nur anhand lebender Exemplare möglich sei, da Zeichnungen, Fotografien oder getrocknete Pflanzen allesamt zu ungenaue Beschreibungen lieferten. [177] Dem wurde mit Recht entgegnet, dass an die patentrechtliche Beschreibung schon aufgrund ihrer Funktion nicht derselbe Maßstab angesetzt werden muss wie an eine botanisch-naturwissenschaftliche Strukturanalyse, da es vor allem auf die praktische Verwendung in der Landwirtschaft und um Gartenbau ankommt und daher eine Beschreibung sämtlicher den Organismus kennzeichnenden phäno- und genotypischen Merkmale nicht notwendig ist. [178]
Nach der Rechtsprechung beim EPA reicht für die Offenbarung prinzipiell aus, die konkrete Mutation etwa zur Ausschaltung eines Gens und die Pflanzenart zu benennen [179] und im Übrigen auf Zufallsmutagenese und eine näher beschriebene Selektionsmethode zu verweisen, auch wenn die Mutation nach der Mutagenese nur in zwei von über 14000 Pflanzensamen aufgetreten ist – dies würde für die Fachperson keine unzumutbare Belastung bei der Ausführung der Erfindung verursachen. [180] Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, zumal ohnehin stets eine Ausführungsmöglichkeit durch Techniken gezielter Mutagenese (siehe bereits oben D. I. 1. a) cc)) vorhanden ist.
Folglich bestehen keine grundsätzlichen Zweifel an der Möglichkeit der hinreichenden patentrechtlichen Offenbarung von durch Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen. Allerdings sind ggf. bestimmte Besonderheiten zu beachten wie etwa die Einreichung eines separaten Sequenzprotokolls, das bestimmten Standards entsprechen muss, wenn Nukleotid- und Aminosäuresequenzen offenbart werden. [181]
III. Kein Einsatz von im Wesentlichen biologischen Verfahren
Gem. Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ und § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG werden Patente nicht erteilt für Pflanzensorten [182] oder Tierrassen, sowie im Wesentlichen biologische Verfahren (iWbV) zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Regel 28 Abs. 2 AOEPÜ[183], deren deutsche Entsprechung in § 2a Abs. 1 Nr. 1 2. Hs PatG zu finden ist, schließt die Erteilung von Patenten darüber hinaus auch für ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere aus. Für europäische Patentanmeldungen gilt dies, sofern sie nicht schon vor dem 1. Juli 2017 beim EPA eingereicht wurden. [184] Jüngere Patentanmeldungen auf Pflanzen beim EPA, die sowohl durch iWbV als auch durch ein technisches Verfahren gewonnen werden können, müssen einen Disclaimer enthalten, der den Anspruch auf Pflanzen beschränkt, die mit einem technischen Verfahren hergestellt wurden. [185] Außerdem darf die Patentbeschreibung keine Verweise auf iWbV als alternative Methode zur Gewinnung der beanspruchten Pflanze enthalten. [186] Zu klären bleibt, ob die Zufallsmutagenese ein iWbV ist.
1. Unterschiedliche Interpretationen vom Terminus iWbV
Regel 26 Abs. 2 AOEPÜ, Art. 2 Abs. 2 Richtlinie 98/84/EG und § 2a Abs. 3 Nr. 3 PatG definieren ein iWbV allesamt als ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Es gilt gleichwohl als nicht abschließend geklärt, was ein iWbV genau ist. [187]
a) Jede Erbgutveränderung ist biologisch
In der Vergangenheit wurde vereinzelt eine extrem restriktive Auffassung vertreten: So hat Oredsson basierend u. a. auf Gesetzesmaterialien aus Schweden argumentiert, dass jedwede Form der Erbgutveränderung, inklusive Verfahren wie Transgenese oder das Einbringen von Genen in eine Zelle durch Mikroinjektion rein biologische Prozesse seien. [188] Auch wenn Oredsson sie nicht explizit erwähnt, würde dies selbstverständlich auch die Zufallsmutagenese erfassen.
b) Jeder biologische Verfahrensschritt führt zu iWbV
Zu ähnlichen Ergebnissen führte ein hypothetischer Ansatz, den die Technische Beschwerdekammer referiert hat, wonach in Anlehnung an das Patentierungsverbot für chirurgische und therapeutische Verfahren gem. Art. 53 lit. c) S. 1 EPÜ die Inkludierung nur eines einzigen biologischen Verfahrensschritts zu einem Patentierungsverbot führte. [189] Auch dann wäre die Zufallsmutagenese ein iWbV.
c) Konventionelle Züchtung entspricht iWbV
Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass der Begriff des iWbV mit dem Begriff der konventionellen Züchtung gleichzusetzen sei. [190] In Europa werden unter konventioneller (bzw. traditioneller) Züchtung üblicherweise alle Züchtungsmethoden verstanden, die nicht den Vorschriften der (gentechnikrechtlichen) Richtlinie 2001/18/EG unterfallen [191] – dazu gehört wie oben gezeigt auch die Zufallsmutagenese. Dass die Zufallsmutagenese ein iWbV sei, wird von dieser Auffassung unter anderem damit begründet, dass die Zufallsmutagenese nur Prozesse beschleunige, die in der Natur sowieso stattfänden. [192] Außerdem entspreche das Gesamtgeschehen der Kreuzung von ganzen Genomen. [193] Letzteres trifft allerdings, wie oben unter B. II. gezeigt, zumindest im Falle von Direktmutanten nicht zu.
d) Gewichtung biologischer Faktoren im Züchtungsverfahren
In der Literatur wurde von Moufang die Auffassung vertreten, dass es darauf ankomme, ob in dem Züchtungsverfahren der Einsatz der chemischen bzw. physikalischen (mutagenen) Mittel wenigstens eine der biologischen Faktoren „ebenbürtige Rolle“ spielen. [194] Dies sieht Moufang bei einer isolierten Betrachtung von physikalischer und chemischer Mutagenese zumindest regelmäßig als gegeben an, gibt sich aber deutlich zurückhaltender, wenn das Züchtungsverfahren auch die Aufzucht und sexuelle Vermehrung der mutagenenisierten pflanzlichen Materie beinhaltet. [195] Dies dürfte, wie bei der Schilderung der Mutageneseverfahren gezeigt, regelmäßig der Fall sein, sodass diese in solchen Fällen ein iWbV und Pflanzen daraus von der Ausschlussvorschrift wären.
e) Wesentlichkeit des technischen Anteils
Zunächst, und zwar vor der Einfügung der gesetzlichen Definition des iWbV durch Einfügung der Regel 26 Abs. 5 AOEPÜ, ging die Rechtsprechung im EPA davon aus, dass die Frage, ob ein iWbV vorliege, ausgehend vom Wesen der Erfindung und unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der Mitwirkung des Menschen und dessen Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden müsse. [196] Dies konkretisierte die Technische Beschwerdekammer später dahingehend, dass ein Pflanzenzüchtungsverfahren, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt beinhaltet, der nicht ohne menschliches Zutun ausgeführt werden kann, und der einen entscheidenden Einfluss auf das Zuchtergebnis hat, nicht unter die Ausnahme des Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ falle. [197] Da die durch Menschenhand künstlich induzierten Mutationen notwendige Bedingung für die Entwicklung der konkreten Eigenschaften der Pflanze sind, wäre die Zufallsmutagenese nach diesem Verständnis kein iWbV.
f) iWbV nur bei ausschließlicher Nutzung von Naturphänomenen
Der Patentanmelder in der Brokkoli I-Entscheidung hat die Auffassung vertreten, dass die oben unter D. III. 1. genannte Legaldefinition der iWbV nur dann greife, wenn das Verfahren Phänomenen entspräche, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten, was schon nicht der Fall bei Kreuzungen sei, die in der Natur nicht vorkommen könnten sowie bei bestimmten technischen Schritten, die Teil der Selektion sind (z. B. Bestimmung des Trockengewichtanteils von Früchten nach Trocknen im Ofen). [198] Diese Auffassung wurde auch in der Literatur vertreten. [199]
Einen ähnlichen Ansatz hatte die Technische Beschwerdekammer erdacht, wonach ein Verfahren dann nicht im Wesentlichen biologisch wäre, wenn es neben beliebig vielen biologischen Schritten nur einen einzigen nicht-biologischen Schritt aufwiese. [200]
Diese Ansätze scheinen auf den ersten Blick kompatibel zur gesetzlichen Definition des iWbV. Nach ihnen wären Züchtungsergebnisse aus Zufallsmutagenese also niemals das Ergebnis eines iWbV.
g) Einfügen eines Merkmals in das Genom
In ihrer Tomate I / Brokkoli I-Entscheidung kommt die Große Beschwerdekammer beim EPA dagegen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Verfahrensschritt dann nicht zu einem iWbV führt, wenn dieser selbst ein Merkmal in das Genom [201] einer gezüchteten Pflanze einführt bzw. ein vorhandenes Merkmal modifiziert, dieses also ihren Ursprung nicht in der Kreuzung oder Selektion hat. [202] Dabei schränkt die Große Beschwerdekammer noch ein, dass dies nur gelte, soweit der erwähnte technische Verfahrensschritt innerhalb der Schritte der Kreuzung und Selektion ausgeführt wird. [203] Dieses einschränkende Kriterium hat den Zweck zu verhindern, dass der Patentierbarkeitsausschluss in Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ dadurch umgangen wird, dass dem eigentlich relevanten (und im Wesentlichen biologischen) Verfahren der Kreuzung und Selektion einfach ein technischer Schritt angefügt wird. [204]
Durch die Zufallsmutagenese – und nicht durch die ggf. anschließende Kreuzung bzw. Selektion – wird eine ganz bestimmte Mutation im Genom des pflanzlichen Materials hervorgerufen, die entscheidend für die erwünschte Eigenschaft ist und die sich bereits direkt nach dem Mutageneseschritt im mutierten pflanzlichen Material befindet, [205] selbst wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht unmittelbar phänotypisch zutage treten sollte. Die stattfindenden weiteren Schritte der Selektion und Vermehrung oder Kreuzung dienen wie oben gezeigt regelmäßig (nur) dazu, zusätzlich aufgetretene unerwünschte Mutationen wieder zu entfernen, erfolgen also nicht in einer Umgehungsabsicht. Ohnehin ist, wie oben unter B. II. am Beispiel der schillernden Nelke gezeigt, der erste Schritt beim Verfahren der Zufallsmutagenese mitunter die sorgfältige Selektion eines zu mutierenden Ausgangsmaterials, und nach der Anwendung des Mutagens muss dann weiter vermehrt und/oder gekreuzt werden – der technische Mutationsschritt befindet sich in solchen Fällen also zeitlich auch innerhalb der Schritte von Selektion und ggf. Kreuzung.
Im Übrigen sind auch im Anschluss an eine unstrittig nicht im Wesentlichen biologische gentechnische Transgenese stets mehrere (Rück-)Kreuzungs- und Selektionsschritte erforderlich, um das Transgen in eine Hochleistungslinie einzubringen, die für die Vermarktung geeignet ist, [206] ohne, dass deswegen vom Vorliegen eines iWbV ausgegangen würde.
Nach alledem kann dieses einschränkende Kriterium der großen Beschwerdekammer also nicht dazu führen, dass Zufallsmutagenese stets ein iWbV wäre. [207] Selbst wenn man diese Entscheidung anders interpretierte, wird die später eingefügte Regel 28 Abs. 2 AOEPÜ, nach der europäische Patente nicht erteilt werden für ausschließlich durch ein iWbV gewonnene Pflanzen, so verstanden, dass Pflanzen, die aus einem technischen Verfahren stammen, selbst dann nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn bei ihrer Herstellung zusätzlich Kreuzung und Selektion angewandt wird. [208] Diese Auslegung entspricht auch dem erklärten Willen des Normgebers. [209]
h) Stellungnahme
Das Spektrum vertretener Meinungen ist extrem breit, wobei an den Rändern dieses Spektrums die Zufallsmutagenese entweder niemals oder stets als iWbV angesehen wird.
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, zu versuchen, eine vollends überzeugende Definition des iWbV zu erarbeiten und damit zu erreichen, wozu Rechtswissenschaft und Rechtsprechung in mehreren Jahrzehnten nicht in der Lage waren. Daher beschränken sich die folgenden Ausführungen darauf, bestimmte Auffassungen auszuschließen.
Überzeugend ist zunächst die Auffassung der Großen Beschwerdekammer, wonach sich die Begriffe der Kreuzung oder Selektion in der Definition in Regel 26 Abs. 5 AOEPÜ nicht ausschließlich auf in der Natur stattfindende und vom Menschen unbeeinflusste Selektion und Kreuzung beziehen können, da sie in der Vorschrift im Zusammenhang mit der Pflanzenzüchtung erwähnt werden, die sowieso niemals rein natürlich ist. [210] Außerdem würde durch eine andere Interpretation die Ausschlussvorschrift in Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ eines Sinnes entleert, da ein vom Menschen unbeeinflusster Vorgang ohnehin keine patentierbare Erfindung darstellen könnte. [211] Schließlich wurde während der Entstehung der Norm das Wort „rein“ durch „im Wesentlichen“ ersetzt. [212] Daher ist die oben unter f) genannte Auffassung somit abzulehnen.
Die von Moufang geäußerte Auffassung (oben d)) bleibt zu ungenau, um wirklich praktikable Ergebnisse zu erzeugen. Zwar verweist er für die Feststellung der „Ebenbürtigkeit“ der nichtbiologischen Verfahrenselemente gegenüber den biologischen Faktoren auf eine jeweils konkret vorzunehmende Gesamtabwägung. [213] Aber eine Abwägung setzt eine Gewichtung einzelner Merkmale voraus, für die Moufang keine Vorgaben macht, und für die sich schwerlich eindeutige verbindliche Vorgaben machen ließen: So könnte man einerseits argumentieren, dass der eigentliche Mutageneseschritt in zeitlicher Hinsicht eher untergeordnet ist im Vergleich zur weiteren Vermehrung und/oder Kreuzung. Andererseits ist der Mutageneseschritt conditio sine qua non für das Ergebnis des Verfahrens und sorgt für die entscheidende Mutation im Genom, ohne die all die folgenden Schritte nutzlos wären. Somit stellte sich also die Frage, mit welchem Gewicht der Mutageneseschritt in die Gesamtabwägung einzubringen wäre. Eine eindeutige Beantwortung scheint nicht möglich, weswegen die Auffassung Moufangs abzulehnen ist.
Aus den Materialien zur Erarbeitung des Art. 53 lit. b) EPÜ wird deutlich, dass die Architektinnen und Architekten des EPÜ die Zufallsmutagenese für patentierbar hielten – so heißt es in einem vorbereitenden Dokument: „[…] so muss doch die Erteilung europäischer Patente für solche Verfahren bestehen bleiben, die zwar Pflanzen betreffen, jedoch technischer Natur sind, beispielsweise ein Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen durch Bestrahlung der Pflanzen selbst oder der Samen mit Isotopen.“ [214] Betrachtet man zudem die Komplexität des Verfahrens der Zufallsmutagenese (dazu oben B. II.), dessen immense mutagene Wirkung und das klare Zuchtziel dahinter, erscheint es auch fernliegend, hierin einen lediglich natürlichen Prozess erkennen zu wollen. Dies spricht gegen eine Auslegung, nach der die Zufallsmutagenese als ein iWbV anzusehen ist.
Dagegen spricht ferner, dass Art. 52 Abs. 1 EPÜ den allgemeinen Grundsatz festlegt, dass europäische Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt werden, und Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ gelesen im Kontext insbesondere mit Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ eher eng auszulegen ist. [215]
Hinzu kommt, dass der österreichische Nationalrat im vergangenen Jahr
das österreichische Patentgesetz dahingehend geändert hat, dass dessen
§ 2 Abs. 2 S. 3 nunmehr lautet:
„Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im
Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen
Phänomenen wie Kreuzung, Selektion,
nicht zielgerichteter Mutagenese oder auf in der Natur
stattfindenden zufälligen Genveränderungen
beruht.
[Hervorhebung durch Verf.]“
[216]
Nach der Gesetzesbegründung werde damit
„klargestellt, dass auch die nicht zielgerichtete Mutagenese
[…]als im Wesentlichen biologische[s]
Verfahren zu sehen
[ist].“
[217]
Eine solche Klarstellung wäre wohl kaum erfolgt, wenn bereits die
Vorschrift des
Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ ohnehin so auszulegen wäre, dass die
Zufallsmutagenese ein iWbV ist.
Folglich sind die oben unter den Buchstaben a) – c) genannten Auffassungen allesamt abzulehnen, sodass im Ergebnis nur solche Auffassungen zu überzeugen vermögen, nach denen die Zufallsmutagenese kein iWbV ist. Daher sind durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen nicht von diesem Patentierungsausschluss betroffen.
Es ist davon auszugehen, dass deutsche Gerichte bei Streitigkeiten um ein nationales Patent zu einem ähnlichen Ergebnis kämen: Die Literatur weist zu Recht darauf hin, dass die unter g) dargestellte jüngere Rechtsprechung des EPA den Begriff iWbV im Vergleich zur auch in Deutschland geltenden Legaldefinition weit auslegt, [218] was gleichwohl wie gezeigt nicht dazu führt, dass die Zufallsmutagenese unter den Begriff zu subsumieren wäre.
2. Kritik an der Verwerfung der gesetzlichen Definition
Ein anderer Aspekt sollte im Zusammenhang mit der Entscheidung der
Großen Beschwerdekammer erwähnt werden. Sie führt aus, dass die
gesetzliche Definition des iWbV in
Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 98/44/EG und in Regel 26 Abs. 5 AOEPÜ
derart in sich widersprüchlich sei, dass sie keine verwertbaren
Anhaltspunkte für die Auslegung liefere.
[219]
Dies vermag nicht völlig zu überzeugen:
[220]
Auffällig ist, dass Verfahrenssprache die englische Sprache war.
Tatsächlich gibt es aber kleine Unterschiede in den Sprachfassungen des
EPÜ. Im Englischen lautet die Definition für iWbV:
„A process for the production of plants or animals is essentially
biological if it consists entirely of natural
phenomena such as crossing or selection
[Hervorhebung durch Verf.] “ Das Verb „to consist of“ wird im
Englischen verstanden als „to be composed or made up of“
[221]
In der deutschen Fassung demgegenüber ist die Rede von einem „ Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht “ [Hervorhebung durch Verf.], wobei diese sprachliche Divergenz in früheren Entwurfsfassungen nicht bestand. [222] Das Verb „beruhen“ bedeutet nach dem Duden „(in etwas) seinen Grund, seine Ursache haben“ [223]und hat damit eine leicht andere Bedeutung, als das englische Verb „to consist of“: So lässt sich sicherlich behaupten, dass eine von Menschenhand forcierte Kreuzung vollständig auf dem natürlichen Phänomen der Kreuzung beruht , während man dagegen nicht sagen kann, dass die von Menschenhand forcierte Kreuzung vollständig aus dem natürlichen Phänomen der Kreuzung besteht, da diese Aussage keinen Raum für die menschliche Hand ließe.
Die deutsche Fassung ist damit etwas weniger in sich widersprüchlich
und unterstützt sogar in gewissem Umfang die dargestellte
EPA-Rechtsprechung zur Auslegung des Terminus iWbV – insbesondere mit
Blick auf die Ablehnung der oben genannten Auffassung zu f).
Da Art. 177 Abs. 1 EPÜ bestimmt, dass jede der drei Sprachen des
Übereinkommens gleichermaßen verbindlich ist und die AOEPÜ gem. Art.
164 Abs. 1 EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist, sollte dieser
unterschiedliche Wortlaut nicht gänzlich ignoriert werden.
Unterschiedliche Sprachfassungen eröffnen nämlich bekanntermaßen
Auslegungsspielräume.
[224]
3. Anwendbarkeit der Rückausnahme für mikrobiologische Verfahren
Gem. Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ gilt das Patentierungsverbot für iWbV zur Züchtung von Pflanzen nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse, was mit einem ähnlichen Wortlaut auch in § 2a Abs. 2 Nr. 2 PatG und Art. 4 Abs. 3 Richtlinie 98/44/EG niedergelegt ist.
Ein mikrobiologisches Verfahren ist in Art. 2 Abs. 1 lit. b) Richtlinie 98/44/EG, § 2a Abs. 3 Nr. 2 PatG und Regel 26 Abs. 6 AOEPÜ definiert als ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.
Fraglich ist daher, ob die in vitro an pflanzlichen Zellkulturen durchgeführte Zufallsmutagenese (dazu oben B. II.) unter den Begriff des mikrobiologischen Verfahrens subsumiert werden kann, was bedeutend wäre, wenn man der hier abgelehnten Auffassung zuneigt, dass die Zufallsmutagenese ein iWbV darstellt.
a) Pflanzenzüchtung ist nicht mikrobiologisch
Zum Teil wird davon ausgegangen, dass die Anwendung der Gentechnik auf bei Pflanzen nicht als mikrobiologisch anzusehen sei, weil im Verfahren auch andere pflanzenzüchterische Methoden anzuwenden seien. [225] Außerdem ist umstritten, ob Teile von komplexeren Organismen wie z. B. pflanzliche Zellkulturen überhaupt als Mikroorganismen betrachtet werden können. [226] Dies wird zum Teil als nicht vereinbar mit dem Wortlaut von Art. 53 lit. b) S. 1, 2. Hs. EPÜ gehalten, da den Schöpfern des (Straßburger) Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente [227] die naturwissenschaftliche Bedeutung des Terminus „Mikroorganismus“ geläufig gewesen sei und die Vertragsparteien bei einem Willen zur Subsumtion pflanzlichen Materials unter den Begriff des Mikroorganismus eine ausdrückliche Regelung getroffen hätten. [228] Auch sei man sich im Rahmen des Abschlusses des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren [229] einig darüber gewesen, dass Pflanzenteile keine Mikroorganismen seien. [230] Die Vorschrift diene lediglich der Verhinderung einer zu extensiven Auslegung des Patentierungsausschlusses auf mikrobiologische Verfahren, da zum Zeitpunkt der Schaffung der Vorschrift die Mikroorganismen teilweise noch dem Pflanzenreich zugeordnet wurden. [231] Folgte man dieser Argumentation, würde die Rückausnahme nicht für durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen gelten.
b) Veränderung von Pflanzenzellen ist mikrobiologisch
Andererseits wird explizit betont, dass Pflanzenerfindungen, jedenfalls sofern es keine Pflanzensorten sind, grundsätzlich patentfähig seien, sofern sie durch ein mikrobiologisches Verfahren erzeugt wurden. [232] Unter die Tatbestandsalternative „Eingriff in mikrobiologisches Material“ in der gesetzlichen Definition des mikrobiologischen Verfahrens wird nach dieser Auffassung auch die gentechnische Veränderung einer regenerationsfähigen Pflanzenzelle, aus der dann eine Pflanze hervorgeht, subsumiert. [233] Nach dieser Auffassung könnte die Rückausnahme für durch Zufallsmutagenese erzeugte Pflanzen gelten.
c) Rechtsprechung
Zwar erkannte die Technische Beschwerdekammer früher ausdrücklich an, dass eine Mausart, in deren Zellen Onkogen-Sequenzen eingeschleust wurden, unter die Rückausnahme in Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ fallen könnte, sofern die Mausart ein Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens ist. [234] Später machte die Technische Beschwerdekammer ferner deutlich, dass sie diese Auffassung auch grundsätzlich auf Pflanzensorten für anwendbar hält. [235] Trotzdem gelangte sie im Bereich der Pflanzenzüchtung nicht zur Anwendung der Rückausnahme: Sie ging mittels einer objektiv-teleologischen Auslegung davon aus, dass mit mikrobiologischen Verfahren der Einsatz von (ggf. auch gentechnisch veränderten) Mikroorganismen zur Nutzung der Fähigkeiten dieser Organismen etwa zur Herstellung von Produkten gemeint sei und nicht nur die Existenz eines mikrobiologischen Teilschrittes in einem Pflanzenzüchtungsverfahren, da im Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ nur die Rede von einem mikrobiologischen Verfahren und nicht etwa von einem im Wesentlichen mikrobiologischen Verfahren sei. [236] Die Große Beschwerdekammer bestätigte diese Linie später mit der Argumentation, dass gentechnische Verfahren und mikrobiologische Verfahren nicht identisch seien. [237] Zwar würden Zellen und deren Bestandteile zu Recht wie Mikroorganismen behandelt, gleichwohl seien genetisch veränderte Pflanzen nicht als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren im Sinne von Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ zu behandeln, da dies nach damaliger Rechtslage [238] zur Folge gehabt hätte, dass entsprechend gewonnene Pflanzensorten patentierbar gewesen wären, was aber nach der – insoweit von der Auffassung des Technischen Beschwerdekammer abweichenden – Meinung der Großen Beschwerdekammer dem Willen des Normgebers widerspreche. [239]
Nach dieser Auffassung wäre die Zufallsmutagenese an pflanzlichen Zellkulturen und die Generation von Pflanzen aus diesen ebenfalls kein mikrobiologisches Verfahren, sodass die Rückausnahmevorschrift nicht greifen würde.
d) Unanwendbarkeit der Rückausnahme
In den aktuellen Richtlinien für die Prüfung im EPA [240] wird darauf verwiesen, dass Pflanzenzellen oder Pflanzengewebe in der Regel totipotent sind und die gesamte Pflanze generieren können und deswegen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn die Pflanze, von der dieses pflanzliche Material stammt, ausschließlich durch ein iWbV erzeugt werden kann. Zwar ist der damit angesprochene Sachverhalt anders gelagert als die hier zur Debatte stehende Zufallsmutagenese von pflanzlichen Zellkulturen. Gleichwohl wird aus diesen Richtlinien das Ziel deutlich, dass der Ausschluss der Patentierung von Pflanzen aus iWbV gewonnen Pflanzen nach Regel 28 Abs. 2 AOEPÜ nicht mittels der Rückausnahme umgangen werden soll. Auch die Große Beschwerdekammer hat betont, wie bedeutsam der ausdrückliche Wille des Normgebers sei, Erzeugnisse, die durch iWbV gewonnen werden, von der Patentierbarkeit auszuschließen. [241] Dieses Argument lässt sich übrigens auch für das deutsche Patentrecht heranziehen, da die entsprechende Ergänzung in § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG von allen im Bundestag vertretenen Parteien getragen wurde. [242]
Wie unter B. II. gezeigt, entfalten In-vivo- und In-vitro-Zufallsmutagenese im Rahmen der Pflanzenzüchtung dieselben Wirkungen und unterscheiden sich lediglich durch die Durchführungsmodalitäten, sodass diese Verfahrensweisen vom Ergebnis her gedacht grundsätzlich austauschbar sind. Daher würde die Ausnahmevorschrift für iWbV und den daraus gewonnen Pflanzen gem. Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ in Verbindung mit Regel 28 Abs. 2 AOEPÜ den praktischen Anwendungsbereich verlieren, wenn sie einfach durch Nutzung von pflanzlichen Zellkulturen umgangen werden könnte. [243] Gleiches gilt für die entsprechende deutsche Vorschrift in § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG.
Hinzu kommt, dass, was bereits in den älteren Literaturauffassungen angeklungen ist, auch aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht Pflanzenzellen nicht unter den Begriff der Mikroorganismen zu subsumieren sind. [244] Zwar trifft zu, dass die juristische Einordnung nicht zwingend daran gebunden ist[245], jedoch wäre bei einem Widerspruch zum allgemeinen naturwissenschaftlichen Verständnis des Begriffes eine Legaldefinition zu erwarten, die dies klarstellt wie etwa § 3 Nr. 1 Gentechnik-Sicherheitsverordnung, der pflanzliche Zellkulturen ausdrücklich als Mikroorganismus legaldefiniert. Eine solche vom naturwissenschaftlichen Verständnis abweichende Legaldefinition findet sich indes im Patentrecht nicht. Wenn sich der Gesetzgeber der Fachsprache bedient, ist im Zweifelsfall aber die fachspezifische Bedeutung bei der Auslegung zugrunde zu legen. [246]
Sofern also anders als hier die Zufallsmutagenese als iWbV angesehen wird, sprechen die besseren Argumente dafür, mit diesem Verfahren erzeugte Pflanzen nicht auf dem Wege der Rückausnahme in Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ für patentierbar zu halten, da es sich bei der Zufallsmutagenese nicht um ein mikrobiologisches Verfahren im Sinne der Vorschrift handelt.
E. Patentschutz für Pflanzen durch Patentierung des Verfahrens der Zufallsmutagenese?
Gem. Art. 64 Abs. 2 EPÜ erstreckt sich der Schutz eines europäischen Verfahrenspatents auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. In Art. 8 Abs. 2 Richtlinie 98/44/EG heißt es weitergehend, dass der Schutz eines Patents für ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene Material und jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material umfasst, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewonnen wird. Entsprechendes ist im deutschen Recht in den §§ 9 S. 2 Nr. 3, 9a Abs. 1 PatG niedergelegt. Insofern stellt sich die Frage, ob ein Schutz für eine Pflanze also auch dadurch zu erreichen ist, dass das Verfahren patentiert wird, durch das sie erzeugt wird. Jedenfalls grundsätzlich ist dies denkbar. [247] Anders als bei Erzeugnispatenten kann die Wiederholbarkeit als Voraussetzung für die Erfindung allerdings nicht durch eine Hinterlegung ersetzt werden und muss zwingend gegeben sein. [248]
Von Metzger und Bartels wird für gezielte Mutagenesetechniken wie CRISPR/Cas9 zudem bestritten, dass allgemeine Verfahrenspatente auf diese Techniken einen Schutz für alle die mit diesen Verfahren erzeugten Pflanzen zur Folge haben: Unter anderem argumentieren sie, dass auch beim Einsatz solcher Techniken noch weitere Züchtungsschritte erforderlich seien, sodass sich die Frage stelle, inwieweit die Pflanze dann noch als unmittelbar mit diesem Verfahren gewonnen im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Richtlinie 98/44/EG gelten kann. [249] Dieses Argument vermag zwar nicht vollends zu überzeugen, da als unmittelbar mit dem Verfahren gewonnene Pflanze die gezielt genetisch veränderte, aber noch nicht weiter züchterisch bearbeitete Pflanze gelten kann, deren Nachkommen nach der Norm denselben Schutz genießen. Gewichtiger erscheint dagegen ihr Argument, dass das unspezifizierte Verfahren ohne weitere Angaben nicht ausreicht, um Pflanzen mit erwünschten Eigenschaften zu erzeugen. [250] Sehr überzeugend sind auch ihre teleologischen Erwägungen: Es ist nicht ökonomisch sinnvoll, wenn Patente auf generische Herstellungsverfahren, mit denen unterschiedlichste Eigenschaften erzielt werden können, alle denkbaren Produkte dieser Verfahren umfassen würden, wenn diese gar nicht offenbart werden, da dies eine Überbelohnung von Patentinhabenden darstellen würde. [251]
Ein Verfahrenspatent der Zufallsmutagenese mit entsprechenden Schutzwirkungen auf die entstehenden Pflanzen ist vor diesem Hintergrund nur dann denkbar, wenn die konkrete agronomische Eigenschaft und die genetischen Grundlagen der Pflanze im Verfahren beschrieben sind. [252] Insoweit stünde auch die Wiederholbarkeit nicht unbedingt entgegen, solange sie bei entsprechender Skalierung des Verfahrens gegeben ist (vgl. oben D. II.). Freilich wäre in so einem Fall auch ein Erzeugnispatent denkbar. In der Praxis findet man daher Patente, in denen sowohl die Pflanze als Erzeugnis als auch das für den spezifischen Fall konkretisierte Verfahren der Zufallsmutagenese beansprucht wird. [253]
F. Fazit
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Zufallsmutagenese auch für die heutige Landwirtschaft nach wie vor eine erhebliche Rolle spielt. Die eingangs aufgeworfene Forschungsfrage, ob mit dieser Züchtungstechnik erzeugte Pflanzen patentierbar sind, lässt sich nach den obigen Ausführungen so beantworten, dass dies durchaus möglich ist: Weder die Neuheit oder die Wiederholbarkeit, noch die erfinderische Tätigkeit als Teilaspekte des Erfindungsbegriffes stellen unüberwindbare tatbestandliche Voraussetzungen dar. Allerdings ist für den jeweiligen Einzelfall vor allem kritisch zu prüfen, ob wirklich eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Nach richtiger Auffassung handelt es sich bei der Zufallsmutagenese nicht um ein iWbV im Sinne von Art. 53 lit. b) S. 1 EPÜ. Sieht man dies anders, so ist indes die Rückausnahme gem. Art. 53 lit. b) S. 2 EPÜ für mikrobiologische Verfahren nach richtiger Auffassung im Bereich der Pflanzenzüchtung nicht anwendbar. Zwar ist ein Patentschutz einer mittels Mutagenese erzeugten Pflanze auch über ein Verfahrenspatent auf das Mutageneseverfahren denkbar, das zur unmittelbaren Erzeugung der maßgeblichen genetischen Veränderung in der Pflanze führte. Das Mutageneseverfahren müsste dabei jedoch derart genau beschrieben sein, dass auch ein Erzeugnispatent denkbar wäre.
Es bleibt abschließend festzuhalten, dass ungeachtet der Verbindung von Gentechnikrecht und Patentrecht über die Klammer des Technikrechts beide Materien in rechtspolitischen Diskussionen getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Eine etwaig in der Zukunft erfolgende Änderung des Patentrechts für pflanzenbezogene biotechnologische Erfindungen könnte dementsprechend nicht allein mit der Existenz neuer gentechnikrechtlicher Zulassungsregeln überzeugend begründet werden.
[1] Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus
ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der
Verordnung (EU) 2017/625, COM(2023) 411 final.
[2] Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Statement, S. 3.
[3] Pihlajamaa, GRUR 2022, 949 (950).
[4] Godt, IIC 2018, 512 (523).
[5] Keine Patente auf Saatgut! e.V., Was muss geändert werden?
[6] Eingehend dazu siehe unten C. III.
[7] Zur Einordnung als Gentechnik siehe unten C. I.
[8] Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (BGBl. 1976 II, S. 826), zuletzt geändert durch die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (BGBl. 2007 II, S. 1082).
[9] Spencer-Lopes/Forster u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 1.
[10] Spencer-Lopes/Forster u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 1.
[11] van Harten, S. 10.
[12] van Harten, S. 10.
[13] Spencer-Lopes/Forster u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 1 (2).
[14] de Vries, Vorwort zum ersten Bande.
[15] Muller, Science 66 (1927), 84.
[16] Stadler, Science 68 (1928), 186.
[17] Spencer-Lopes/Forster u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 1.
[18] van Harten, S. 13.
[19] Tollenaar, Genetica 20 (1938), 285 (292).
[20] Udage, The Journal of Agricultural Sciences – Sri Lanka 16 (2021), 466 (467 ff.).
[21] van Harten, S. 31 f.
[22] Spencer-Lopes/Forster u. a.,Manual on Mutation Breeding, S. 1 (2).
[23] Okamura/Umemoto/Onishi, Plant Biotechnology 29 (2012), 209 (210 f.).
[24] van Harten, S. 17; Sigurbjörnsson in Gaul (Hrsg.), Barley Genetics III, 1975, S. 84 ff., zitiert nach van Harten , S. 143, nennt zwei Beispiele für solche Direktmutanten, nämlich die zwei Gerstensorten Luther und Betina, die 1967 bzw. 1970 auf den Markt gebracht wurden.
[25] Spencer-Lopes/Jankuloski u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 5 (6).
[26] Rybiński, International Agrophysics 14 (2000), 227.
[27] Spencer-Lopes/Jankuloski u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 5 (26).
[28] Greene/Codomo u. a., Genetics 164 (2003), 731 (733 ff.).
[29] Tai/Chun u. a., Plant Breeding and Biotechnology 4 (2016), 453.
[30] Spencer-Lopes/Jankuloski u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 5 (19).
[31] Spencer-Lopes/Jankuloski u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 5 (23).
[32] van Harten, S. 120.
[33] Ingelbrecht/Jankowicz-Cieslak u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 51 (61 f.).
[34] Sarsu/Spencer-Lopes u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 205 f.
[35] Sarsu/Spencer-Lopes u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 205 (209 f.).
[36] Sarsu/Spencer-Lopes u. a., Manual on Mutation Breeding, S. 205 (211) unter Verweis auf die Mutant Varieties Database bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).
[37] vgl. van Harten, S. 183.
[38] EFSA Panel on GMO, EFSA Journal 19:11 (2021), 1 (3).
[39] EFSA Panel on GMO, EFSA Journal 19:11 (2021), 1 (16).
[40] Larkin/Scowcroft, Theor. Appl. Genet. 60 (1981), 197. Dieser Effekt wurde auch thematisiert in EuGH, Urteil vom 7.2.2023 – C-688/21, ECLI:EU:C:2023:75 – Confédération paysanne u. a. (Mutagenèse aléatoire in vitro).
[41] Micke/Donini/Maluszynski, Mutation Breeding Review 7 (1990), 1 (15).
[42] Bouma/Ohnoutka, Plant Mutation Breeding for Crop Improvement, S. 127 ff.
[43] van Harten, S. 22.
[44] van Harten, S. 239.
[45] Scarascia-Mugnozza/D’Amato u. a., Plant Mutation Breeding for Crop Improvement, S. 95 (105 f.).
[46] van Harten, S. 285.
[47] Todd, Mutation Breeding Newsletter 36 (1990), 14 f.
[48] Nielen/Forster/Badigannavar, Manual on Mutation Breeding, S. 83 (99 f.).
[49] Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, ABl. L 150/1.
[50] Näheres zur Zufallsmutagenese und dem GVO-Begriff s. unten unter C. I.
[51] Nr. 4.8.4 der IFOAM Regeln Version 2014.
[52] Nr. 4.1.1 der IFOAM Regeln Version 2014 (Fn. 75).
[53] Bund Ökologische Landwirtschaft e.V., S. 11.
[54] Hülsbergen/Schmid u. a., S. 5 f.
[55] Siehe etwa am Beispiel von Reis: Kumar/Chauhan, Mutation Breeding, Genetic Diversity and Crop Adaptation to Climate Change, S. 83.
[56] Kozjac/Meglič, Mutagenesis, S. 195 (210).
[57] Zu diesem Aspekt im Allgemeinen van Harten, S. 38 f.
[58] Jung/Till, Trends in Plant Science 26 (2021), 1258.
[59] Marone/Mastrangelo/Borrelli, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(8), 7122.
[60] Keine Patente auf Saatgut! e.V., Pressemitteilung.
[61] Die entsprechenden Verfahrensdokumente sind im Europäischen Patentregister abrufbar.
[62] Siehe Statistik im Fünften Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie unter anderem hinsichtlich ausreichender Technizität sowie Auswirkungen im Bereich der Pflanzen- und Tierzüchtung, BT-Drucks. 20/3845, S. 14 f.
[63] So offenbar auch Generalanwalt Bobek, Schlussanträge vom 18.1.2018 – C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583, Rn. 66 – Confédération paysanne/Premier ministre.
[64] Siehe etwa bei Godt, IIC 2018, 512 (521 f.).
[65] Wie unten unter D. I. 1. a) ersichtlich ist, widersprechen sich Natürlichkeit und Technizität nicht notwendig.
[66] Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates, ABl. 2001 L 106, 1.
[67] EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583 Ls 1 – Confédération paysanne/Premier ministre.
[68] EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583 Ls 1 – Confédération paysanne/Premier ministre.
[69] Eingehend zum Ganzen Faltus, ZUR 2018, 524 (527 ff.), der zudem auch auf Umgehungsmöglichkeiten hinweist, die sich aus dem Urteil ergeben.
[70] Voigt, Anm. zu EuGH C-528/16, ZLR 2018, 654 (658 f.).
[71] EuGH, Urteil vom 7.2.2023 – C-688/21, ECLI:EU:C:2023:75 – Confédération paysanne u. a. (Mutagenèse aléatoire in vitro).
[72] Für Einzelheiten siehe Spranger, EuZW 2023, 854.
[73] Beschluss (EU) 2019/1904 des Rates vom 8.11.2019, ABl. 2019 L 293, 103.
[74] Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16, COM SWD(2021)92 final, S. 59.
[75] Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus
ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der
Verordnung (EU) 2017/625, COM(2023) 411 final.
[76] Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Statement, S. 3.
[77] Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus
ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der
Verordnung (EU) 2017/625, COM(2023) 411 final, S. 10.
[78] So berichtet Mayr, tagesschau.de vom 5.7.2023.
[79] Siehe den Bericht bei Gersmann, taz.de vom 5.7.2023.
[80] Buchholz, S. 10.
[81] Bioland e.V., Pressemitteilung vom 22.6.23.
[82] Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Ad-hoc Stellungnahme, S. 2.
[83] Abänderungen 33, 69, 291cp1, 230/rev1 und 291cp3 des Europäischen Parlaments vom 7. Februar 2024 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625, Dokument P9_TA(2024)0067.
[84] Deutsche Forschungsgemeinschaft/Leopoldina, Ad-hoc-Stellungnahme. S. 2.
[85] Wanner/Monconduit u. a., Journal of Intellectual Property Law & Practice 2019, 90 (91).
[86] Zech, ZGE 2015, 1 (3 ff.).
[87] Zech, S. 36.
[88] Zech, ZGE 2015, 1 (7).
[89] Zech, S. 54.
[90] Die Grünen/EFA im Europäischen Parlament, Pressemitteilung vom 6.2.2024.
[91] European Parliamentary Research Service, S. 9.
[92] Haedicke in Haedicke/Timmann, § 1 Rn. 1.
[93] Haedicke, Kap. 4 Rn. 34 ff.
[94] Haedicke, Kap. 4 Rn. 34.
[95] Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBl. 2021 I S. 4074) geändert worden ist.
[96] Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II S. 915), zuletzt geändert durch Beschluss des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 21. Oktober 2018 (BGBl. 2009 II, S. 737).
[97] Benkard-EPÜ/Henke, Art. 164 Rn. 8.
[98] Richtlinie 98/44/EG des europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 6. Juli 1988, ABl. L 213, 13.
[99] BGBl. 2021 II, S. 850.
[100] Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht, BGBl. 2023 II, Nr. 75.
[101] Näher dazu und zu den zugehörigen Vorschriften Blanke-Roeser, NJW 2023, 135.
[102] Haedicke, Kap. 6 Rn. 4 f.
[103] BGH, Beschluss vom 27.3.1969 – X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 – Rote Taube.
[104] Näher dazu Ann, § 11 Rn. 2 mit Verweisen auf die Rechtsprechung.
[105] BeckOK/Einsele, § 1 PatG Rn. 27.
[106] BeckOK/Einsele, § 1 PatG Rn. 27 mit Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung.
[107] Haedicke, Kap. 6 Rn. 10.
[108] BGH, Beschluss vom 27.03.1969 – X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 (77) – Rote Taube.
[109] Götting/Hofmann/Zech, § 15 Rn. 2 ff.
[110] Ähnlich Metzger/Zech/Zech/Uhrich, § 1 PatG /Art. 52 EPÜ Rn. 8.
[111] Etwa Haedicke, Kap. 6 Rn. 4 ff.
[112] Vgl. Reichsgericht, Entscheidung vom 20.3.1889, Patentblatt 1889, 209 (212) – Kongorot.
[113] Haedicke, Kap. 6 Rn. 15.
[114] Schulte/Moufang, § 1 PatG Rn. 33 ff.
[115] Büscher/Dittmer/Schiwy/Obenland/von Samson, § 1 PatG Rn. 32 ff.
[116] Zech, ZGE 2010, 314 (316).
[117] Metzger/Zech/Zech/Uhrich, § 1 PatG Rn. 26.
[118] Haedicke, Kap. 6 Rn. 99.
[119] Mes, § 1 PatG Rn. 78.
[120]
Zech, ZGE 2010, 314 (317). Das Argument dürfte übertragbar
sein auf die Gewährung einer Gelegenheit durch das EPA zur
Mängelbeseitigung einer Patentanmeldung gem. Art. 90 Abs. 4 EPÜ in
Verbindung mit Artt. 90 Abs. 3,
78 Abs. 1 lit. b) EPÜ sowie Regel 42 Abs. 1 lit. e) AOEPÜ.
[121] BGH, Beschluss vom 27.3.1969 – X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 (81 f.) – Rote Taube.
[122] BGH, Urteil vom 1.12.1964 – Ia ZR 212/63, GRUR 1965, 298 (301) – Reaktions-Meßgerät.
[123] Büscher/Dittmer/Schiwy/Obenland/von Samson, § 1 PatG Rn. 33 f.
[124] Benkard-EPÜ/Wieser/Kinkeldey, Art. 83 Rn. 71.
[125] Krenn, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 3.
[126] Kirchner, GRUR 1951, 572 (573). Umfangreiche Nachweise zu dem damaligen Streit um die Notwendigkeit des Kriteriums der Wiederholbarkeit bei Pflanzenzüchtungen finden sich bei BGH, Beschluss vom 27.3.1969 – X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 (81 f.) – Rote Taube.
[127] BGH, Beschluss vom 27.3.1969 – X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 (83) – Rote Taube.
[128] Diese referierend Moufang, S. 153 f. mit weiteren Nachweisen auch zur Literatur.
[129] BGH, Beschluss vom 12.02.1987 – X ZB 4/86, BGHZ 100, 67 – Tollwutvirus.
[130] BGH, Beschluss vom 12.02.1987 – X ZB 4/86, BGHZ 100, 67 (72 ff.) – Tollwutvirus.
[131] BGH, Beschluss vom 12.02.1987 – X ZB 4/86, BGHZ 100, 67 (72) – Tollwutvirus.
[132] von Pechmann, GRUR 1987, 475 (477 f.); a.A. Rogge , GRUR 1988, 653 (659).
[133] Neumann, S. 113.
[134] Neumann, S. 113.
[135] BGH, Beschluss vom 12.02.1987 – X ZB 4/86, BGHZ 100, 67 (71) – Tollwutvirus.
[136] Haedicke, Kap. 1 Rn. 14.
[137] Werner, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang); ebenso Kock, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 16 f.
[138] Benkard-PatG/Bacher, § 1 PatG Rn. 96.
[139] Godt, IIC 2018, 512 (523).
[140] Schmidt, GRUR 1952, 168 (169).
[141] Beier/Straus, GRUR 1983, 100 (101).
[142] Schulte/Moufang, § 1 PatG Rn. 78.
[143] Haedicke, Kap 6. Rn. 7.
[144] Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, BGBl. 1976 II, S. 649.
[145] Koszowski/Goniewicz u. a.,Przegląd Lekarski 2007, 908 weisen darauf hin, dass Tabak die erste Pflanze war, die gentechnisch transformiert wurde und zwar erstmals im Jahre 1983.
[146] Formulierung nach Neumeier, S. 76.
[147] Haedicke, Kap. 6 Rn. 52.
[148]
BGH, Beschluss vom 17.01.1995 – X ZB 15/93, BGHZ 128, 270 (276 f.)
– Elektrische Steckverbindung.
[149] Haedicke, Kap. 6 Rn. 52.
[150] Neumeier, S. 80.
[151] So Neumeier, S. 80 mit Blick auf die Verwendung von ganzen Genen.
[152] Götting/Hofmann/Zech, § 23 Rn. 20.
[153] Kock, Research handbook on intellectual property and the life sciences, S. 132 (146 f.) mit Verweisen auf die Patentpraxis des EPA; a.A. offenbar Then, Dissenting Opinion, S. 105 (113).
[154] Haedicke, Kap. 6 Rn. 70.
[155] Haedicke, Kap. 6 Rn. 83.
[156] Jestaedt, GRUR 2001, 939 (941 f.).
[157] Götting/Hofmann/Zech, § 17 Rn. 64.
[158] Neumeier, S. 84.
[159] Lange, GRUR Int. 1985, 88 (90).
[160] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 11.1.1996 – T 386/94, ABl. EPA 1996, 658 – Chymosin/UNILEVER.
[161] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 8.5.1996 – T 694/92, ABl. EPA 1997, 408 – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN.
[162] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 8.5.1996 – T 694/92, ABl. EPA 1997, 408 (426 ff.) – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN.
[163] Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil G, Kapitel VII-28.
[164] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 9.3.2000 – T 737/96, BeckRS 2000, 30632183 Rn. 12 – Asthaxanthin/DSM.
[165] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 9.3.2000 – T 737/96, BeckRS 2000, 30632183 Rn. 13 – Asthaxanthin/DSM.
[166] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 9.3.2000 – T 737/96, BeckRS 2000, 30632183 Rn. 17 – Asthaxanthin/DSM.
[167] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 3.12.2002 – T 1115/97, BeckRS 2002, 30680241 Rn. 12 – Herbicide resistant plant/MGI.
[168] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 3.12.2002 – T 1115/97, BeckRS 2002, 30680241 Rn. 13 – Herbicide resistant plant/MGI.
[169] Siehe auch EPA (TBK 3.3.08), Entscheidung vom 1.2.2011 – T 775/08, BeckRS 2011, 146118 Rn. 36 – Glyphosate tolerant alfalfa/MONSANTO.
[170] Hase/Akita u. a., Plant Biotechnology 29 (2012), 193.
[171] van Harten, S. 32.
[172] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 8.9.2021 – T 2794/19, GRUR-RS 2021, 37898 Rn. 29 – Sorghum herbicide-resistant AHAS/ADVANTA.
[173] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 5.10.2000 – T 333/97, BeckRS 2000 30566463 Rn. 7 ff. – Somatic changes/MONSANTO.
[174] BGH, Beschluss vom 26.9.1967 – I ZB 1/65, BGHZ 48, 313 (322) – Glatzenoperation.
[175] A.A. Benkard-PatG/Deichfuß/Tochtermann, Einl. Rn. 81.
[176] Haedicke, Kap. 6 Rn. 99.
[177] So scheinbar Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV),S. 23 f.
[178] Neumann, S. 115 f.
[179] Pihlajamaa, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 3 merkt an, dass das EPA Patentanmeldungen, die die Gensequenz nicht offenlegen wegen mangelnder Klarheit zurückweist.
[180] EPA (TBK 3.3.04), Entscheidung vom 8.6.2021 – T 420/19, GRUR-RS 2021, 37581 Rn. 65 ff. – Barley derived beverages/CARLSBERG.
[181] Schulte/Moufang, § 34 PatG Rn. 472 mit Verweisen auf unterschiedliche Vorgaben und Regeln.
[182] Zu der in der Vergangenheit umfangreich debattierten Frage, inwieweit der Ausschluss der Patentierung auf Pflanzensorten auch der Patentierung von Pflanzen entgegensteht, s. Bostyn, J World Intellect Prop 2013, 105 (107 ff.).
[183] Umfassend zur Rechtmäßigkeit dieser Vorschrift: EPA (GBK), Stellungnahme vom 14.5.2020 – G 3/19, ABl. EPA 2020, A119, S. 48 ff. – Paprika; sehr kritisch dagegen Cockbain/Sterckx, J World Intellect Prop 2020, 679.
[184] EPA (GBK), Stellungnahme vom 14.5.2020 – G 3/19, ABl. EPA 2020, A119, S. 57 f. – Paprika.
[185] Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil G, Kapitel II-41 f., kritisch zu dieser Disclaimer-Lösung Kock, BSLR, 17(5), 184 (195 ff.).
[186] Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil G, Kapitel II-48.
[187] BeckOK/Fitzner, Art. 53 EPÜ Rn. 61.
[188] Oredsson, NIR 1985, 229 (238).
[189] EPA (TBK 3.3.4), Entscheidung vom 13.10.1997 – T 1054/96, ABl. EPA 1998, S. 511 (527 f.) – transgene Pflanze/NOVARTIS.
[190] Keine Patente auf Saatgut! e.V., S. 3 f.
[191] van de Wiel/Schaart u. a., S. 5 f.
[192] Then sowie Krenn, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 3 und 8.
[193] Godt, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 10.
[194] Moufang, S. 197 f.
[195] Moufang, S. 198.
[196] EPA (TBK 3.3.2), Entscheidung vom 10.11.1988 – T 320/87, ABl. EPA 1990, S. 71 (76 f.) – Hybridpflanzen/LUBRIZOL. Kritisch hierzu Bostyn , BSLR 2006/2007, 146 (150 ff.).
[197] EPA (TBK 3.3.2), Entscheidung vom 21.2.1995 – T 356/93, ABl. EPA 1995, S. 545 (573) – Planzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS.
[198] Zitiert nach EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (143 f.) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK) Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[199] Bostyn, BSLR 2006/2007, 146 (154); ähnlich wohl Kock/Morgan , BSLR, 16(3), 123 (126).
[200] EPA (TBK 3.3.4), Entscheidung vom 13.10.1997 – T 1054/96, ABl. EPA 1998, S. 511 (528) – transgene Pflanze/NOVARTIS.
[201] Auch wenn in der englischen Fassung von einem „trait“ die Rede ist, geht es dabei nicht um die phänotypische Eigenschaft, die im naturwissenschaftlichen Sprachgebrauch häufig auch als „trait“ bezeichnet wird, sondern um den Genotyp. Dies wird deutlich daran, dass in der Entscheidung die Rede ist von einem Schritt „which by itself introduces a trait into the genome “ (Leitsatz 3, Hervorhebung durch den Verf.). An anderer Stelle, wo es um die phänotypische Eigenschaft geht, ist hingegen die Rede von einem „ trait of the plant“ (Nr. 6.1.3 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch den Verf.) oder nur von einem „trait“ (Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Keine Patente auf Saatgut! e.V., S. 6 hingegen setzt explizit den Begriff „trait“ mit der phänotypischen Eigenschaft gleich.
[202] EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (203) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[203] EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (203) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[204] EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (203 f.) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[205] Werner, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 14.
[206] Malek/Hames u. a., epi Information 2012, 16 (19); ebenso Metzger/Zech/Zech/Uhrich, § 2a PatG Rn. 28.
[207] Im Ergebnis ebenso Kock, Research handbook on intellectual property and the life sciences, S. 132 (142 f.); Krauß, MittPatAnw 2011, 279 (283); a.A. offenbar Sterckx/Cockbain, S. 187.
[208] Pihlajamaa, GRUR 2022, 949 (950 f.).
[209] Vorlage des Präsidenten des EPA, Dokument CA/56/17 Rn. 40 ff.; krit. hierzu Then, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 8.
[210] EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (171 f.) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[211] EPA (GBK) Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (171 f.) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[212] Singer/Stauder/Luginbühl/Stauder/Podbielski, Art. 53 EPÜ Rn. 57.
[213] Moufang, S. 198.
[214] Travaux préparatoires zum EPÜ, Dok. IV/2071/61, zitiert nach EPA (TBK 3.3.4), Entscheidung vom 22.5.2007 – T 83/05, ABl. EPA 2007, S. 644 (653 ff.) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE.
[215] EPA (GBK), Entscheidung vom 25.3.2015 – G 2/12, ABl. 2016, A27, S. 42 f. – Staat Israel - Landwirtschaftsministerium/Unilever N.V. (Tomaten II).
[216] vgl. Art. 2 Nr. 2 des Bundesgesetzes, mit dem das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990 und das Patentamtsgebührengesetz geändert werden, Österreichisches BGBl. I Nr. 51/2023.
[217] Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 1955 der Beilagen, XXVII. Gesetzgebungsperiode, S. 6.
[218] Benkard-PatG/Mellulis, § 2a PatG, 49; Kock, Life Science Recht 2018, 54, (56 f.).
[219] EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 2/07, ABl. EPA 2012, S. 130 (184) – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE; gleichlautend EPA (GBK), Entscheidung vom 9.12.2010 – G 1/08, ABl. EPA 2012, S. 206 – Tomaten/STAAT ISRAEL.
[220] Im Ergebnis ebenso Kock, Research handbook on intellectual property and the life sciences, S. 132 (140 f.).
[221] Stevenson, S. 327.
[222] Die englische Fassung der späteren Richtlinie 98/44/EG benutzt in den Entwürfen noch bis 1997 das Verb „based on“, sodass es insoweit einen Gleichlauf mit der deutschen Fassung gab – vgl. Amended proposal for a Directive on the legal protection of biotechnological inventions, COM(97) 446 final.
[223] Dudenredaktion, S. 207.
[224] Benkard-EPÜ/Henke, Art. 177 EPÜ Rn. 3 f.
[225] von Pechmann, GRUR 1985, 717 (722 f.).
[226] Vgl. Neumeier, S. 186 f.
[227] BGBl. 1976 II, S. 649.
[228] Neumeier, S. 187.
[229] BGBl. 1980 II, S. 1104.
[230] Neumeier, S. 187.
[231] Moufang, S. 199 f.; so ausdrücklich auch der deutsche Gesetzgeber in der Denkschrift zum Straßburger Patentübereinkommen, BT-Drucks. 7/3712, S. 379.
[232] Schulte/Moufang, § 2a PatG Rn. 54 f.; Fitzner, S. 58.
[233] Büscher/Dittmer/Schiwy/Obenland/von Samson, § 2a PatG Rn 43.
[234] EPA (TBK 3.3.2), Entscheidung vom 3.10.1990 – T 19/90, ABl. EPA 1990, S. 476 (489 f.) – Krebsmaus/HARVARD.
[235] EPA (TBK 3.3.4), Entscheidung vom 21.2.1995 – T 356/93, ABl. EPA 1995, S. 545 (574) – Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS.
[236] EPA (TBK 3.3.4), Entscheidung vom 21.2.1995 – T 356/93, ABl. EPA 1995, S. 545 (574 ff.) – Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS.
[237] EPA (GBK), Entscheidung vom 20.12.1999 – G 1/98, ABl. EPA 2000, S. 111 (138) – transgene Pflanze/NOVARTIS II.
[238] Regel 27 lit. c) AOEPÜ schließt heute auch durch mikrobiologische Verfahren gewonnene Pflanzensorten ausdrücklich von der Patentierbarkeit aus.
[239] EPA (GBK), Entscheidung vom 20.12.1999 – G 1/98, ABl. EPA 2000, S. 111 (138 f.) – transgene Pflanze/NOVARTIS II.
[240] Teil G, Kapitel II-53.
[241] EPA (GBK), Stellungnahme vom 14.5.2020 – G 3/19, ABl. EPA 2020, A119, S. 54 ff. – Paprika.
[242] Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drucks. 17/14221, S. 1.
[243] So wohl auch Kock, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 18.
[244] Werner, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 18; a.A. Benkard-PatG/Mellulis, § 2a PatG, Rn. 114.
[245] Darauf hinweisend Neumeier, S. 186.
[246] Rüthers/Fischer/Birk, S. 458; siehe allerdings auch BGH, Beschluss vom 25.10.2006 – Az. 1 StR 384/06, NJW 2007, 524 f., wo die amtliche Begründung bzw. Systematik einer betäubungsmittelrechtlichen Vorschrift eine andere Auslegung erforderten.
[247] Vgl. Kock/Zech, GRUR 2017, 1004 (1011 f.).
[248] Werner, zitiert nach Vermerk des BMJV (Anhang), S. 14.
[249] Metzger/Bartels, ZGE 2018, 123 (158 f.).
[250] Metzger/Bartels, ZGE 2018, 123 (158 f.).
[251] Metzger/Bartels, ZGE 2018, 123 (159).
[252] So wohl auch Metzger/Bartels, ZGE 2018, 123 (159).
[253] Das Patent EP3523428 etwa ist sowohl gerichtet auf Tabakpflanzen mit erhöhter Stickstoffeffizienz, als auch auf verschiedene konkret beschriebene Verfahren (u. a. Zufallsmutagenese) zur Erzeugung ebendieser.
Häufig gestellte Fragen zur Patentierbarkeit von Pflanzen, die mittels Zufallsmutagenese erzeugt wurden
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht, inwieweit Pflanzen, die durch Zufallsmutagenese gewonnen wurden, patentierbar sind.
Warum ist dieses Thema von Bedeutung?
Die Debatte um Patente auf Pflanzen wurde durch den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Regulierung von Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken (NGT) gewonnen wurden, neu entfacht. Zudem gibt es Kritik an der Patentierung von Pflanzen, die mittels Zufallsmutagenese erzeugt werden.
Was ist Zufallsmutagenese?
Zufallsmutagenese ist die künstliche Erzeugung zufälliger Mutationen durch mutagene Agenzien, um Pflanzen mit neuen Eigenschaften zu züchten. Es ist eine Form der Gentechnik, die seit Jahrzehnten in der Landwirtschaft eingesetzt wird.
Wie wird Zufallsmutagenese in der Praxis durchgeführt?
Die Zufallsmutagenese umfasst die Auswahl von Pflanzenmaterial, die Anwendung eines mutagenen Agens, das Screening und die Auswahl mutierter Pflanzen über mehrere Generationen hinweg.
Welche Bedeutung hat die Zufallsmutagenese in der Landwirtschaft?
Die Zufallsmutagenese hat zur Verbesserung vieler Pflanzen geführt, z. B. durch Krankheitsresistenzen, größere Erträge und Kältetoleranz. Sie ist besonders wichtig für den ökologischen Landbau, da der Einsatz von NGT dort voraussichtlich verboten bleibt.
Gibt es aktuelle Patente auf Pflanzen, die durch Zufallsmutagenese erzeugt wurden?
Ja, es gibt aktuelle Patenterteilungen, z. B. für Melonenpflanzen mit erhöhten Fruchterträgen, Tomaten mit veränderten Pflanzenhaaren zur Schädlingsbekämpfung, und Weizen mit hohem Stärkegehalt, die durch Zufallsmutagenese erzeugt wurden.
Wie sind die Debatten um Gentechnikrecht und Patente auf Pflanzen miteinander verzahnt?
Die Debatten sind eng verzahnt, da teilweise angenommen wurde, dass genomeditierte Organismen keine GVO seien, wenn sie auch natürlich entstehen könnten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat jedoch entschieden, dass alle mittels Mutagenese erzeugten Organismen GVO sind.
Welche Rolle spielt die Europäische Kommission in dieser Debatte?
Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine Verordnung zu NGT-Pflanzen veröffentlicht und eine Studie zum Status neuartiger genomischer Verfahren im Unionsrecht vorgelegt.
Welche Voraussetzungen müssen für die Patentierbarkeit von Pflanzen erfüllt sein?
Um patentiert zu werden, muss eine Pflanze eine Erfindung im technischen Sinne sein, neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Zudem darf kein Ausschlussgrund vorliegen, wie z. B. ein im Wesentlichen biologisches Verfahren (iWbV).
Was bedeutet "im Wesentlichen biologisches Verfahren" (iWbV)?
Ein iWbV ist ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Die genaue Definition ist jedoch umstritten.
Ist die Zufallsmutagenese ein "im Wesentlichen biologisches Verfahren"?
Nach richtiger Auffassung ist die Zufallsmutagenese kein iWbV, da sie einen technischen Schritt (die künstliche Herbeiführung von Mutationen) beinhaltet, der nicht ausschließlich auf natürlichen Phänomenen beruht. Es gibt allerdings unterschiedliche Interpretationen.
Gilt die Rückausnahme für mikrobiologische Verfahren auch für Pflanzen, die mittels Zufallsmutagenese erzeugt wurden?
Die Rückausnahme für mikrobiologische Verfahren ist in der Pflanzenzüchtung nicht anwendbar, da es sich nach der Rechtsprechung nicht um ein mikrobiologisches Verfahren handelt.
Kann Patentschutz auch durch die Patentierung des Verfahrens der Zufallsmutagenese erreicht werden?
Ja, der Schutz für eine Pflanze kann auch durch ein Verfahrenspatent auf das Mutageneseverfahren erreicht werden, sofern das Verfahren so genau beschrieben ist, dass auch ein Erzeugnispatent denkbar wäre.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Pflanzen, die durch Zufallsmutagenese erzeugt wurden, sind grundsätzlich patentierbar. Allerdings muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Die Diskussionen um Gentechnikrecht und Patentrecht sollten getrennt voneinander betrachtet werden.
- Citar trabajo
- Jens Kahrmann (Autor), 2024, Patentierbarkeit von mittels Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1495575