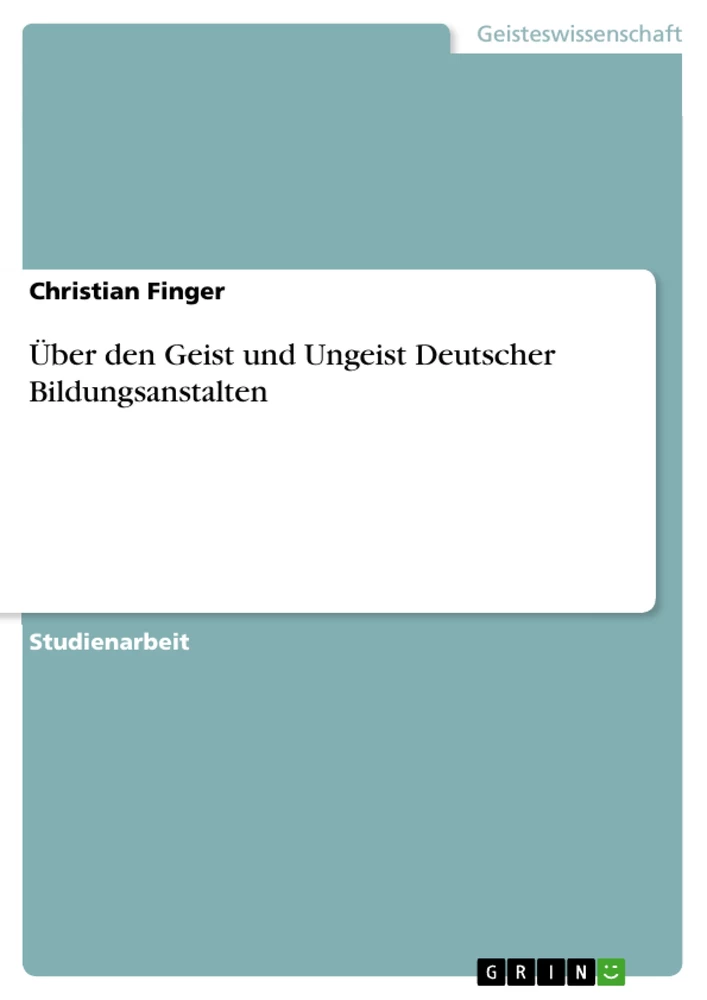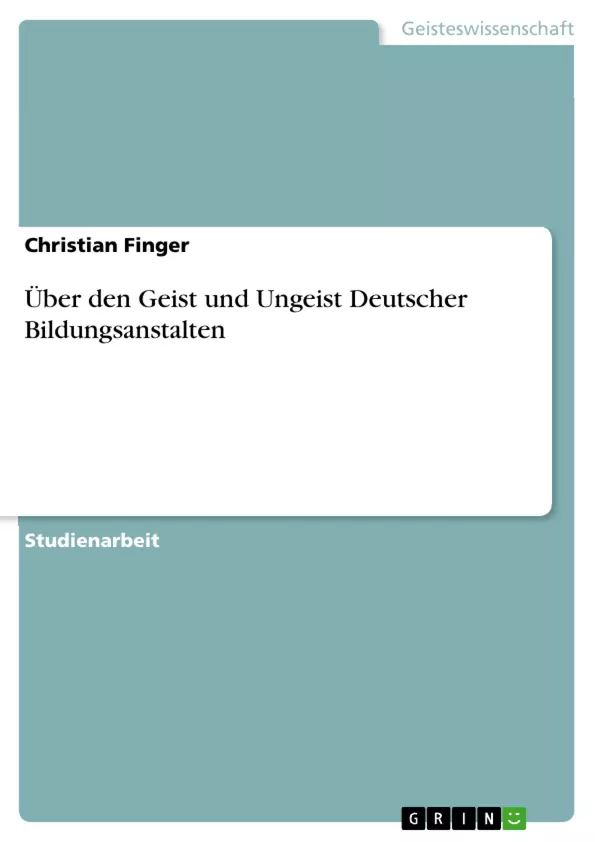Die Fragen nach dem Wesen und der Qualität unserer Bildung und Erziehung – als auch die Versuche ihrer Verbesserung – sind wohl so alt wie die Menschheit selbst. Ziel der modernen westlichen Erziehung ist der eigenständig handelnde und emanzipierte Mensch, der sein Leben gestalten und planen kann. Aus diesem Grund ist auch nichts so zeitgemäß wie die Kritik am Deutschen Bildungswesen: dies zeigen nicht zuletzt die seit einigen Jahren in Deutschland und Europa geführten Debatten um die PISA-Studie und den sogenannten Bologna-Prozess, durch die eine erregt geführte und noch immer anhaltende Bildungsdebatte um das deutsche Bildungssystem erneut entbrannt ist. Dieses Bologna-Prozess genannte Vorhaben zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulwesens bis zum Jahr 2010 hat inzwischen etliche Kritiker wie den in dieser Arbeit zitierten Wiener Philosophen Konrad Paul Liessmann auf den Plan gerufen: dieser bringt in seinem Buch „Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft“ die Befürchtung zum Ausdruck, dass das Studium zunehmend auf rein wirtschaftliche und berufsbezogene Kriterien reduziert und damit das vormalige Bildungsideal aufgegeben werde. Und auch Friedrich Nietzsche – um den es im weiteren Verlauf der Arbeit gehen soll – hat sich seinerzeit ausführlich und kritisch mit seiner zeitgenössischen Bildung und Erziehung auseinandergesetzt. Bereits in seiner Antrittsrede an der Universität Basel als Professor für alte Sprachen äußerte sich Nietzsche 1872 in seinen Basler Bildungsvorträgen „Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ kritisch zu Bildungszielen und Bildungsniveau in den verschiedenen wilhelminischen Bildungsanstalten. In seiner Dritten unzeitgemäßen Betrachtung „Schopenhauer als Erzieher“ von 1874 stellt er dann den „demokratisierenden“ staatlichen Bildungsidealen des soeben gegründeten wilhelminischen Reiches seine „Ethik der Selbstverwirklichung“ entgegen. Sowohl Nietzsches explizite Kritik als auch sein alternatives Erziehungskonzept werden in dieser Arbeit einer ausführlichen Lektüre (Close-Reading-Verfahren) unterzogen. Im Fazit werden Rückschlüsse auf die heutzutage virulenten Bildungsdebatten im Zuge des Bologna-Prozesses gezogen
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Bildung contra Gebildet sein: Nietzsches Kritik an der deutschen Bildung und den Gelehrten um 1870
- 1.1 Friedrich (Nietzsche) der Unzeitgemäße
- 1.2 Nietzsches Kritik an den wilhelminischen Bildungsanstalten und seine Phänomenologie des modernen Gelehrten
- II. Die Existenz gegen den Staat: der Philosoph (Schopenhauer) als Vorbild und Erzieher
- 2.1 Der idealische Schopenhauer als Vorbild und Erzieher
- 2.2 Kultur als Vorbereiterin und Erzeugerin des philosophischen Genius
- III. Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Friedrich Nietzsches Kritik an der deutschen Bildung im 19. Jahrhundert und seiner Forderung nach einer „Ethik der Selbstverwirklichung“. Sie analysiert Nietzsches Basler Vorträge „Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ und seine dritte unzeitgemäße Betrachtung „Schopenhauer als Erzieher“. Ziel ist es, Nietzsches Kritik an den wilhelminischen Bildungsidealen zu beleuchten und seine alternative Vorstellung von Bildung zu erörtern.
- Nietzsches Kritik an der deutschen Bildung und den Gelehrten um 1870
- Die Phänomenologie des modernen Gelehrten in Nietzsches Werk
- Nietzsches Forderung nach einer „Ethik der Selbstverwirklichung“
- Die Rolle Schopenhauers als Vorbild und Erzieher in Nietzsches Philosophie
- Die Bedeutung von Kultur für die Entwicklung des philosophischen Genius
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildung und Erziehung ein und stellt die Bedeutung dieser Themen für die Gesellschaft dar. Sie beleuchtet die Geschichte des Bildungsbegriffs und diskutiert die verschiedenen Interpretationen von Bildung. Des Weiteren wird auf aktuelle Bildungsdebatten wie die PISA-Studie und den Bologna-Prozess eingegangen.
I. Bildung contra Gebildet sein: Nietzsches Kritik an der deutschen Bildung und den Gelehrten um 1870
Dieses Kapitel untersucht Nietzsches Kritik an der deutschen Bildung im 19. Jahrhundert. Es analysiert seine Kritik an den wilhelminischen Bildungsanstalten und seine Phänomenologie des modernen Gelehrten. Der Fokus liegt dabei auf Nietzsches Schriften „Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ und „Schopenhauer als Erzieher“.
II. Die Existenz gegen den Staat: der Philosoph (Schopenhauer) als Vorbild und Erzieher
Dieses Kapitel befasst sich mit Nietzsches Vorstellung vom Philosophen Schopenhauer als Vorbild und Erzieher. Es analysiert Schopenhauers Einfluss auf Nietzsches Bildungskonzept und beleuchtet die Bedeutung von Kultur für die Entwicklung des philosophischen Genius.
III. Resumée
Das Resumée fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen und stellt die zentralen Argumente und Erkenntnisse dar.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Arbeit sind: Friedrich Nietzsche, deutsche Bildung, wilhelminische Bildungsideale, Ethik der Selbstverwirklichung, Schopenhauer als Erzieher, Kulturkritik, Phänomenologie des modernen Gelehrten, Bildungsanstalten, Bildungsideale.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisierte Friedrich Nietzsche am deutschen Bildungssystem um 1870?
Nietzsche kritisierte das sinkende Bildungsniveau und die Reduzierung von Bildung auf rein wirtschaftliche und staatliche Zwecke, was er als „Unbildung“ bezeichnete.
Was versteht Nietzsche unter der „Ethik der Selbstverwirklichung“?
In seiner Schrift „Schopenhauer als Erzieher“ stellt er dem staatlichen Bildungsideal die Idee gegenüber, dass wahre Bildung der individuellen Selbstentfaltung und dem Werden der eigenen Persönlichkeit dienen muss.
Welche Rolle spielt Arthur Schopenhauer in Nietzsches Bildungskonzept?
Schopenhauer dient Nietzsche als Vorbild und „Erzieher“, da er eine Existenz jenseits staatlicher Vorgaben verkörpert und den Fokus auf die Entwicklung des philosophischen Genius legt.
Was ist der Unterschied zwischen „Bildung“ und „Gebildet sein“?
Nietzsche unterscheidet zwischen dem oberflächlichen Gelehrtentum (Gelehrten-Phänomenologie) und einer tiefgreifenden kulturellen Bildung, die den Menschen innerlich transformiert.
Welche Parallelen zieht die Arbeit zum heutigen Bologna-Prozess?
Kritiker wie Konrad Paul Liessmann sehen im Bologna-Prozess eine Bestätigung von Nietzsches Befürchtung, dass das Studium zunehmend auf berufsbezogene Kriterien reduziert wird.
Was war das Ziel von Nietzsches Basler Bildungsvorträgen?
Er wollte die Öffentlichkeit auf die Fehlentwicklungen in den wilhelminischen Bildungsanstalten aufmerksam machen und eine Debatte über die wahre Zukunft der Bildung anstoßen.
- Quote paper
- Christian Finger (Author), 2005, Über den Geist und Ungeist Deutscher Bildungsanstalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149630