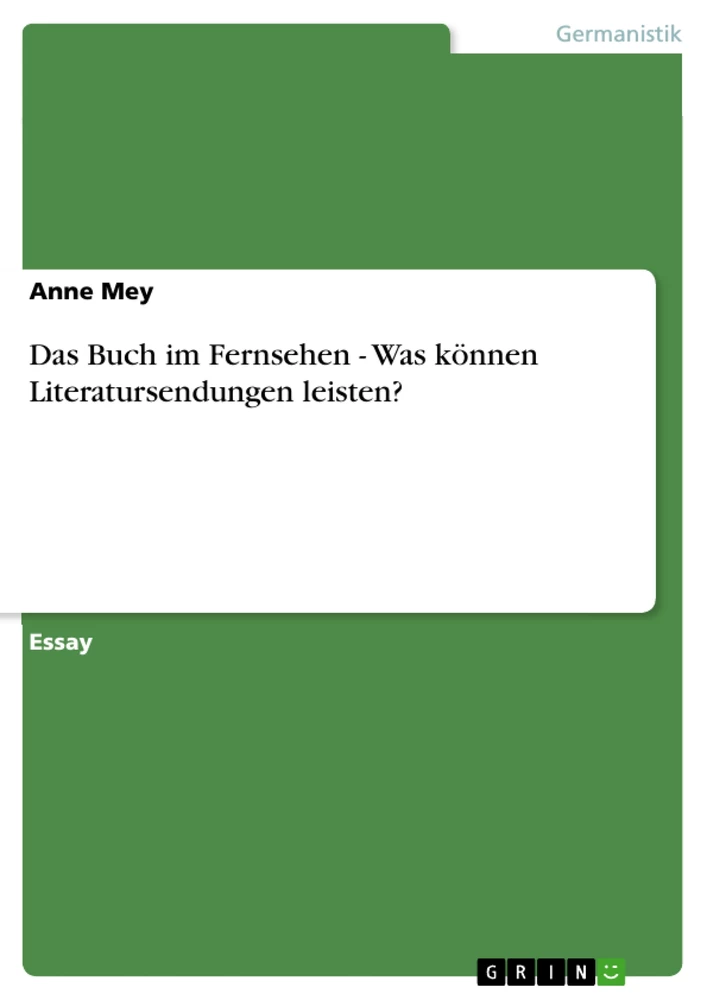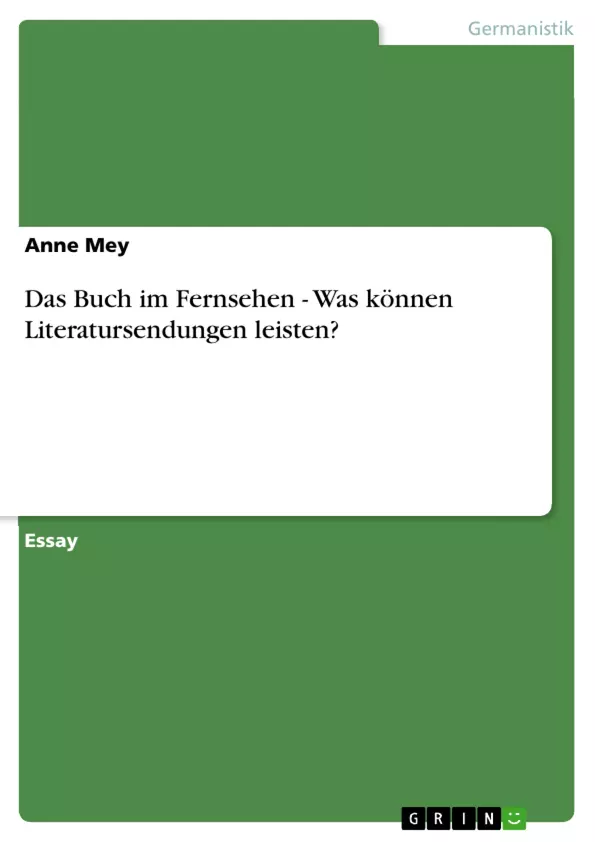Das Massenmedium Fernsehen erreicht den Großteil der Bevölkerung in Deutschland. Fast jeder besitzt einen Fernseher und schaltet diesen täglich im Schnitt für 2 bis 3 Stunden ein. Jeden Tag zu einem Buch griffen im Jahr 2008 jedoch nur 8% der deutschen Bevölkerung. Was passiert, wenn man das Buch via Fernseher in die Haushalte bringt? Kann das Fernsehen zu Literaturrezeption anregen?
Im Folgenden soll zunächst erarbeitet werden, was eine Literatursendung leisen soll und kann und inwiefern sie die Zielgruppe und das weniger lesefreudige Publikum, auf das ein Fokus gelegt werden soll, ansprechen kann. Im An-schluss werden drei verschiedene Literaturformate und ihre Leistung für das Fernsehpublikum exemplarisch vorgestellt. Im Schlussteil folgt ein Resumée und Ausblick über Literaturformate im Fernsehen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Massenmedium Fernsehen erreicht den Großteil der Bevölkerung in Deutschland
- Was muss eine Literatursendung leisten, damit sie das Publikum trotz des späten Programmplatzes anspricht?
- Ein wesentlicher Punkt bei der Ansprache von allen sozialen Schichten ist bei der Umsetzung der Sendungen zu suchen
- Verschiedene Formen von Literaturkritik im Fernsehen sollen im Nachfolgenden aufgezeigt werden
- Zu einer der erfolgreichsten Literatursendungen im deutschen Fernsehen zählt „druckfrisch“ mit Denis Scheck
- 2003 startete im ZDF die Literatur-Talkshow „Lesen!“ mit Elke Heidenreich
- Die Sendung „Lesen!“ sieht Emily Mühlfeld als Wegbereiter für die Sendung „Was liest du?“ im WDR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle von Literatursendungen im deutschen Fernsehen und untersucht, wie sie das Publikum ansprechen und zum Lesen anregen können. Dabei werden die Herausforderungen und Potenziale dieser Sendungen im Kontext der Medienlandschaft beleuchtet.
- Die Relevanz von Literatursendungen im digitalen Zeitalter
- Die Herausforderungen der Programmgestaltung und -platzierung
- Die Bedeutung von Unterhaltung und Ansprache für ein breites Publikum
- Die Rolle von Literaturkritik und Rezeption in Fernsehformaten
- Die Entwicklung und Diversifizierung von Literatursendungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Fernsehens als Massenmedium und stellt den geringen Anteil von Buchlesern in Deutschland gegenüber. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Fernsehen Literaturrezeption anregen kann.
Kapitel zwei analysiert die Herausforderungen, die Literatursendungen im Fernsehen bewältigen müssen, insbesondere die späten Sendezeiten und die Konkurrenz zu Unterhaltungsformaten. Es wird diskutiert, wie die Sendungen das Publikum trotz des Desinteresses an Literatur ansprechen können.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Präsentation von Literatur im Fernsehen und argumentiert, dass eine rein literarische Präsentation für das Fernsehpublikum nicht geeignet ist. Es werden wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Literatursendungen genannt, wie z.B. ein einfacher Zugang, Alltagssprache und eine verständliche Präsentation.
Kapitel vier diskutiert die Rolle von Literaturkritik im Fernsehen und wie sie das Publikum zum Lesen anregen kann. Es wird betont, dass die Sendungen nicht die Lektüre ersetzen, sondern als Appetitanreger und Wegweiser dienen sollen.
Im fünften Kapitel werden drei verschiedene Literatursendungen im deutschen Fernsehen vorgestellt: „druckfrisch“ mit Denis Scheck, „Lesen!“ mit Elke Heidenreich und „Was liest du?“ mit Jürgen von der Lippe. Die Sendungen werden hinsichtlich ihrer Zielgruppe, ihrer Gestaltung und ihrer Leistung für das Fernsehpublikum analysiert.
Schlüsselwörter
Literatursendungen, Fernsehen, Literaturrezeption, Medienlandschaft, Programmgestaltung, Publikum, Unterhaltung, Literaturkritik, Rezeption, Sendungsformate, „druckfrisch“, „Lesen!“, „Was liest du?“, Denis Scheck, Elke Heidenreich, Jürgen von der Lippe.
Häufig gestellte Fragen
Können Literatursendungen im Fernsehen zum Lesen anregen?
Ja, die Arbeit untersucht, wie TV-Formate als "Appetitanreger" fungieren können, um auch ein weniger lesefreudiges Publikum für Bücher zu begeistern.
Warum werden Literatursendungen oft auf späte Sendeplätze verbannt?
Aufgrund geringerer Einschaltquoten im Vergleich zu Massenunterhaltung werden sie von Sendern häufig in das Nachtprogramm verschoben, was die Reichweite einschränkt.
Was macht die Sendung "druckfrisch" mit Denis Scheck besonders?
Die Sendung zeichnet sich durch eine unkonventionelle Inszenierung, klare Urteile und eine bildstarke Sprache aus, die Literatur modern präsentiert.
Welchen Ansatz verfolgte Elke Heidenreich mit "Lesen!"?
Heidenreich setzte auf emotionale Begeisterung und Alltagssprache, um Schwellenängste abzubauen und Literatur für alle sozialen Schichten zugänglich zu machen.
Ist Literaturkritik im Fernsehen noch zeitgemäß?
Die Arbeit argumentiert, dass sie als Orientierungshilfe in der Flut der Neuerscheinungen wichtig bleibt, sofern sie unterhaltsam und verständlich aufbereitet ist.
- Arbeit zitieren
- Anne Mey (Autor:in), 2010, Das Buch im Fernsehen - Was können Literatursendungen leisten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149636