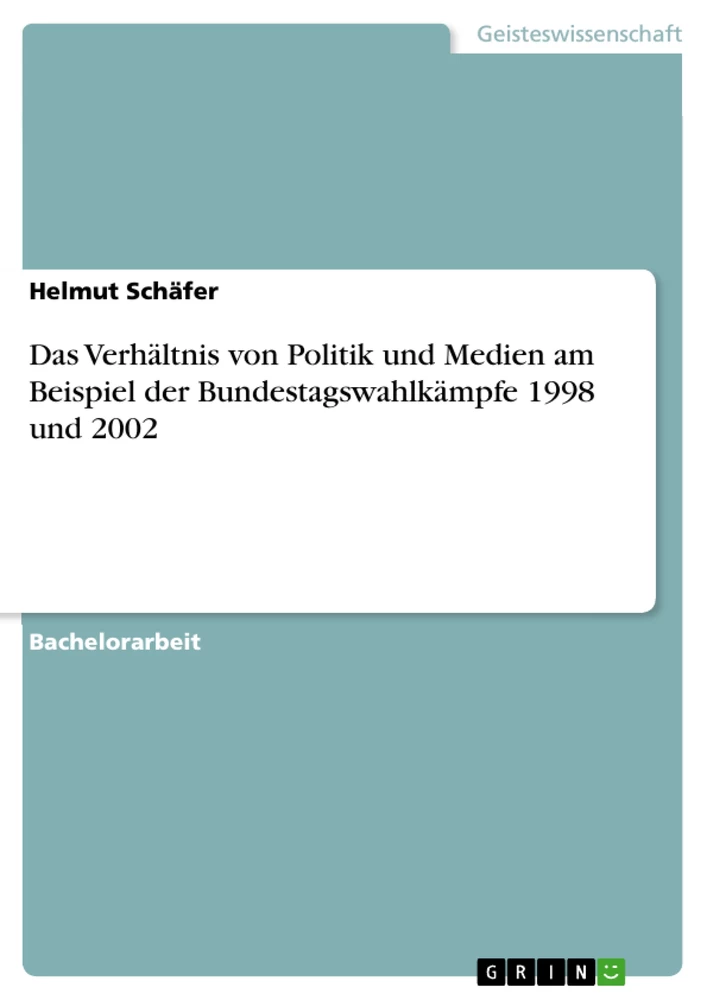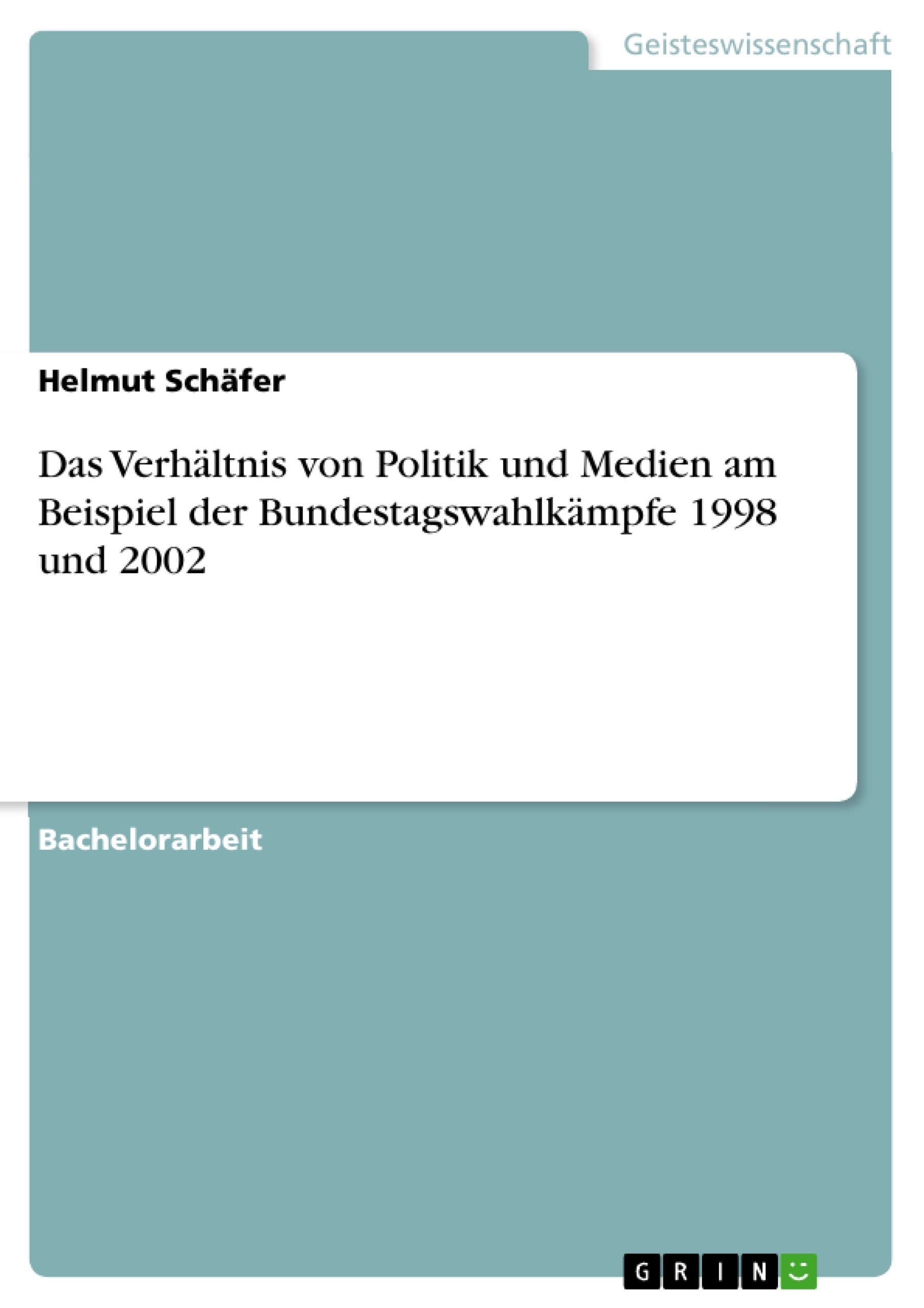Zentrale Ausgangsfrage und Hypothesenbildung
Es geht also nicht darum, wie politische Berichterstattung auf den Zuschauer wirkt. Vielmehr leitet mich die Frage, wie das Zusammenspiel von politischen Akteuren in Parteien, Parlamenten und Regierungen auf der einen und in den Medien, die wie Frank Brettschneider behauptet, inzwischen selbst zum politischen Akteur avanciert sind, auf der anderen Seite aussieht. Daran anschließend vermute ich, dass Politik und Medien die Themen des politischen Kommunikationsprozesses in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander bestimmen. So gehe ich davon aus, dass das von Ulrich von Alemann entwickelte und unter Punkt 2.3.4. vorgestellte Biotop-Modell sich heute am besten eignet, um das unterstellte, wechselseitige Verhältnis zwischen Politik und dem Medium Fernsehen in Wahlkämpfen zu beschreiben.
Aufbau der Arbeit
Im Anschluss an diese Vorbemerkungen wird der theoretische Bezugsrahmen des Themas behandelt. Zunächst definiere ich die zentralen Begriffe und erörtere dann den politischen Kommunikationsprozess sowie die damit einhergehende Legitimationsfrage. Danach skizziere ich vier Modelle, die versuchen, die Beziehungen der am politischen Kommunikationsprozess beteiligten Akteure, nämlich Politiker, Journalisten und Bürger, zu beschreiben. Entsprechend meiner Arbeitshypothese werden dann die wechselseitigen Einflussmöglichkeiten der Zentralakteure in Politik und Medien diskutiert.
Im dritten Kapitel wird anhand der Bundestagswahlkämpfe und der entsprechenden Fernsehberichterstattung in den Jahren 1998 und 2002 überprüft, wie sich die vermutete Symbiose zwischen Politikern und Fernsehjournalisten tatsächlich darstellt. Zahlreiche empirische Untersuchungen werden diskutiert, um die beiden Wahlkämpfe, analytisch voneinander getrennt zu untersuchen. Zur Überprüfung der Ausgangsthese werden zentrale Tendenzen in der Wahlkampfführung und der Wahlkampfberichterstattung herangezogen. Mediatisierung, Personalisierung und Inszenierung der Politikvermittlung 1998 sind dabei ebenso Untersuchungsgegenstände wie konkrete Ereignisse, beispielsweise die 2002 erstmals durchgeführten TV-Duelle. Zur weiteren Diskussion meiner These werden die Berichterstattung in den Fernsehnachrichten und die zunehmende Bedeutung von Medien-Events behandelt. Leitend bleibt hierbei immer die Frage, welcher Akteur die Themen des politischen Kommunikationsprozesses bestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Vorbemerkung
- Themenfindung und Abgrenzung
- Zentrale Ausgangsfrage und Hypothesenbildung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Definitionen zentraler Begriffe
- Wahlen und Wahlkampf
- Akteure: Politiker, Journalisten, Bürger
- Politische Kommunikation und die Legitimationsfrage
- Die Rolle der Medien im Zusammenwirken mit den politischen Ak-teuren: vier Beziehungsmodelle
- Top-Down-Modell
- Mediokratie-Modell
- Bottom-Up-Modell
- Biotop-Modell
- Einflussmöglichkeiten der Akteure
- Bedeutung der Medienlogik und Nachrichtenwerte für die Politik
- Instrumentalisierung der Medien durch die Politik
- Definitionen zentraler Begriffe
- Wahlkampfberichterstattung im deutschen Fernsehen
Überprüfung des Biotop-Modells
- Bundestagswahlkampf 1998
- Strategien, Themen und Organisation der im Bundestag vertrete-nen Parteien
- Mediatisierung, Personalisierung und Entideologisierung der Politikver-mittlung
- Professionalisierung des Kommunikationsmanagements: Interes-senvermittlung durch Massenmedien und Demoskopie
- Bundestagswahlkampf 2002
- Strategien, Themen und Organisation der im Bundestag vertrete-nen Parteien
- Agenda-Setting der Politik: Personalisierung, Polarisierung und Privatisierung
- TV-Duelle
- Berichterstattung in den Fernsehnachrichten
- Ungeplante Medienereignisse: die Flut und der Irak-Krieg
- Inszenierungen: Medien-Events, Pseudo-Ereignisse
- Bundestagswahlkampf 1998
- Zusammenfassendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Politik und Medien am Beispiel der Bundestagswahlkämpfe 1998 und 2002. Sie zielt darauf ab, die wechselseitigen Einflussmöglichkeiten der beteiligten Akteure – Politiker, Journalisten und Bürger – zu analysieren und die Bedeutung der Medienlogik und Nachrichtenwerte im politischen Kommunikationsprozess zu beleuchten.
- Analyse des Zusammenspiels von Politik und Medien im Wahlkampfkontext
- Untersuchung der Medienberichterstattung im deutschen Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf das Biotop-Modell
- Bedeutung von Mediatisierung, Personalisierung und Inszenierung in der politischen Kommunikation
- Einfluss von Medienereignissen und Agenda-Setting auf den Wahlkampfverlauf
- Rolle des Fernsehens als Leitmedium im politischen Kommunikationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer einleitenden Vorbemerkung, die die Themenfindung und Abgrenzung, die zentrale Ausgangsfrage und die Hypothesenbildung sowie den Aufbau der Arbeit beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen erörtert, wobei zentrale Begriffe definiert, der politische Kommunikationsprozess und die Legitimationsfrage behandelt sowie verschiedene Beziehungsmodelle zwischen Politik und Medien vorgestellt werden. Das dritte Kapitel analysiert die Bundestagswahlkämpfe 1998 und 2002 anhand der Fernsehberichterstattung und untersucht die Strategien der Parteien, die Mediatisierung der Politik und die Bedeutung von Medienereignissen.
Schlüsselwörter
Politische Kommunikation, Medien, Wahlkampf, Bundestagswahl, Fernsehen, Biotop-Modell, Mediatisierung, Personalisierung, Inszenierung, Nachrichtenwerte, Agenda-Setting, Legitimation, Akteure, Politik, Journalismus, Bürger.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Biotop-Modell" im Kontext von Politik und Medien?
Das von Ulrich von Alemann entwickelte Biotop-Modell beschreibt das Verhältnis zwischen Politikern und Medien als eine Symbiose, in der beide Seiten in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander Themen bestimmen.
Wie unterschieden sich die Wahlkämpfe 1998 und 2002 medial?
Während 1998 die Personalisierung und Modernisierung im Vordergrund standen, markierte das Jahr 2002 mit den ersten TV-Duellen und der Reaktion auf Ereignisse wie die Flutkatastrophe eine neue Stufe der Mediatisierung.
Was bedeutet "Mediatisierung" der Politik?
Mediatisierung beschreibt den Prozess, bei dem sich das politische System zunehmend an die Logik und die Funktionsweisen der Massenmedien (z. B. Nachrichtenwerte, Inszenierung) anpasst.
Welche Rolle spielen TV-Duelle für den Wahlausgang?
TV-Duelle verstärken die Personalisierung des Wahlkampfs und dienen als zentrale Medien-Events, die die Aufmerksamkeit massiv auf die Spitzenkandidaten lenken und das Agenda-Setting beeinflussen.
Wer bestimmt die Themen im politischen Kommunikationsprozess?
Die Arbeit untersucht, ob eher die politischen Akteure (Agenda-Setting) oder die Medien durch ihre Auswahlkriterien (Nachrichtenwerte) die Oberhand bei der Themengestaltung behalten.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Helmut Schäfer (Auteur), 2005, Das Verhältnis von Politik und Medien am Beispiel der Bundestagswahlkämpfe 1998 und 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149653