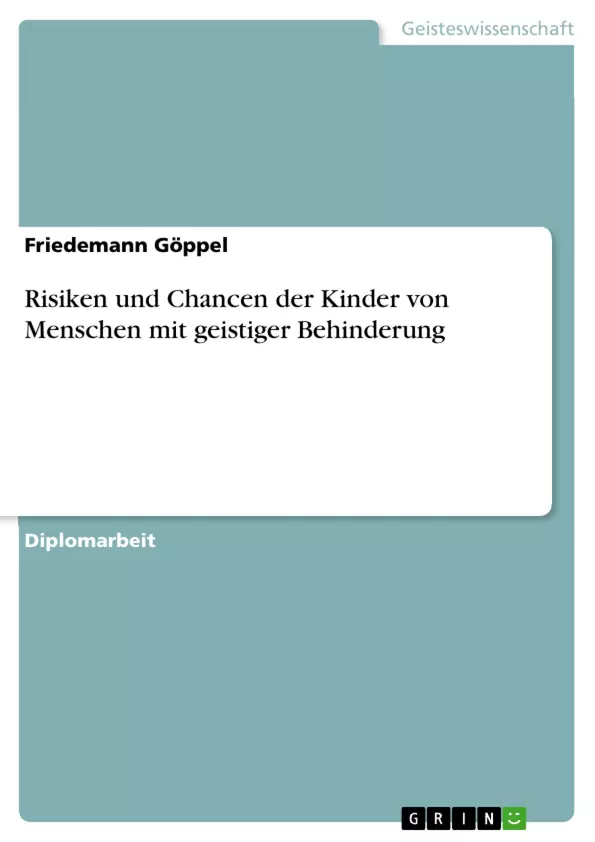Menschen mit geistiger Behinderung wurde das Bedürfnis nach und insbesondere das Recht auf Sexualität lange abgesprochen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten geht hier eine Veränderung vor sich. Sexualität wird seither mehr und mehr auch für diese Menschen als einem selbstbestimmten Leben zugehörig gesehen und zu größeren Teilen auch unterstützt. Dies hat zur logischen Folge, dass die Möglichkeit von Schwangerschaften bei Frauen mit geistiger Behinderung vermehrt gegeben ist.
Die Frage, die sich gleich danach stellt, ist die der Elternschaft. Hier sind nun zwei Perspektiven von Bedeutung, die nicht nur auf die Situation geistig behinderter Menschen zutreffend sind. Die eine Perspektive bezieht sich auf das Recht von Menschen mit geistiger Behinderung auf freie Entfaltung ohne Benachteiligung, welches aus dem Grundgesetz zu definieren ist und die Elternschaft einschließt.
Die andere Perspektive richtet sich auf das Recht der Kinder, denen ebenfalls freie Entfaltung, die dazugehörigen positiven Entwicklungsmöglichkeiten, Geborgenheit usw. zugestanden wird.
Diese beiden Perspektiven können nun einander widersprechen oder gar ausschließen.
Sind nun Menschen mit geistiger Behinderung in der Lage, ihre Kinder zu erziehen? Wenn ja in welchem Maße? In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass diese Personengruppe unter bestimmten Voraussetzungen und mit adäquater Unterstützung in der Lage sei, ihre Kinder zu erziehen.
Der hier oft als weniger von Belang angesehene elterliche IQ ist dabei m.E. im Kontext der gesamten familiären Situation, die nicht selten als Multiproblemmilieu bezeichnet werden muss, dennoch zu berücksichtigen.
Wie viele bzw. welche Kompetenzen bezüglich Elternschaft gefordert sind und wie viele davon erworben werden können, ist eine entscheidende Frage.
Wie viel daraus folgende Unterstützung von staatlicher Seite überhaupt bezahlt werden kann ist durchaus von Fall zu Fall eine spannende Frage.
Praktizierte Unterstützung, welche fehlende elterliche Kompetenzen kompensieren soll, steht in Gefahr, Elternschaft besagten Personenkreises infrage zu stellen. Tätige Helfer bzw. Angehörige können demnach zuweilen, z.B. aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit oder wegen objektiver Gegebenheiten, die Autonomie der Eltern einschränken, damit deren Selbstwertgefühl reduzieren und mit ihnen als Bezugsperson konkurrieren. Es stellt sich also durchaus schwierig dar, die richtige Maßnahme für die jeweilige Familie zu ergreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von geistiger Behinderung und Zielgruppe
- Begrifflichkeiten für geistige Behinderung
- Versuch einer Definition geistiger Behinderung
- Abgrenzung der Zielgruppe für meine Arbeit
- Einblick in Literatur und Forschung bezüglich der Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung
- Mythen bezüglich Eltern mit geistiger Behinderung
- Geschichtlicher Überblick über die Forschung bezüglich der Kinder
- Beschreibung und Bewertung der Situation der Kinder
- Beschreibung und Bewertung der elterlichen Kompetenzen und ihrer Auswirkungen für die Kinder
- Beschreibung und Bewertung der kindlichen Reaktionen
- Zusammenfassung der Literatur und Forschung zum Thema
- Rechtliche Aspekte bezüglich Kindern und deren Eltern mit geistiger Behinderung
- Verfassungsrechtliche Aspekte zu Kindern von Eltern mit geistiger Behinderung
- Sorgerechtliche Aspekte zu Kindern von Eltern mit geistiger Behinderung
- Anwendung richterlicher Entscheidungen anhand eines Praxisbeispiels
- Zusammenfassung rechtlicher Aspekte zum Thema
- Darstellung der Problematik Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung aus Sicht der Betroffenen
- Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung als Experten ihrer Situation
- In der Ursprungsfamilie unterbrochen durch einen Heimaufenthalt
- In der Großfamilie
- Nach der Ursprungsfamilie in Pflegefamilien
- In Wohngruppen mit professioneller Unterstützung
- Wechsel zwischen Ursprungsfamilie, Heim und Verwandtschaft
- Zusammenfassung und Bewertung der eigenen Darstellung der Kinder
- Bezugspersonen der Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung
- Bewertung der Eltern
- Bewertung durch nahestehende Verwandte
- Sichtweise professioneller Fachkräfte bezüglich Kindern von Menschen mit geistiger Behinderung
- Zusammenfassung Darstellung aus Sicht der Betroffenen
- Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung als Experten ihrer Situation
- Vorhandene Systeme und Lösungsansätze im Blick auf die Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung
- Professionelle Unterstützungssysteme für Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kinder
- Professionelle Ansätze und Konzepte anderer Länder
- Professionelle Unterstützungsangebote in Deutschland
- Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kinder in Form vorhandener Ressourcen
- Fremdplatzierung der Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung
- Grundlegendes zu Fremdplatzierung
- Vollzeitpflege
- Annahme an Kindes statt
- Bewertung Fremdplatzierung
- Zusammenfassung und Bewertung vorhandener Systeme und Lösungsansätze
- Professionelle Unterstützungssysteme für Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kinder
- Zusammenfassung und persönliche Einschätzung
- Zusammenfassung der Ausführungen
- Persönliche Einschätzung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der komplexen Thematik der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie analysiert die Risiken und Chancen, die für die Kinder dieser Eltern entstehen, und beleuchtet die Situation aus verschiedenen Perspektiven, darunter die der Kinder selbst, ihrer Bezugspersonen und professioneller Fachkräfte. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Problematik zu zeichnen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen für Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung
- Die Lebensrealität von Kindern von Eltern mit geistiger Behinderung, insbesondere im Hinblick auf ihre Erfahrungen mit Fremdplatzierung und Unterstützungssystemen
- Die Bedeutung von elterlichen Kompetenzen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder
- Die Rolle professioneller Fachkräfte in der Unterstützung von Familien mit geistiger Behinderung
- Die Notwendigkeit einer sensiblen und bedarfsgerechten Unterstützung für Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung ein und erläutert den persönlichen und beruflichen Hintergrund des Autors. Sie stellt die Relevanz des Themas heraus und skizziert die Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Sexualität und Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung.
Kapitel 2 definiert den Begriff der geistigen Behinderung und grenzt die Zielgruppe der Arbeit ein. Es werden verschiedene Begrifflichkeiten und Definitionen von geistiger Behinderung diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die Thematik zu schaffen.
Kapitel 3 bietet einen umfassenden Einblick in die Literatur und Forschung zum Thema Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden Mythen und historische Entwicklungen beleuchtet, die Situation der Kinder beschrieben und die elterlichen Kompetenzen sowie die kindlichen Reaktionen analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit den rechtlichen Aspekten, die für Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung relevant sind. Es werden verfassungsrechtliche und sorgerechtliche Aspekte beleuchtet und anhand eines Praxisbeispiels die Anwendung richterlicher Entscheidungen verdeutlicht.
Kapitel 5 stellt die Problematik aus der Sicht der Betroffenen dar. Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung schildern ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven, die sich aus unterschiedlichen Lebensentwürfen ergeben, wie z.B. in der Ursprungsfamilie, in Pflegefamilien oder in Wohngruppen. Die Sichtweisen von Bezugspersonen und professionellen Fachkräften werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 6 analysiert vorhandene Systeme und Lösungsansätze im Blick auf die Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden professionelle Unterstützungssysteme für Eltern und Kinder vorgestellt, sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern. Die Möglichkeiten der Fremdplatzierung, wie z.B. Vollzeitpflege und Annahme an Kindes statt, werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, die Situation der Kinder dieser Eltern, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unterstützungssysteme, die Fremdplatzierung und die Bedeutung von elterlichen Kompetenzen. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung verbunden sind, und plädiert für eine bedarfsgerechte und sensible Unterstützung für alle Beteiligten.
Häufig gestellte Fragen
Dürfen Menschen mit geistiger Behinderung Eltern werden?
Ja, das Recht auf Elternschaft leitet sich aus dem Grundgesetz (freie Entfaltung der Persönlichkeit) ab. Die Arbeit untersucht die Chancen und Risiken dieser Elternschaft.
Welche Unterstützungssysteme gibt es für diese Familien?
Es gibt professionelle Hilfen wie die begleitete Elternschaft, ambulante Unterstützung sowie stationäre Wohngruppen für Eltern und Kinder.
Welche Risiken bestehen für die Kinder?
Risiken können in einer mangelnden Förderung der kindlichen Entwicklung oder in einem instabilen sozialen Umfeld (Multiproblemmilieu) liegen.
Was bedeutet "Fremdplatzierung" in diesem Kontext?
Wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, kann eine Unterbringung in Pflegefamilien oder Heimen notwendig werden, was in der Arbeit kritisch bewertet wird.
Wie wichtig ist der elterliche IQ für die Erziehung?
Der elterliche IQ wird oft überschätzt; entscheidender sind die sozialen Kompetenzen und die Bereitschaft, professionelle Hilfe anzunehmen.
- Citar trabajo
- Friedemann Göppel (Autor), 2009, Risiken und Chancen der Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149661