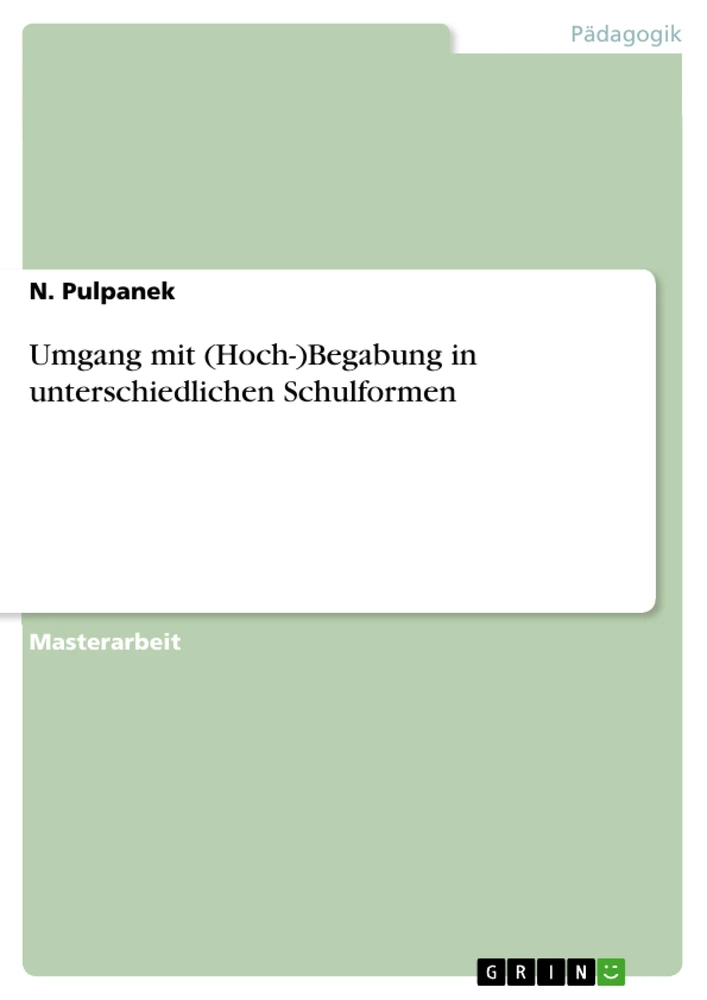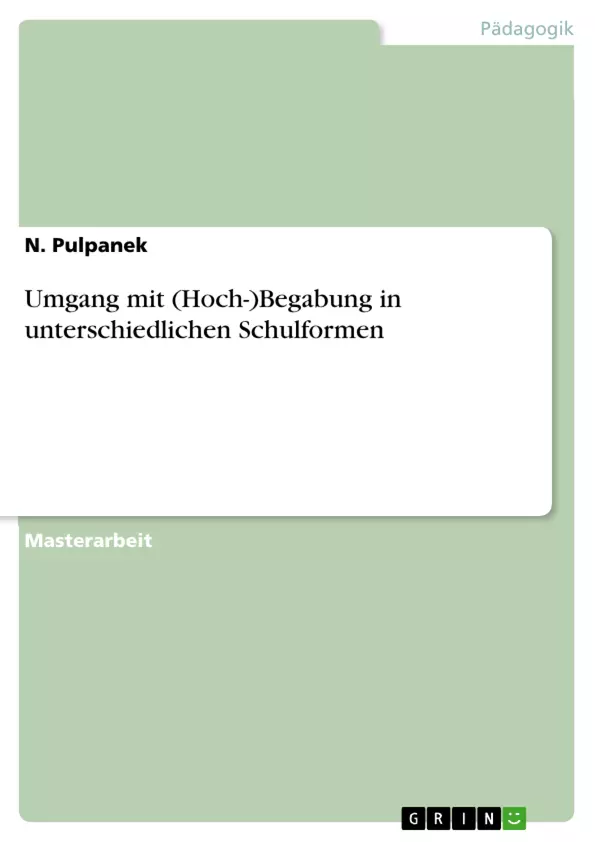Unter Berücksichtigung dieser Forschungsstände untersucht die vorliegende Arbeit die Sichtweisen von Lehrkräften unterschiedlicher Schulformen auf das Thema (Hoch-)Begabung und geht der Frage nach: „Welche Sichtweisen besitzen Lehrer*innen auf das Thema (Hoch-)Begabung und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich durch diese im Umgang mit (hoch-)begabten Schüler*innen in der schulischen Praxis?“ Mit Blick auf dieser Fragestellung wird im ersten Hauptteil der theoretischen Fundierung eine Definition der Begriffe „Begabung“ und „Hochbegabung“ unter Abgrenzung zu den Begriffen „Intelligenz“ und „Talent“ geliefert. Daran anschließend werden im dritten Kapitel insgesamt drei Hochbegabungsmodelle beleuchtet, die ein mehrdimensionales Begriffsverständnis von (Hoch-)Begabung aufweisen. Im darauffolgenden vierten Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit Verfahren zur Feststellung einer (Hoch-)Begabung, ehe im fünften Kapitel Maßnahmen zur Förderung von (Hoch-)Begabung in der Schule betrachtet und erläutert werden. Dabei werden besonders die Fördermaßnahmen „Innere Differenzierung im Unterricht“, „Enrichment“, „Akzeleration“ und „spezielle Schulen und Klassen“ beleuchtet.
Daran anschließend folgt der empirische Teil der Arbeit, in dem zunächst die Forschungsfrage, die Forschungsmethode und das Forschungsdesign begründet werden. Daran anknüpfend wird auf der Grundlage der Analyse der erhobenen Datenmaterialien im siebten Kapitel die Präsentation der Ergebnisse vorgenommen. Die Auswertung dieser Ergebnisse erfolgt dabei anhand von Kategorien, die mit Blick auf die Forschungsfrage mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring entwickelt wurden. Im darauffolgenden Kapitel werden die Erkenntnisse präsentiert, die aus den Ergebnissen der Analyse gewonnen wurden, ehe eine Reflexion der Untersuchung folgt. Die Arbeit schließt mit einem abschließenden Fazit und Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Fundierung
- Begabung
- Hochbegabung
- Intelligenz
- Talent
- Hochbegabungsmodelle
- Das Drei-Ringe-Modell (Renzulli 1978)
- Das Münchner Hochbegabungsmodell (Heller et al. 1994)
- Das Integrative Begabungs- und Lernprozessmodell (Fischer 2015)
- Zusammenfassung der (Hoch-) Begabungsmodelle
- Das Erkennen einer (Hoch-)Begabung
- Intelligenztests zur (Hoch-)Begabungsdiagnostik
- Feststellung nicht-kognitiver (Hoch-)Begabungsmerkmale
- Förderung von Hochbegabung in der Schule
- Der Schulunterricht zwischen Anforderung und Herausforderung
- Basiselemente der schulischen Begabtenförderung
- Umgang mit Begabung
- Forschungsmethodologisches Vorgehen
- Die Forschungsfrage
- Die Forschungsmethode
- Durchführung
- Auswertung des Datenmaterials
- Präsentation der Ergebnisse
- Das Begriffsverständnis von Begabung
- Feststellung von Begabung
- Herausforderungen im Umgang mit Begabung
- Chancen durch den Umgang mit Begabungen
- Vorerfahrungen durch das Studium
- Erkenntnisgewinn
- Reflexion der Untersuchung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Perspektiven von Lehrkräften unterschiedlicher Schulformen auf das Thema (Hoch-)Begabung. Sie analysiert, welche Sichtweisen Lehrer*innen auf (Hoch-)Begabung haben und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus im Umgang mit (hoch-)begabten Schüler*innen in der schulischen Praxis ergeben. Die Arbeit befasst sich dabei mit verschiedenen Aspekten der Begabungsforschung und -förderung.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Begabung“ und „Hochbegabung“
- Bedeutung und Relevanz von Hochbegabungsmodellen
- Herausforderungen bei der Identifikation und Förderung von (Hoch-)Begabung in der Schule
- Erfahrungen von Lehrkräften im Umgang mit (hoch-)begabten Schüler*innen
- Chancen und Herausforderungen der Förderung von (Hoch-)Begabung in der heterogenen Schulklasse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit liefert eine Einführung in das Thema (Hoch-)Begabung und beleuchtet seine Bedeutung im Kontext von Inklusion und Heterogenität. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Begabung“ und „Hochbegabung“ definiert und von den Begriffen „Intelligenz“ und „Talent“ abgegrenzt. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Hochbegabungsmodelle, die ein mehrdimensionales Verständnis von (Hoch-)Begabung aufzeigen. Im vierten Kapitel werden Verfahren zur Feststellung einer (Hoch-)Begabung diskutiert, während im fünften Kapitel Maßnahmen zur Förderung von (Hoch-)Begabung in der Schule vorgestellt werden. Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit der Darstellung des Forschungsdesigns und der Forschungsmethode. Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit Lehrkräften präsentiert und anhand von Kategorien ausgewertet. Der letzte Teil der Arbeit bietet eine Reflexion der Untersuchung und ein abschließendes Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen (Hoch-)Begabung, Hochbegabungsmodelle, Förderung von (Hoch-)Begabung, Inklusion, Heterogenität, qualitative Interviews, Lehrerperspektiven, Chancen und Herausforderungen im Umgang mit (hoch-)begabten Schüler*innen.
- Quote paper
- N. Pulpanek (Author), 2023, Umgang mit (Hoch-)Begabung in unterschiedlichen Schulformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1496853