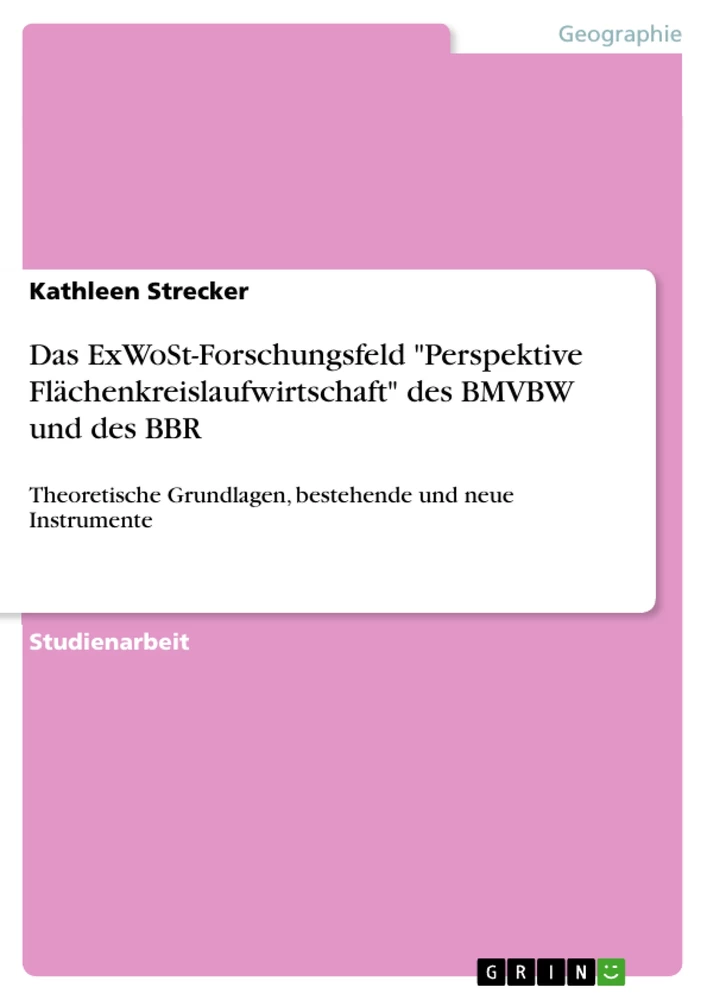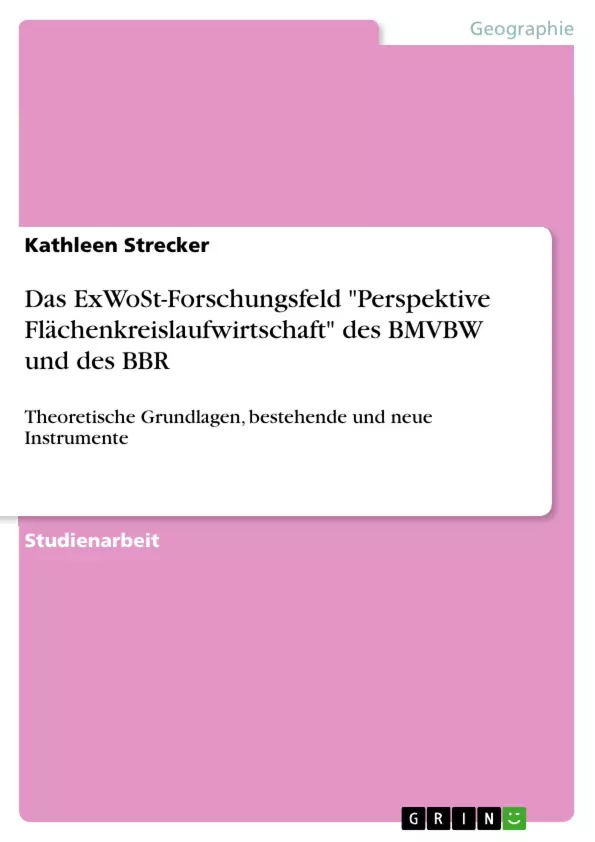Trotz stagnierender Gesamtbevölkerungszahl und einer verhaltenen Baukonjunktur ist keine Sättigung der Neuinanspruchnahme von Flächen zu erkennen.
Verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen konkurrieren um die begrenzte Ressource „Fläche“.
Der wirtschaftliche und demographische Wandel erfordert ein Umdenken „weg von der Siedlungsexpansion, hin zur Bestandserneuerung“.
Auf diesem Hintergrund entstand die Forschungsperspektive „Flächenkreislaufwirtschaft“, welche Teil des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ ist. Der Experimentelle Wohnungs- und Städtebau ist ein Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und wird vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung betreut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft – Theoretische Grundlagen
- Bestehende Instrumente der Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft
- Neue Instrumente der Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsperspektive „Flächenkreislaufwirtschaft“ zielt darauf ab, die bestehenden Flächenpotenziale in Deutschland optimal zu nutzen und die Neuinanspruchnahme von Flächen zu reduzieren. Das Programm wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung initiiert und verfolgt den Ansatz, die Wiedernutzung von Brachflächen und die Bestandsentwicklung in den Vordergrund zu stellen.
- Flächenkreislaufwirtschaft als Strategie zur nachhaltigen Flächennutzung
- Analyse bestehender und neuer Instrumente zur Umsetzung der Flächenkreislaufwirtschaft
- Bewertung der Wirksamkeit der Instrumente und Herausforderungen bei deren Anwendung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Flächenpolitik
- Bedeutung der Flächenkreislaufwirtschaft für die Stadtentwicklung und den Freiraumschutz
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt die Problematik der Flächeninanspruchnahme in Deutschland dar und erläutert die Notwendigkeit einer nachhaltigen Flächenpolitik. Sie führt die Forschungsperspektive „Flächenkreislaufwirtschaft“ als Lösungsansatz ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
-
Das Kapitel „Die Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft – Theoretische Grundlagen“ definiert den Begriff der Flächenkreislaufwirtschaft und erläutert die Ziele und Prinzipien dieser Strategie. Es beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Flächennutzung.
-
Das Kapitel „Bestehende Instrumente der Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft“ analysiert die bereits vorhandenen Instrumente zur Umsetzung der Flächenkreislaufwirtschaft. Es bewertet deren Wirksamkeit und identifiziert mögliche Schwächen und Herausforderungen.
-
Das Kapitel „Neue Instrumente der Forschungsperspektive Flächenkreislaufwirtschaft“ stellt innovative Ansätze und Instrumente vor, die zur Verbesserung der Flächenkreislaufwirtschaft beitragen können. Es diskutiert deren Potenziale und die Herausforderungen bei deren Implementierung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Flächenkreislaufwirtschaft, Flächenhaushaltspolitik, nachhaltige Flächennutzung, Brachflächen, Bestandsentwicklung, Siedlungsexpansion, Freiraumschutz, Instrumente der Flächenpolitik, Stadtentwicklung, Raumordnung, Nachhaltigkeitsstrategie, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der „Flächenkreislaufwirtschaft“?
Ziel ist es, die Neuinanspruchnahme von Flächen zu reduzieren, indem Brachflächen wiedernutzt und bestehende Siedlungsstrukturen erneuert werden, statt immer neue Flächen zu versiegeln.
Was bedeutet „Bestandserneuerung“ gegenüber „Siedlungsexpansion“?
Bestandserneuerung fokussiert auf die Aufwertung und Nutzung bereits bebauter Gebiete, während Siedlungsexpansion das Bauen „auf der grünen Wiese“ beschreibt.
Welche Rolle spielt das ExWoSt-Forschungsprogramm?
Das Programm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ testet innovative Ansätze zur Stadtentwicklung und nachhaltigen Flächennutzung in der Praxis.
Warum ist Flächenhaushaltspolitik heute so wichtig?
Trotz stagnierender Bevölkerungszahlen steigt der Flächenverbrauch weiter an, was zu ökologischen Problemen und Konkurrenz um die begrenzte Ressource Boden führt.
Welche Instrumente werden zur Flächenkreislaufwirtschaft eingesetzt?
Dazu gehören städtebauliche Verträge, Brachflächenkataster, Förderprogramme zur Innenentwicklung und planerische Vorgaben der Raumordnung.
- Arbeit zitieren
- Kathleen Strecker (Autor:in), 2009, Das ExWoSt-Forschungsfeld "Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft" des BMVBW und des BBR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149798