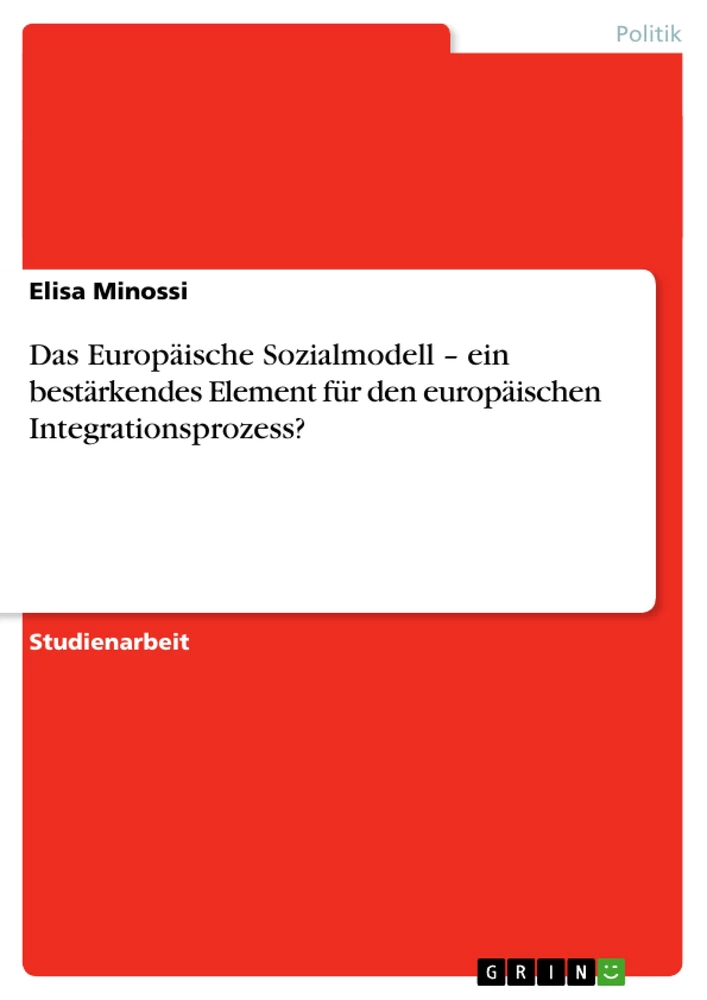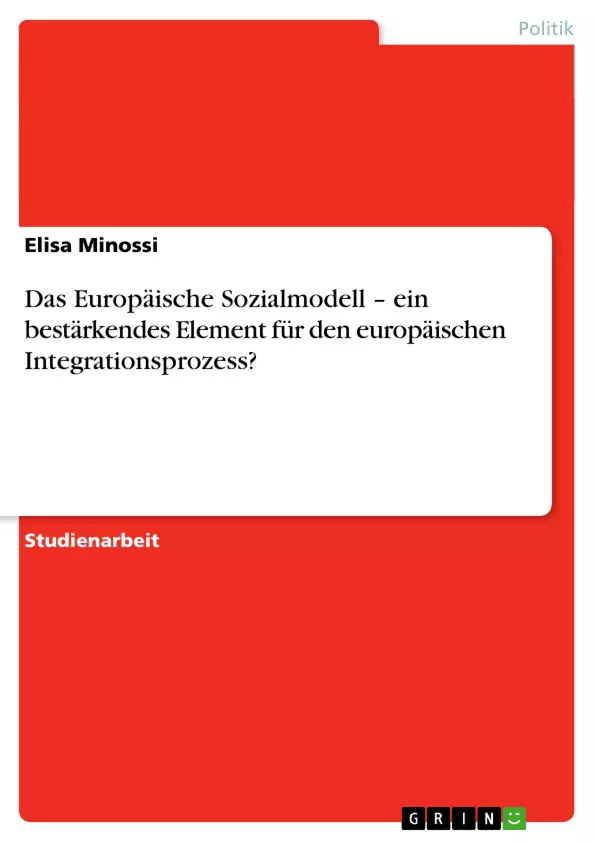Seit den Verträgen von Rom und Paris in den 1950er Jahren der Nachkriegszeit entwickelte sich vor allem eine wirtschaftliche Integration in Europa. Erst seit dem Vertrag von Maastricht 1992 wurde verstärkt auch auf eine politische Integration gesetzt. So wurde der Begriff des Europäischen Sozialmodells von Jacques Delors Mitte der 1990er Jahre geprägt. Die Vorstellung eines einheitlichen Europäischen Sozialmodells war und ist das Leitbild zu einer vertiefenden Integration innerhalb Europas.
In der folgenden Arbeit wird daher der Frage nachgegangen, ob das europäische Sozialmodell für den europäischen Integrationsprozess ein bestärkendes Element darstellt oder ob das Europäische Sozialmodell aus verschiedenen Gründen keinen relevanten Beitrag für den Integrationsprozess leisten kann. Daraus lässt sich auch die Frage ableiten, ob das Europäische Sozialmodell positiven Einfluss auf das europäische Solidaritätsgefühl ausübt. Die Arbeitshypothese zu dieser Fragestellung lautet momentan, dass das Europäische Sozialmodell kein bestärkendes Element für den europäischen Integrationsprozess darstellen kann. Wie sich in der ersten Lektüre gezeigt hat, wird die Existenz und „Leistung“ des Europäischen Sozialmodells bezweifelt und auch seine zukünftige Entwicklung ist offen.
Zunächst bietet es sich an, der Entstehung des Europäischen Sozialmodells nachzugehen. Welche historischen Voraussetzungen das Modell mit sich bringt, wird hier erörtert.
Anschließend wird der Versuch unternommen eine Definition des Europäischen Sozialmodells zu formulieren. Einige Forscher auf diesem Gebiet meinen, eine Definition wäre nicht möglich, da die Existenz eines einzigen Europäischen Sozialmodells nicht eindeutig geklärt werden könne. Andere wiederum versuchen eine Definition indem sie sich auf gemeinsame Elemente berufen.
Daran anschließend ist es sinnvoll sich mit der Entwicklung und dem aktuellen Stand der Sozialpolitik der Europäischen Union auseinanderzusetzen. Dabei werden die wichtigsten Schritte zu einer Annäherung hin zu einem Europäischen Sozialmodell dargestellt. Auch die wichtigsten Politikfelder für das Europäische Sozialmodell und die Wirkungsmöglichkeiten der EU-Politik finden in diesem Kapitel Erläuterungen. Das letzte Kapitel im Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich des Europäischen Sozialmodells mit anderen, westlich orientierten, Sozialmodellen wie denen der USA oder Japan.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Entstehung des europäischen Sozialmodells
- Definition
- Wie können die EU-Mitgliedstaaten die Ziele für die Sozialpolitik erreichen?
- Die Sozialpolitik der Europäischen Union - Entwicklung und aktueller Stand
- Das europäische Sozialmodell im Vergleich mit anderen westlich orientierten Sozialmodellen
- Das europäische Sozialmodell: realistisch oder nur normatives Leitbild?
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das Europäische Sozialmodell ein bestärkendes Element für den europäischen Integrationsprozess darstellt. Die Arbeit analysiert die Entstehung, Definition und Entwicklung des Europäischen Sozialmodells sowie dessen Vergleich mit anderen westlich orientierten Sozialmodellen. Ziel ist es, die Relevanz des Europäischen Sozialmodells für den Integrationsprozess zu beurteilen und dessen Einfluss auf das europäische Solidaritätsgefühl zu untersuchen.
- Entstehung und Entwicklung des Europäischen Sozialmodells
- Definition und Abgrenzung des Europäischen Sozialmodells
- Ziele und Strategien der EU-Sozialpolitik
- Vergleich des Europäischen Sozialmodells mit anderen westlich orientierten Sozialmodellen
- Relevanz des Europäischen Sozialmodells für den europäischen Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 beleuchtet die Entstehung des Europäischen Sozialmodells und zeigt die historischen Voraussetzungen auf. Es wird deutlich, dass eine Pfadabhängigkeit in der Entwicklung der sozialen Sicherung in Europa besteht. Kapitel 2.2 beschäftigt sich mit der Definition des Europäischen Sozialmodells und stellt die unterschiedlichen Ansätze und Interpretationen dar. Kapitel 2.3 untersucht, wie die EU-Mitgliedstaaten die Ziele der Sozialpolitik erreichen können, indem es zehn soziale Indikatoren der EU-Mitgliedstaaten vergleicht. Kapitel 2.4 analysiert die Entwicklung und den aktuellen Stand der Sozialpolitik der Europäischen Union und beleuchtet die wichtigsten Schritte zu einer Annäherung hin zu einem Europäischen Sozialmodell. Kapitel 2.5 vergleicht das Europäische Sozialmodell mit anderen westlich orientierten Sozialmodellen, wie denen der USA oder Japan. Kapitel 3 zieht aus den Erkenntnissen des Kapitels 2 ein Resümee und untersucht, ob das Europäische Sozialmodell realistisch oder eher ein normatives Leitbild ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Europäische Sozialmodell, die EU-Sozialpolitik, den europäischen Integrationsprozess, die Pfadabhängigkeit, die Definition des Europäischen Sozialmodells, die Ziele der Sozialpolitik, der Vergleich mit anderen Sozialmodellen, die Relevanz des Europäischen Sozialmodells und das europäische Solidaritätsgefühl.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Europäische Sozialmodell?
Das Europäische Sozialmodell beschreibt eine gemeinsame Vision sozialer Sicherung und Gerechtigkeit in Europa, die sich durch hohe Sozialstandards und den Schutz der Bürger auszeichnet.
Wer prägte den Begriff des Europäischen Sozialmodells?
Der Begriff wurde Mitte der 1990er Jahre maßgeblich von Jacques Delors geprägt, um ein Leitbild für die vertiefende politische Integration Europas zu schaffen.
Wie unterscheidet es sich von den Sozialmodellen der USA oder Japans?
Im Vergleich zu den USA ist das europäische Modell stärker auf staatliche Umverteilung und kollektive Absicherung ausgerichtet, während es sich von Japan durch die Art der Arbeitsmarktregulierung unterscheidet.
Fördert das Modell die europäische Integration?
Es gibt eine Debatte darüber, ob es als bestärkendes Element wirkt. Während es das Solidaritätsgefühl stärken kann, sehen Kritiker darin eher ein normatives Leitbild als eine gelebte Realität.
Was versteht man unter Pfadabhängigkeit in der Sozialpolitik?
Pfadabhängigkeit bedeutet, dass die historischen Entwicklungen und Strukturen der nationalen Sozialsysteme eine vollständige Vereinheitlichung auf europäischer Ebene erschweren.
- Quote paper
- Elisa Minossi (Author), 2010, Das Europäische Sozialmodell – ein bestärkendes Element für den europäischen Integrationsprozess?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149893