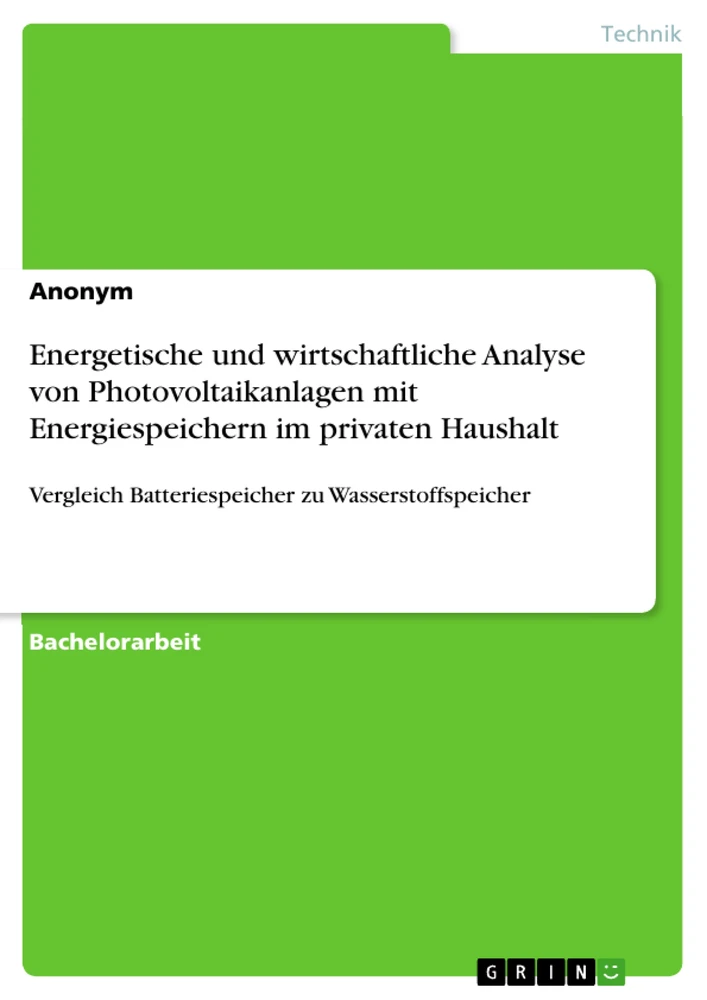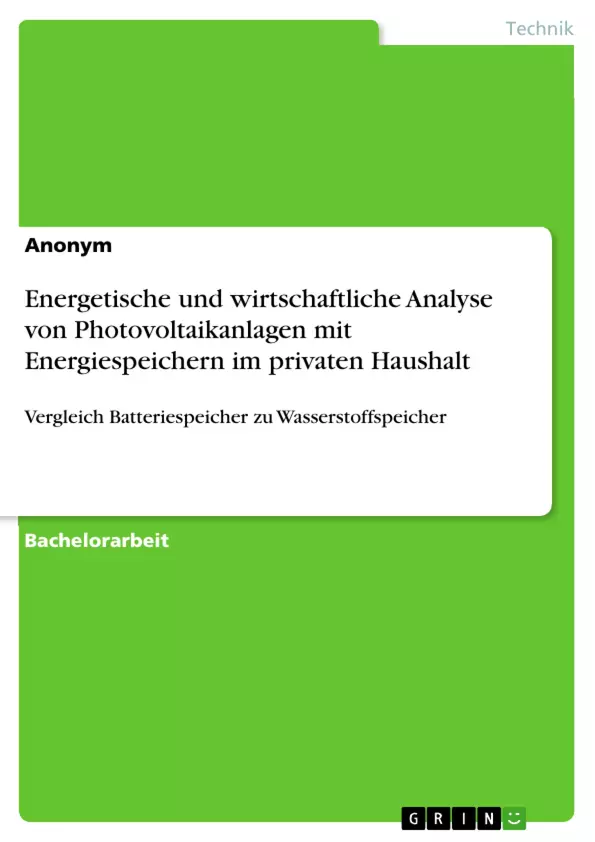Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Möglichkeiten der Energiespeicherung für Privathaushalte untersucht. Zum einen der einfache Batteriespeicher und zum anderen der gekoppelte Batterie- und Wasserstoffspeicher. Im Folgenden werden die Daten und Grundlagen für die energetische und wirtschaftliche Berechnung erläutert. Anschließend wird die notwendige Dimensionierung der unterschiedlichen Speicher für verschiedene Autarkiegrade, bis hin zu 100%, berechnet. In Kapitel 4 wird die Wirtschaftlichkeit dieser beiden Speichersysteme analysiert. Dabei werden die Kosten und Einsparmöglichkeiten der beiden Speichervarianten untersucht und zu den jeweiligen Autarkiegraden die vorteilhafte Speichermethode ermittelt. Anschließend wird der aktuelle Markt untersucht, die in der Praxis bereits vorhandenen Energiespeicher von unterschiedlichen Herstellern betrachtet und einige Besonderheiten der Markführer analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Zielsetzung
- 2 Daten und Grundlagen für die Berechnungen
- 2.1 PV-Anlage
- 2.2 Ertragskurve
- 2.3 Standardlastprofil
- 3 Energetische Betrachtung
- 3.1 PV-Anlage ohne Speicher
- 3.2 PV-Anlage mit Batteriespeicher
- 3.3 PV-Anlage mit gekoppeltem Batterie- und Wasserstoffspeicher
- 4 Wirtschaftliche Berechnung
- 4.1 Stromkosten
- 4.2 Einspeisevergütung
- 4.3 Grundkosten
- 4.4 Kosten PV-Anlage
- 4.5 Kosten Batteriespeicher
- 4.6 Kosten gekoppelter Batterie- und Wasserstoffspeicher
- 4.7 Wirtschaftlichkeitsanalyse
- 5 Energiespeicher in der Praxis
- 5.1 Batteriespeicher
- 5.1.1 Europäischer Markt
- 5.1.2 Marktführer
- 5.2 Wasserstoffspeicher
- 5.2.1 HPS Home Power Solutions
- 5.2.2 LAVO Hydrogen Storage Technology
- 5.1 Batteriespeicher
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirtschaftlichkeit und energetische Effizienz verschiedener Energiespeicherlösungen für private Photovoltaikanlagen in Deutschland. Es werden die steigenden Stromkosten und sinkende Einspeisevergütungen als Motivation für eine höhere Eigenverbrauchsquote betrachtet.
- Energetische Bewertung von PV-Anlagen mit und ohne verschiedenen Speicherlösungen
- Wirtschaftlichkeitsanalyse verschiedener Speichertechnologien (Batterie und kombiniert Batterie-Wasserstoff)
- Untersuchung des Einflusses von Speicherkapazität auf den Eigenverbrauchsanteil
- Analyse des europäischen Marktes für Batteriespeicher
- Vorstellung von Beispielen für Wasserstoff-Speichertechnologien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt die steigende Attraktivität von PV-Anlagen aufgrund sinkender Kosten und steigender Strompreise. Kapitel 2 legt die Datenbasis für die folgenden Berechnungen dar, inklusive PV-Anlagen-Daten, Ertragskurven und Standardlastprofile. Kapitel 3 analysiert die energetische Betrachtung von PV-Anlagen mit und ohne verschiedenen Speicherarten (Batterie und kombiniert Batterie-Wasserstoff). Kapitel 4 befasst sich mit der wirtschaftlichen Bewertung der verschiedenen Systeme, unter Berücksichtigung von Stromkosten, Einspeisevergütung und Anschaffungskosten der Speicher.
Schlüsselwörter
Photovoltaik, Energiespeicher, Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher, Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, Stromkosten, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Autarkiegrad, Rentabilität.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Energetische und wirtschaftliche Analyse von Photovoltaikanlagen mit Energiespeichern im privaten Haushalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1499569