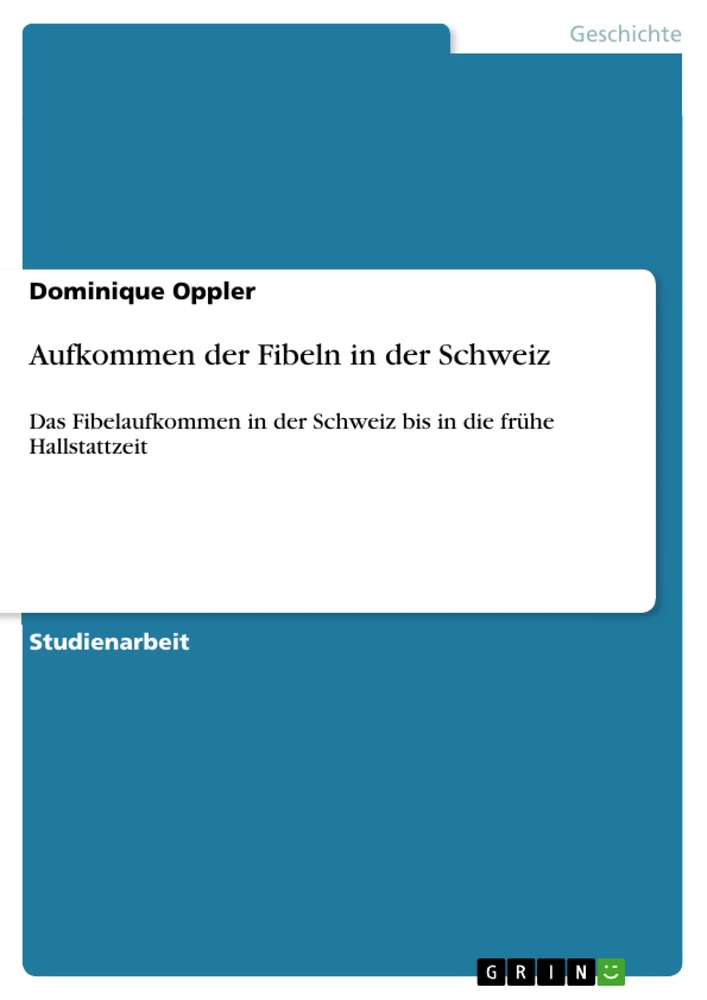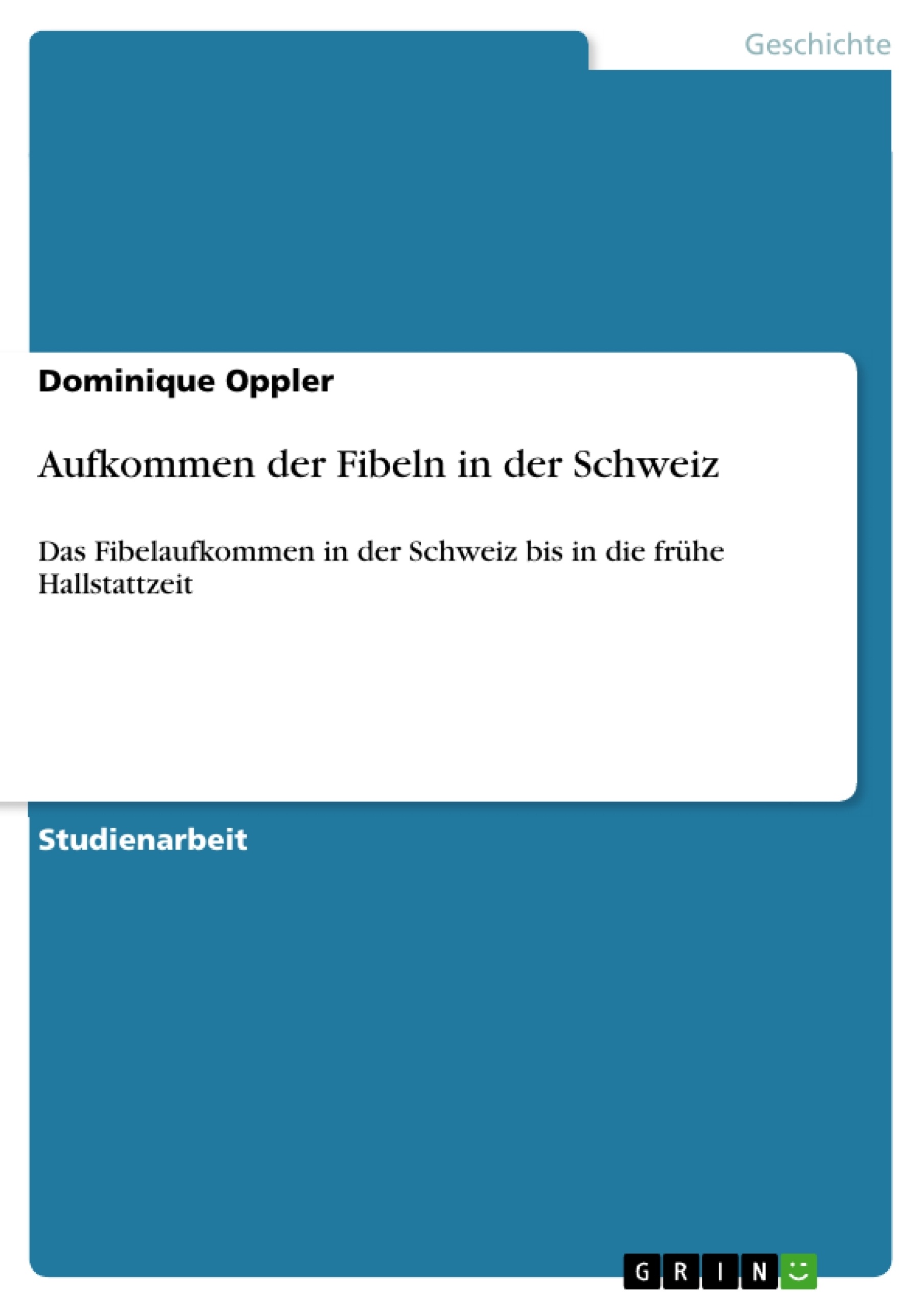Die Schweiz stand im Zeitpunkt des Aufkommens der Fibeln in einem geografisch und kulturell vielgestaltigen Raum, der bereits in vorgeschichtlicher Zeit verschiedenen Kulturprägungen und
–einflüssen ausgesetzt war.
Die damaligen Gebiete der Schweiz standen mit den angrenzenden Regionen, Süddeutschland, Tirol, Nord-Italien und Franche-Comté/Savoye in engem Kontakt und Wechselbeziehungen.
Die Entwicklung der Fibel, und wie sie den Weg in die Schweiz gefunden hat, soll in einem erweiterten Kontext untersucht werden, wodurch die Entwicklung der Fibeln in Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn, Tschechien, etc. mit berücksichtigt wurden.
Der Zeitrahmen der Untersuchung umfasst die späte Bronzezeit ab BzD1 und reicht bis in die frühe Hallstattzeit HaC – nach absoluter Datierung vom 13. bis ins 8. Jh. v. Chr..
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturelle Veränderungen
- Typologisierung, Verbreitung und Datierung
- Fibeltypen
- Fibelfunde aus heutigen Gebieten der Schweiz mit Hinweis auf andere Fundorte
- Versuch einer Chronologie für die heutigen Gebiete der Schweiz
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Fibel in der Schweiz, wobei sie auch die kulturellen Veränderungen und Einflüsse aus der späten Bronze- bis in die frühe Hallstattzeit beleuchtet.
- Die Bedeutung der Fibel als kulturelles Artefakt und ihr Wandel von einem praktischen Werkzeug zu einem modischen Accessoire und Statussymbol
- Die Typologisierung von Fibeln und ihre Verbreitung in der Schweiz und angrenzenden Regionen
- Die Datierung von Fibeln und die Herausforderungen, die mit verschiedenen Methoden und der Interpretation von Fundkomplexen verbunden sind
- Die Rolle der Fibel im Kontext kultureller und sozialer Veränderungen in der späten Bronze- und frühen Hallstattzeit
- Die Beziehungen zwischen der Fibel und der Entwicklung der Tracht und Mode in der Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen und kulturellen Kontext des Aufkommens der Fibel in der Schweiz dar. Sie betont die geografische Lage der Schweiz und die vielfältigen kulturellen Einflüsse, denen die Region ausgesetzt war.
Kapitel II beleuchtet die kulturellen Veränderungen, die mit dem Erscheinen der Fibel einhergingen. Es wird diskutiert, wie die Fibel die Nadel der Bronzezeit ablöste und möglicherweise mit Veränderungen in der Tracht und Mode zusammenhing. Die Bedeutung der mykenischen Kultur als möglicher Ursprung der Fibel wird hervorgehoben.
Kapitel III behandelt die Typologisierung, Verbreitung und Datierung von Fibeln. Es wird die Bedeutung der Fundorte für die Benennung von Fibeltypen und die Schwierigkeiten bei der Interpretation der Verbreitung und Datierung von Funden dargelegt.
Kapitel IV analysiert die verschiedenen Fibeltypen, die in der Schweiz gefunden wurden, unterteilt in einteilige und zweiteilige Formen. Die verschiedenen Gestaltungsmerkmale und die Entwicklung der Fibel als Schmuck und Statussymbol werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Fibeln, Schweiz, Bronzezeit, Hallstattzeit, Typologisierung, Verbreitung, Datierung, Kulturelle Veränderungen, Tracht, Mode, Statussymbol, Fundorte, Handel, Kulturkontakte, Mykenische Kultur
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Fibel im archäologischen Kontext?
Eine Fibel ist eine Gewandnadel, die in der Bronze- und Hallstattzeit sowohl als praktisches Verschlussmittel für Kleidung als auch als Schmuckstück und Statussymbol diente.
Welcher Zeitraum wird in der Untersuchung abgedeckt?
Die Arbeit umfasst die späte Bronzezeit bis zur frühen Hallstattzeit, absolut datiert etwa vom 13. bis ins 8. Jahrhundert v. Chr.
Welche kulturellen Einflüsse prägten das Aufkommen der Fibeln in der Schweiz?
Die Schweiz stand in engem Kontakt mit Süddeutschland, Norditalien und der mykenischen Kultur, die als möglicher Ursprung der Fibel gilt.
Wie werden Fibeln typologisiert?
Fibeln werden nach ihrer Form (einteilig oder zweiteilig) sowie nach spezifischen Gestaltungsmerkmalen und Fundorten klassifiziert.
Welche Bedeutung hatte die Fibel für die damalige Mode?
Das Erscheinen der Fibel markiert einen Wandel in der Tracht, da sie die einfache Nadel der Bronzezeit ablöste und komplexere Kleidungsformen ermöglichte.
- Citation du texte
- Dominique Oppler (Auteur), 2010, Aufkommen der Fibeln in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150007