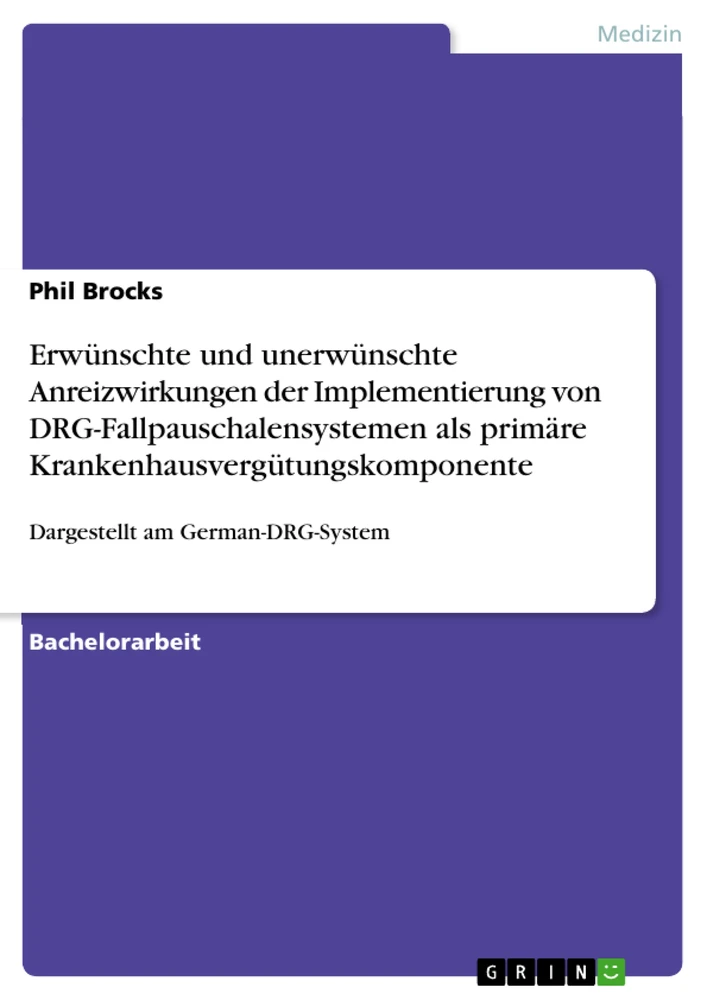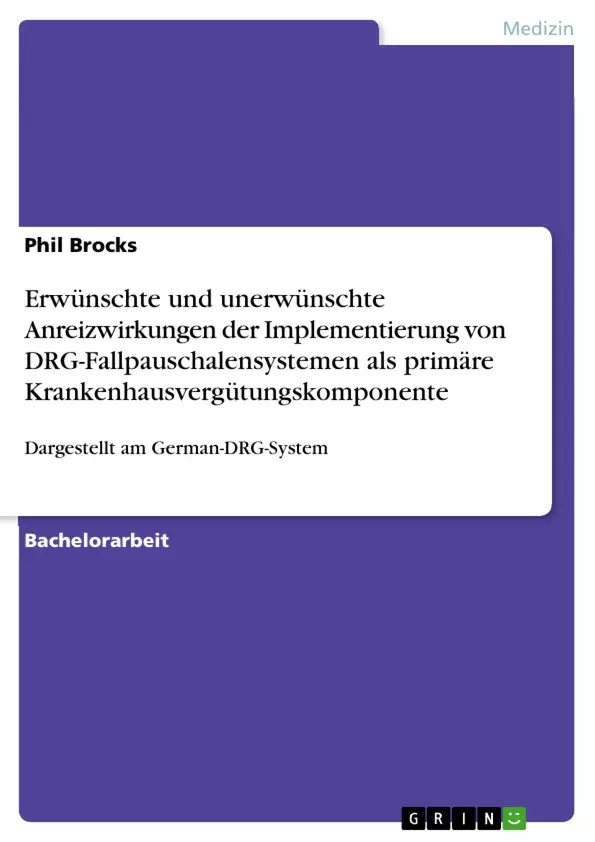Die DRG-Vergütung und ihre Auswirkungen spalten die Meinungen in Wissenschaft, Gesellschaft sowie Gesundheitspolitik. Darüber hinaus führt der erhöhte Komplexitätsgrad dazu bei, dass dieses für nicht sachkundige Personen schwierig zu begreifen ist. Dies erschwert eine sachliche Auseinandersetzung mit diesem Thema. Hierzu soll die Bachelorthesis einen nutzbringenden Beitrag leisten.
Das Krankenhauswesen ist in Deutschland sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich von hoher Relevanz. Mit rund 6 Millionen Arbeitnehmer*innen in Deutschland ist es mit circa 88,11 Milliarden € Gesamtausgaben für Krankenhausbehandlungen Gesundheitsausgabenträger Nr.1 der Gesetzlichen Krankenversicherungen.
Eine adäquat ausgestaltete und funktionale Krankenhausfinanzierung beziehungsweise Krankenhausvergütung mit überwiegend positiven Auswirkungen ist im Interesse zahlreicher Stakeholder:innen der Gesellschaft als Zielgruppe. So ist sie im Interesse der Gesundheitspolitik, welche zukünftig versuchen wird, die Krankenhausvergütung im Rahmen der noch nicht finalisierten Krankenhausreform zu optimieren. Ebenso ist es ein Anliegen der Krankenhäuser, ihre medizinischen
Dienstleistungen angemessen vergütet zu bekommen. Darüber hinaus ist sie besonders für Patienten und Patientinnen von Interesse. Denn die Art und Weise, wie eine Krankenhausvergütung ausgestaltet und organisiert wird, hat große Auswirkungen auf die medizinische Versorgungsqualität, die für sie geleistet wird.
Aufgrund schwerwiegender Probleme, wie beispielsweise, dass im Jahr 2022 rund 51% der deutschen Kliniken ein defizitäres Jahresergebnis aufwiesen, fordern viele Personengruppen eine Abänderung dieser primären Krankenhausvergütungskomponente. Auch ist ein weiterer Kritikpunkt am deutschen DRG-System, dass es ökonomisch motivierte Mengenausweitungen in Form von unsachgemäßen Fallzahlenerhöhungen oder „Höherkodierungen“ fördern würde.
Doch die Ansichten zum DRG-System sind keinesfalls ausschließlich von negativer Kritik geprägt. Zumeist argumentieren die Befürworter:innen des Systems damit, dass die angestrebten Zielsetzungen erreicht worden seien. Problematische Fehlentwicklungen seien entweder gar nicht vom Fallpauschalensystem kausal verursacht oder Nebenwirkungen, die man mit Systemmodifizierungen beherrschen und beseitigen könne.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel, inhaltliche Struktur und Abgrenzung zu anderen wissenschaftlichen Arbeiten
- 1.2 Forschungsfragen
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Krankenhausvergütungsmodelle – allgemeine Funktionen und Ziele
- 2.2 Fallpauschalenvergütung und Diagnosis Related Groups
- 2.3 Übersicht der Anreizwirkungen
- 2.4 Die deutsche Krankenhausfinanzierung
- 2.4.1 Die Investitionskostenfinanzierung
- 2.4.2 Die Betriebskostenfinanzierung
- 2.4.3 Das deutsche Fallpauschalensystem
- 2.4.3.1 Rechnungsbetragsbildung bei den G-DRGs
- 2.4.3.2 Zielsetzungen des G-DRG-Systems
- 3 Methodik
- 3.1 Suchstrategie
- 3.2 Ein- und Ausschlusskriterien
- 3.3 Literaturauswahl und -synthese: PRISMA-ScR
- 3.4 Qualität der eingeschlossenen Studien
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Potenziell unerwünschte Anreizwirkungen
- 4.1.1 Leistungsmengenausweitung
- 4.1.2 Steigende GKV-Krankenhausausgaben und Gefährdung der Beitragssatzstabilität
- 4.2 Erwünschte Anreizwirkungen
- 4.2.1 Verweildauerverkürzung
- 4.2.2 Erhöhte Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser
- 4.2.3 Reduktion der Zahl der Krankenhäuser und Betten
- 4.2.4 Gesteigerter Wettbewerb
- 4.2.5 Leistungsgerechtigkeit
- 4.2.6 Transparenz
- 4.2.7 Erhalt der Versorgungsqualität
- 4.3 Sonstige Auswirkungen
- 4.3.1 Personalreallokation
- 4.3.1.1 Pflegebereich
- 4.3.1.2 Ärztlicher Dienst
- 4.3.2 Wertewandel und Arbeitsempfinden
- 5 Diskussion
- 5.1 Unerwünschte Anreizwirkungen
- 5.2 Erwünschte und sonstige Anreizwirkungen
- 5.2.1 Verweildauerreduktion
- 5.2.2 Wirtschaftlichkeitsgewinn, Qualitätserhalt und Wertewandel
- 5.2.3 Reduktion von Krankenhausstrukturen und Wettbewerb
- 5.2.4 Leistungsgerechtigkeit und Transparenz
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorthesis analysiert die Auswirkungen des deutschen Fallpauschalensystems (G-DRG-System) auf das Krankenhauswesen. Ziel ist es, die diskutierten Anreizwirkungen des Systems aus einer objektiven Perspektive zu betrachten und zu bewerten, ob die beabsichtigten positiven Auswirkungen tatsächlich eintreten konnten oder ob negative Effekte überwiegen.
- Die Untersuchung der Funktionsweise des G-DRG-Systems und seiner Einordnung in die deutsche Krankenhausfinanzierung
- Die Analyse der erwünschten und unerwünschten Anreizwirkungen, die mit der Implementierung des G-DRG-Systems verbunden sind
- Die Evaluation der Ergebnisse des G-DRG-Systems in Bezug auf seine beabsichtigten Zielsetzungen, wie Beitragssatzstabilität, Verweildauerverkürzung, Wirtschaftlichkeit und Leistungsgerechtigkeit
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des G-DRG-Systems auf die Versorgungsqualität, den Wettbewerb zwischen Krankenhäusern und die Arbeitsbedingungen des Krankenhauspersonals
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Relevanz des Krankenhauswesens in Deutschland, die Herausforderungen der Krankenhausfinanzierung und die Einführung des G-DRG-Systems als primäre Vergütungskomponente. Die Forschungsfrage der Thesis wird erläutert: Welche Auswirkungen hat das G-DRG-System auf das Krankenhauswesen?
Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Krankenhausfinanzierung, indem es verschiedene Vergütungsmodelle und ihre Anreizwirkungen vorstellt, die deutsche Krankenhausfinanzierungssystematik erläutert und das G-DRG-System im Detail betrachtet. Die Zielsetzungen der DRG-Einführung in Deutschland werden dargelegt.
Das dritte Kapitel beschreibt die Methodik des Scoping Reviews, welcher zur Analyse der wissenschaftlichen Literatur über die Auswirkungen des G-DRG-Systems verwendet wurde. Die Suchstrategie, die Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Qualität der Studien werden diskutiert.
Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse des Scoping Reviews präsentiert, indem die potenziell unerwünschten Anreizwirkungen des G-DRG-Systems auf die Leistungsmengenausweitung, die GKV-Krankenhausausgaben und die Beitragssatzstabilität analysiert werden. Des Weiteren werden die erwünschten Anreizwirkungen des G-DRG-Systems in Bezug auf Verweildauerverkürzung, Wirtschaftlichkeit, Reduktion von Krankenhausstrukturen und Betten, gesteigerten Wettbewerb, Leistungsgerechtigkeit und Transparenz beleuchtet. Schließlich werden die Auswirkungen des G-DRG-Systems auf die Personalreallokation und die Arbeitsempfindungen des Krankenhauspersonals untersucht.
Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse des Scoping Reviews und geht auf die Limitationen der Forschungsmethodik ein. Die Ergebnisse werden im Kontext der multifaktoriellen Einflüsse auf das Krankenhauswesen analysiert.
Das sechste Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Thesis zusammen und zieht ein Fazit zu den Auswirkungen des G-DRG-Systems auf das deutsche Krankenhauswesen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Anreizwirkungen der Implementierung von DRG-Fallpauschalensystemen, insbesondere des German-DRG-Systems, als primäre Krankenhausvergütungskomponente. Im Fokus stehen die Auswirkungen des Systems auf die Leistungsmengenentwicklung, die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung, die Verweildauer, die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser, die Leistungsgerechtigkeit, die Transparenz und die Versorgungsqualität. Weitere wichtige Themen sind der Wettbewerb zwischen Krankenhäusern, die Personalreallokation und der Wertewandel im Krankenhauswesen.
- Citar trabajo
- Phil Brocks (Autor), 2024, Erwünschte und unerwünschte Anreizwirkungen der Implementierung von DRG-Fallpauschalensystemen als primäre Krankenhausvergütungskomponente, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1500700