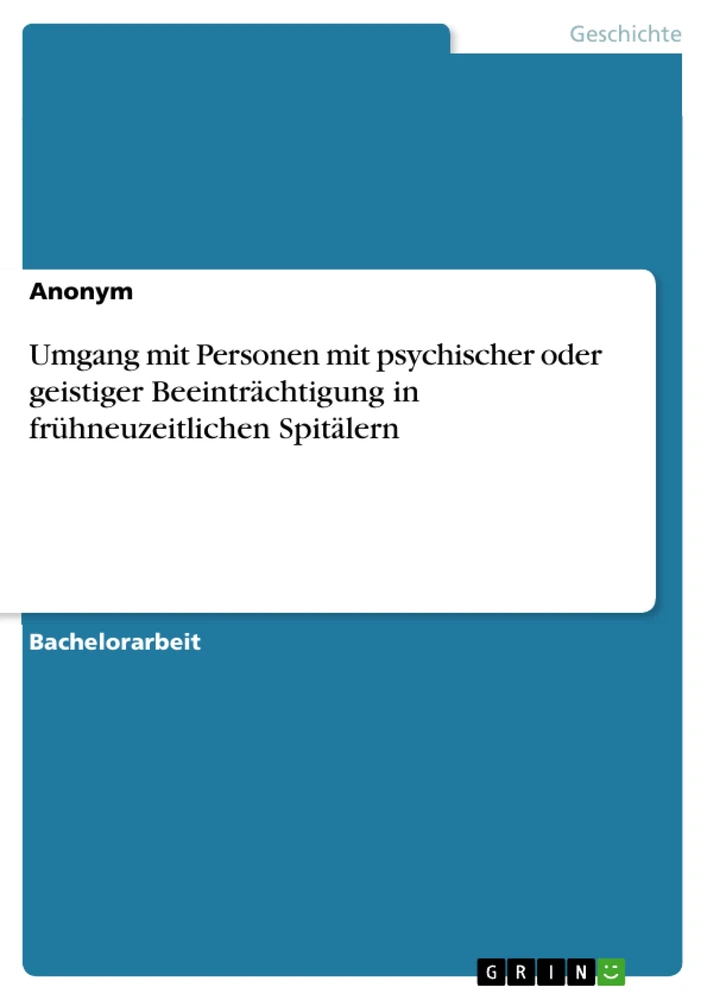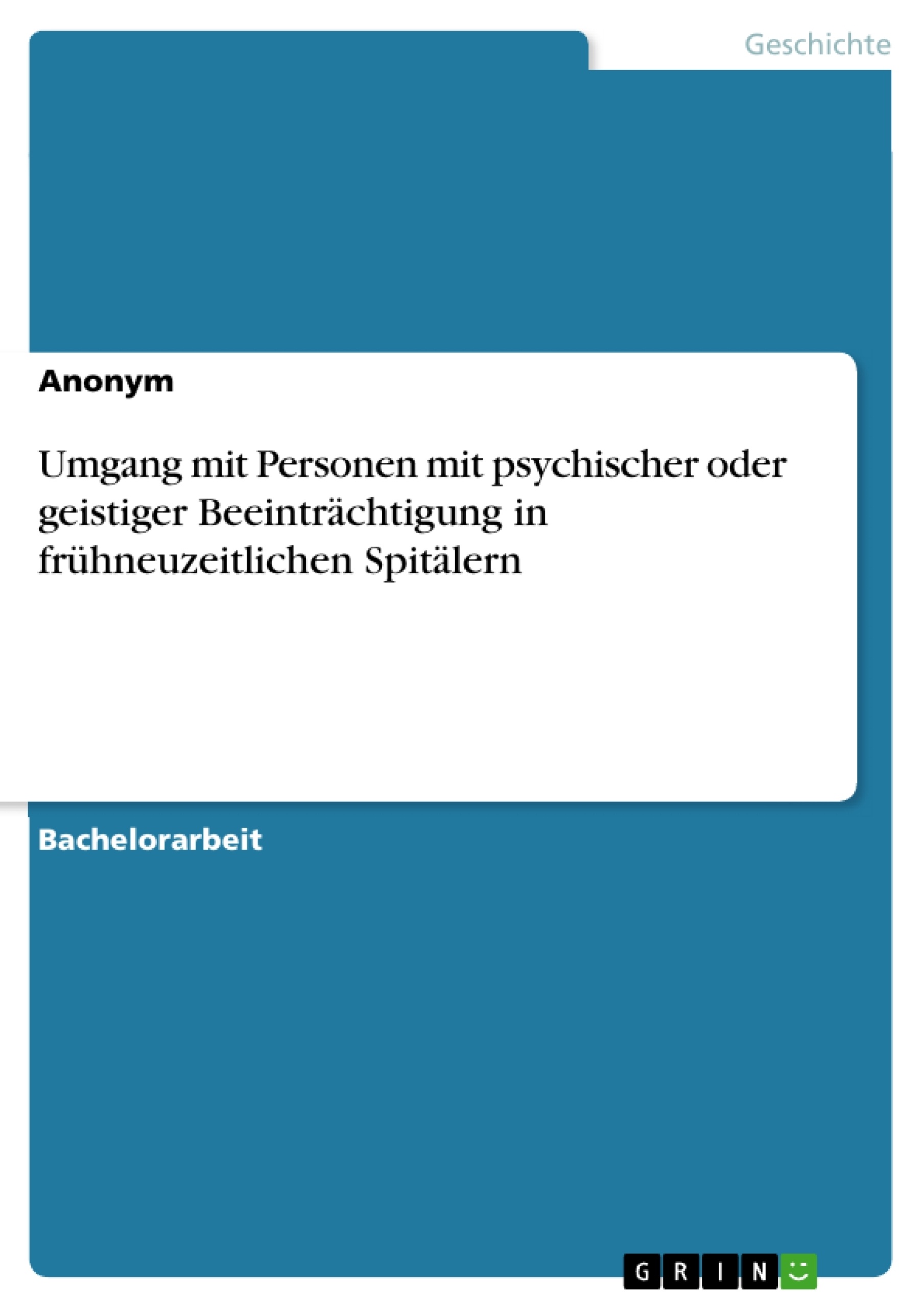Die Situation von Menschen im Mittelalter mit geistiger Behinderung und der dazugehörige Hintergrund soll im ersten Teil der Arbeit genauer ausgeführt werden, sodass ein Vergleich vor der verstärkten Etablierung von Hospitälern ermöglicht wird. Nach einem Überblick über den Forschungsstand, der auch einen Einblick in die Thesen der „Disability Studies“ beinhaltet, sollen wichtige Schlüsselbegriffe, deren Definition die Grundlage der nachfolgenden Untersuchung bilden, erklärt werden. Daraus sollte u.a. ersichtlich werden, dass, auch wenn der Fokus der Arbeit darauf ausgelegt ist, den Wandel im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen zu erörtern, dieser kaum unabhängig von der Lebensrealität von Menschen mit anderen Leiden zu trennen ist. Ebenso soll das Konzept der „totalen Institution“ nach Goffman erläutert werden, um der Analyse der Struktur des Spitals einen Rahmen zu geben.
Anschließend soll die zwiespältige Rolle der Betroffenen im Mittelalter genauer dargestellt werden, unter Berücksichtigung einiger Fallbeispiele. Das folgende Kapitel soll, durch zwei Unterkapitel unterteilt, einen Einblick in zwei mittelalterliche Erklärungskonzepte von (geistigen) Krankheiten bieten, dazu gehört der humoralpathologische Ansatz sowie theologische Begründungszusammenhänge. Existierten diese Ansichten unabhängig voneinander und inwiefern beeinflussten sie die Behandlung der Kranken? Aufschluss über die Antwort lässt auch das letzte Kapitel des ersten Teiles „Verstecken oder behandeln? – Orte des Ausschlusses und Hospitalbildung“ zu, welches sich insbesondere mit dem Umgang von als störend wahrgenommenen Personen beschäftigt. Zudem thematisiert das Kapitel die Anfänge der Hospitalbildung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand und Methodik
- Schlüsselbegriffe und ihre Definition
- Die ambivalente Rolle psychisch kranker Menschen im Mittelalter
- Erklärungskonzepte der (Geistes-/Krankheit)
- Humoralpathologischer Ansatz
- Religiöse Vorstellungen
- Verstecken oder behandeln? - Orte des Ausschlusses und Hospitalbildung
- Orte des Ausschlusses
- Hospitalbildung
- Konzept und Intention hinter der Gründung des hohen Hospitals Haina
- Alltagsleben der Insassen und Organisation im Hospital Haina
- Das Aufnahmeverfahren und die Hospitaliten
- Formen der Unterbringung: Disziplinierend oder bedürfnisgerecht?
- Alltag und Konflikte
- Das Krankheitsverständnis und die daraus resultierende Behandlung
- Anwendung von Arzneien, Diätetik und Chirurgie
- Seelsorge
- Haina im 21. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Umgang mit Menschen mit psychischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen in frühneuzeitlichen Spitälern anhand ausgewählter Quellen. Insbesondere soll der Fokus auf dem hessischen Hospital Haina liegen, um den Wandel des gesellschaftlichen Umgangs mit diesen Personen aufzuzeigen. Die Arbeit zeichnet ein Bild von der komplexen Geschichte der psychiatrischen Versorgung und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Integration und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen verbunden waren.
- Die ambivalente Rolle psychisch kranker Menschen im Mittelalter
- Erklärungskonzepte von Geistes- und körperlichen Krankheiten im Mittelalter
- Die Entwicklung der Hospitalbildung als Ort der Versorgung und des Ausschlusses
- Die Organisation und das Alltagsleben in frühneuzeitlichen Spitälern, insbesondere im Hospital Haina
- Das Krankheitsverständnis und die Behandlungspraktiken in der frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und präsentiert die Relevanz der Forschung zu diesem Thema. Sie beleuchtet die Dynamik und Ambivalenz in der Geschichte des Umgangs mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Kapitel 2 beschreibt den Forschungsstand und die Methodik der Arbeit. Es werden wichtige Schlüsselbegriffe definiert und die Bedeutung der Disability Studies im Kontext der Untersuchung erläutert. Kapitel 3 beleuchtet die ambivalente Rolle psychisch kranker Menschen im Mittelalter, wobei Fallbeispiele und das Konzept der "totalen Institution" nach Goffman einbezogen werden. In Kapitel 4 werden mittelalterliche Erklärungskonzepte von Geistes- und körperlichen Krankheiten behandelt, wie den humoralpathologischen Ansatz und theologische Begründungszusammenhänge. Kapitel 5 widmet sich der Frage "Verstecken oder behandeln?". Es untersucht Orte des Ausschlusses und die Entstehung der Hospitalbildung.
Schlüsselwörter
Psychische und/oder geistige Beeinträchtigung, frühneuzeitliche Spitäler, Hospital Haina, Disability Studies, Inklusion, Integration, mittelalterliche Erklärungskonzepte, Humoralpathologie, Orte des Ausschlusses, Hospitalbildung, Alltagsleben, Krankheitsverständnis, Behandlung, Seelsorge, "totale Institution", Goffman.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Umgang mit Personen mit psychischer oder geistiger Beeinträchtigung in frühneuzeitlichen Spitälern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1501743