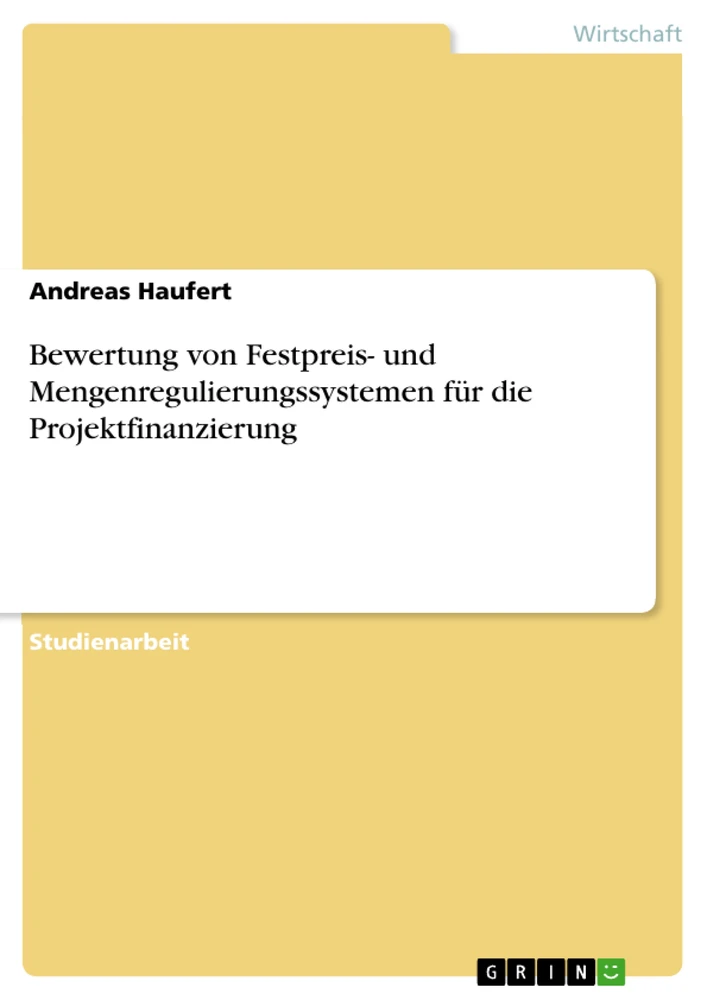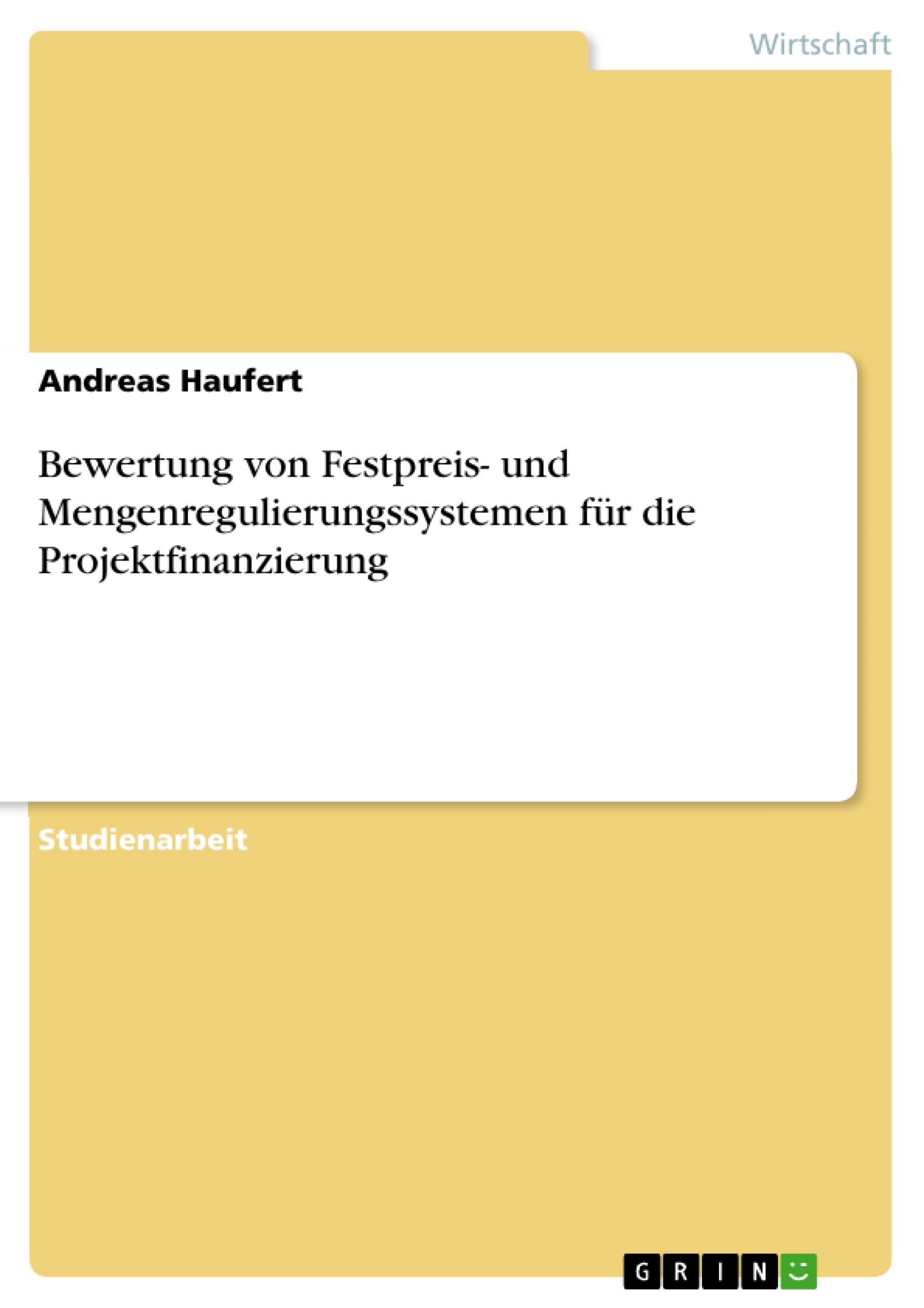Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls im Jahre 1997 haben sich die teilnehmenden Staaten völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen gesetzt, welche die Hauptursache der globalen Erwärmung sind.
Die EU geht mit der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aus dem Jahre 2001 sowie den Beschlüssen des europäischen
Rats vom Frühjahr 2007 und der Verabschiedung der Ende Juni 2009 in Kraft getretenen EU Richtlinie 2009/28/EG für erneuerbare Energien gegen den Klimawandel vor. Bis 2020 sollen 20% des gesamten Endenergieverbrauchs der EU mit erneuerbaren
Energien gedeckt werden. Für Deutschland ist ein Ziel von 18% verbindlich. Die Mitgliedsstaaten haben freie Wahl auf welche Weise und mit welchen Instrumenten sie diese Ziele erreichen wollen. Es wird hierbei zwischen preisbasierten und mengenbasierten Förderinstrumenten unterschieden, also Instrumente die entweder den Preis oder die Menge als instrumentelle Steuergröße verwenden
und damit die Produzentenseite beeinflussen wollen. Bei preisbasierten Instrumenten
steht der Fokus auf der Einspeisevergütung, bei den mengenbasierten Instrumenten auf der Quotenregelung.
Die Charakteristika von Investitionsprojekten erneuerbarer Energie, wie langfristig stabile Stromerträge, lange Laufzeiten, hohe Anfangsinvestitionen sowie später geringe Betriebskosten eignen sich gut für eine Finanzierung durch die Projektfinanzierung.
Diese Finanzierungsform zeichnet sich unter anderem dadurch aus,
dass sie sich durch die zukünftigen projektspezifischen Cashflows refinanziert. Diese Cashflows müssen neben den jährlich anfallenden Betriebskosten auch den kompletten zukünftigen Schuldendienst decken.
Mit dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien für eine Projektfinanzierung geeignet sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Förderinstrumente
- Preisbasierte Förderinstrumente
- Einspeisevergütungssysteme
- Finanzierungshilfen / Subvention / Förderprogramme
- Grüner Strom / Green Pricing
- Ökologische / CO2 Steuer
- Mengenbasierte Förderinstrumente
- Quotenregelung
- Ausschreibungsmodelle
- Preisbasierte Förderinstrumente
- Vor- und Nachteile der Förderinstrumente
- Bedeutung des Förderinstruments für die Projektfinanzierung
- Beispielrechnung an einem Windparkprojekt
- Zusatzaspekt – Welche Anforderungen sollte ein Regulierungsumfeld erfüllen, damit es für CSP-Projektfinanzierungen in Afrika geeignet ist?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien für eine Projektfinanzierung geeignet sind. Sie untersucht insbesondere die beiden Haupttypen von Förderinstrumenten, preisbasierte und mengenbasierte Instrumente, und analysiert ihre Vor- und Nachteile im Kontext der Projektfinanzierung.
- Analyse von Preis- und Mengen-regulierungssystemen für die Förderung erneuerbarer Energien
- Bewertung der Eignung dieser Förderinstrumente für Projektfinanzierungen
- Untersuchung der Auswirkungen von Förderinstrumenten auf die Cashflows von Projekten
- Analyse der Anforderungen an ein Regulierungsumfeld für CSP-Projektfinanzierungen in Afrika
- Zusammenhang zwischen Förderinstrumenten und der Finanzierung von erneuerbaren Energieprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Kapitel stellt den Hintergrund und die Relevanz des Themas dar und beleuchtet die Ziele und Herausforderungen der Förderung erneuerbarer Energien im Kontext des Klimaschutzes.
- Förderinstrumente: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Förderinstrumente für erneuerbare Energien vorgestellt, unterteilt in preisbasierte und mengenbasierte Instrumente.
- Vor- und Nachteile der Förderinstrumente: Hier werden die Vor- und Nachteile der Hauptförderinstrumente im Detail untersucht.
- Bedeutung des Förderinstruments für die Projektfinanzierung: Dieses Kapitel analysiert die Eignung der verschiedenen Förderinstrumente für die Projektfinanzierung und untersucht ihre Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit von Projekten.
- Beispielrechnung an einem Windparkprojekt: Dieses Kapitel veranschaulicht die Bedeutung von Förderinstrumenten für die Projektfinanzierung anhand eines konkreten Beispiels.
- Zusatzaspekt – Welche Anforderungen sollte ein Regulierungsumfeld erfüllen, damit es für CSP-Projektfinanzierungen in Afrika geeignet ist?: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen an ein Regulierungsumfeld für CSP-Projektfinanzierungen in Afrika.
Schlüsselwörter
Projektfinanzierung, erneuerbare Energien, Förderinstrumente, Einspeisevergütung, Quotenregelung, CSP, Afrika, Finanzierbarkeit, Cashflows, Regulierungsumfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Preis- und Mengenregulierung?
Preisbasierte Instrumente fokussieren auf Einspeisevergütungen, während mengenbasierte auf Quotenregelungen setzen.
Warum ist die Projektfinanzierung für erneuerbare Energien geeignet?
Wegen der langfristig stabilen Stromerträge, hohen Anfangsinvestitionen und geringen Betriebskosten, die sich durch Cashflows refinanzieren.
Welche Anforderungen stellt CSP-Projektfinanzierung in Afrika?
Es bedarf eines stabilen Regulierungsumfelds, das die hohen Risiken und spezifischen klimatischen Bedingungen vor Ort berücksichtigt.
Was regelt das Kyoto-Protokoll?
Es setzt völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung.
Was sind „Grüner Strom“ und „Green Pricing“?
Es sind preisbasierte Förderinstrumente, bei denen Konsumenten freiwillig höhere Preise für Energie aus regenerativen Quellen zahlen.
- Quote paper
- Andreas Haufert (Author), 2009, Bewertung von Festpreis- und Mengenregulierungssystemen für die Projektfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150241