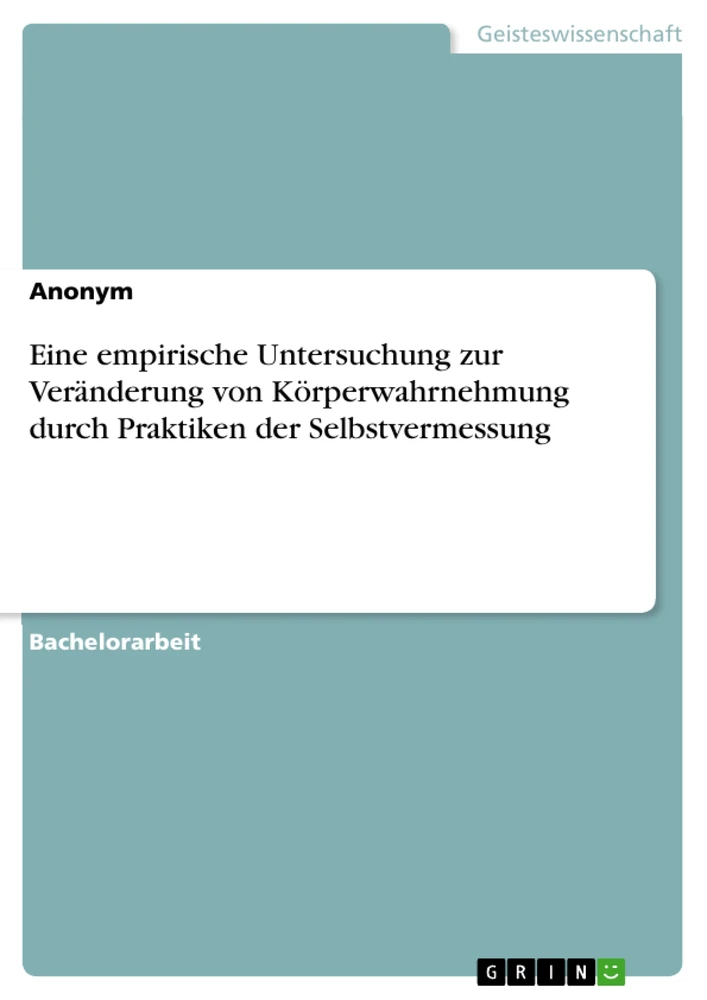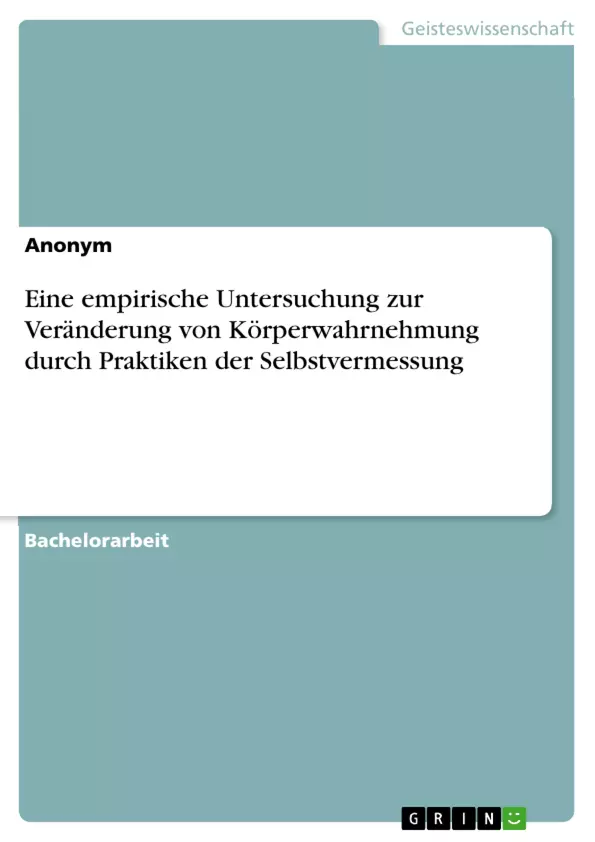Wie viele Schritte bin ich heute gelaufen? Wie war meine Schlafqualität? Wie viel Wasser habe ich heute getrunken? Und wie viele Kalorien habe ich dabei verbraucht? Wie schnell und wie weit bin ich gerade gejoggt? All diese Fragen und noch viele weitere können heutzutage sogenannte Self-Tracker beantworten. Durch diese lassen sich nahezu alle Körperzustände vermessen und überwachen. Ziel der Vermessung des Selbst ist es, sich und seinen Körper besser zu verstehen und die gemessenen Werte zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verbessern, um gesünder und aktiver zu leben. Das Besondere daran ist, dass man für diese Messverfahren und Auswertungen kein zusätzliches Wissen benötigt, sondern komplett eigenständig vorgehen kann. Self-Tracking-Gadgets können Apps, Armbänder oder andere unauffällige, kleine Geräte sein, die im Alltag all die Körper- und Verhaltensdaten aufzeichnen und auswerten, die vorher nicht sichtbar waren. Bestimmte Algorithmen verrechnen die Daten und bereiten sie in Form von Zahlen, Kurven und Statistiken für den Nutzer ansprechend auf. Im heutigen modernen Zeitalter sind sie sehr leicht zu beschaffen, teilweise sogar kostenlos, leicht bedienbar und so einer großen Gruppe zugänglich. Mittlerweile sind sie zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden.
Die wissenschaftliche Aufbereitung und die daraus abzuleitende vermeintliche Objektivität der Daten und Zahlen übt offenbar eine große Anziehungs- und Überzeugungskraft auf den Menschen aus. Sie erwecken den Anschein, die Realität genauso abzubilden, wie sie ist und damit exakter zu sein als die subjektive, menschliche Wahrnehmung. Dass die Daten aber auch immer in den richtigen Kontext gesetzt werden und richtig analysiert werden müssen, wird dabei oft vergessen. Gerade im Sportbereich, in dem es schon immer um die Steigerung der Leistungsfähigkeit ging, werden die Tracking-Gadgets häufig genutzt. Doch entfremden wir uns durch solche Selbstvermessungspraktiken nur mehr von unserem Körper und uns selbst oder lernen wir unseren Körper besser zu verstehen? Dieser Forschungsfrage möchte ich in dieser Arbeit besonders in Bezug auf den Bereich Sport- und Fitness nachgehen und herausfinden, wie sehr Fitness-Apps das Verhältnis zu unserem eigenen Körper beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Self-Tracking
- 2.1.2 Lifelogging
- 2.1.3 Quantified-Self-Bewegung
- 2.2 Aktueller Forschungsstand
- 2.3 Geschichtlicher Hintergrund
- 2.3.1 Selbstthematisierung im Tagebuch um 1800
- 2.3.2 Einführung erster mechanischer Geräte um 1900
- 2.3.3 Selbstvermessung im 21. Jahrhundert
- 3. Verobjektivierung des Subjekts
- 3.1 Self-Tracking zwischen Leib und Körper
- 3.1.1 Anthropologische Philosophie: Dualität des menschlichen Körpers
- 3.1.2 Neophänomenologische Soziologie: Leib sein und Körper haben
- 3.1.3 Wahrnehmung von objektivierten Zahlenkörpern
- 3.2 Sichtweisen auf Verobjektivierung
- 3.2.1 Self-Tracking als Befreiung und Selbstermächtigung
- 3.2.3 Self-Tracking als Naturbeherrschung
- 4. Selbstexperiment: Was machen Lauf-Apps mit mir und meinem Körper?
- 4.1 Methoden
- 4.2 Kommentar zur Autoethnografie
- 4.3 Verwendete Apps
- 4.3.1 Runtastic
- 4.3.2 Nike Run Club
- 4.3.3 Appvergleich
- 4.4 Durchführung des Experiments und Auswertung
- 4.4.1 Technik vs. leibliches Gefühl
- 4.4.2 Motivationsaspekt
- 4.4.3 Abhängigkeit von Technik
- 4.4.4 Schlussfolgerungen: neue Körper- und Subjektverhältnisse?
- 5. Auswirkungen auf andere gesellschaftliche Bereiche
- 5.1 Der Mensch als Ware: Social Surveillance und Big Data
- 5.2 Self-Tracking in Unternehmen und im Gesundheitswesen
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Self-Tracking-Apps, insbesondere im Fitnessbereich, auf das Verhältnis des Individuums zu seinem Körper und Selbst. Sie analysiert die Verobjektivierung des Subjekts durch quantifizierte Selbstmessung und beleuchtet die geschichtlichen Wurzeln dieser Praxis.
- Definition und Abgrenzung von Self-Tracking und verwandten Begriffen
- Analyse der Verobjektivierung des Subjekts durch Self-Tracking
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen von Fitness-Apps auf Körperwahrnehmung und -verhältnis
- Gesellschaftliche Auswirkungen von Self-Tracking (Big Data, Überwachung)
- Geschichtliche Entwicklung der Selbstvermessung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 (Grundlagen): Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Self-Tracking und Lifelogging und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand sowie die historische Entwicklung der Selbstvermessung. Es differenziert zwischen aktiven und passiven Tracking-Methoden.
Kapitel 3 (Verobjektivierung des Subjekts): Hier wird die scheinbare Verobjektivierung des Subjekts durch Self-Tracking untersucht, indem philosophische und soziologische Perspektiven auf das Verhältnis von Leib und Körper betrachtet werden. Verschiedene Sichtweisen auf diesen Prozess der Verobjektivierung werden beleuchtet.
Kapitel 4 (Selbstexperiment): Dieses Kapitel beschreibt ein empirisches Selbstexperiment mit Lauf-Apps, um die Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung und das Verhältnis zum eigenen Körper zu untersuchen. Methodische Aspekte und die Auswertung des Experiments werden dargelegt.
Kapitel 5 (Auswirkungen auf andere gesellschaftliche Bereiche): Dieses Kapitel behandelt den Einfluss von Self-Tracking auf gesellschaftliche Bereiche wie Datenüberwachung und Big Data sowie den Einsatz im Unternehmen und Gesundheitswesen.
Schlüsselwörter
Self-Tracking, Lifelogging, Quantified Self, Verobjektivierung, Körperwahrnehmung, Subjekt, Fitness-Apps, Big Data, Datenüberwachung, Autoethnografie, Leib, Körper, Selbstvermessung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Eine empirische Untersuchung zur Veränderung von Körperwahrnehmung durch Praktiken der Selbstvermessung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1502528