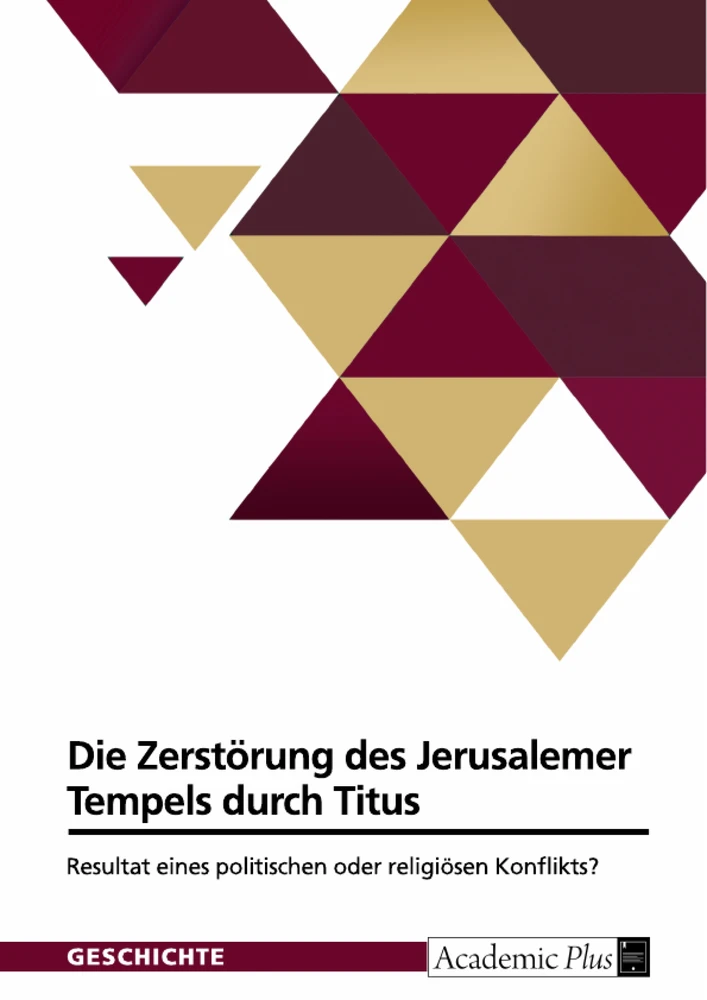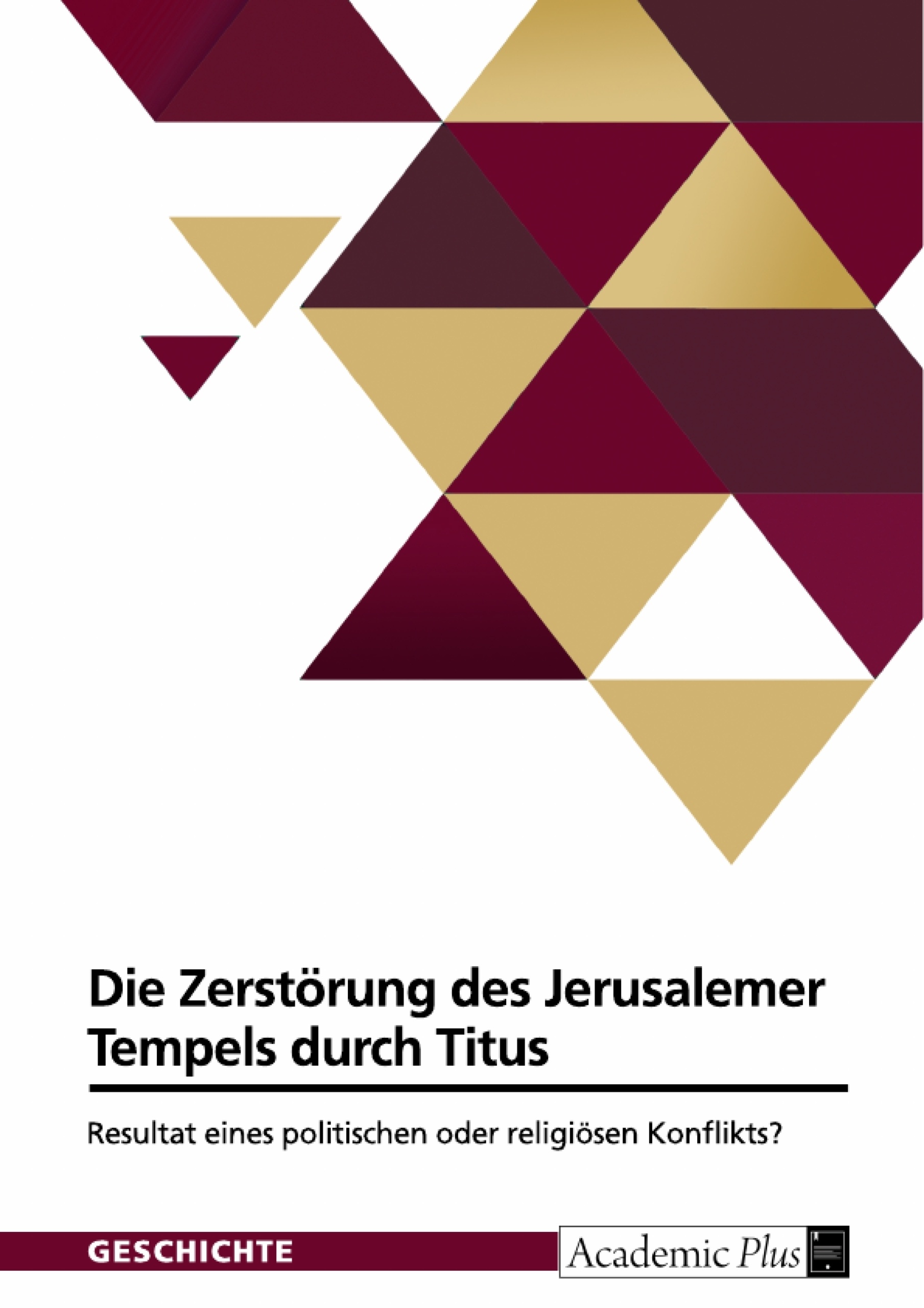In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob der Konflikt, der schlussendlich zur Zerstörung des Tempels führte, ein religiöser oder ein politischer war. Um diese Frage beantworten zu können, werden erst politische, dann religiöse Konfliktherde, die sich in Jerusalem ab 6 n. Chr. unter römischer Herrschaft ergaben, beleuchtet. Es wird untersucht, inwiefern politische Maßnahmen der Römer — wie das Erlassen von Steuern oder militärische Präsenz in der Heiligen Stadt — zu Spannungen zwischen Juden und Römern führten. Wie stark war die römische Steuerlast? Wie präsent war das römische Heer in Jerusalem? Welche Spannungen ergaben sich daraus?
Außerdem soll geklärt werden, ob der jüdische Glaube — der durch seinen Monotheismus ein besonderer war — unter der römischen Besatzung litt. Dafür wird untersucht, welche Auswirkungen das göttliche Selbstverständnis des römischen Kaisers auf das jüdische Leben und auf den Tempel hatte: Gab es einen Kaiserkult in Jerusalem? Falls ja, wie problematisch war dieser für die Juden? Am Beispiel von Caligula soll diese Frage behandelt werden.
Ebenso soll analysiert werden, wieviel Rücksicht die Römer auf jüdische Gebote, Gesetze und Eigenartigkeiten nahmen. Sorgte das Missachten jüdischer Gebote von Seiten der Römer für Unmut bei den Juden? Entweihten die Römer — bewusst oder unbewusst — den Tempel? Und welche Rolle spielten dabei die Prokuratoren? Schließlich soll betrachtet werden, was (und wer) schlussendlich den Krieg auslöste.
Daraufhin soll untersucht werden, wie sich die jüdische(n) Widerstandsbewegung(en) entwickelte(n). Welche Ziele verfolgte(n) sie? Änderten sich diese Ziele mit Beginn des Krieges? War(en) sie primär religiös oder politisch motiviert? Hier wird vor allem die Gruppe der Zeloten im Fokus der Untersuchung stehen. Auch muss untersucht werden, ob die Juden geschlossen gegen Rom vorgingen oder ob es auch innerjüdische Differenzen gab. Stießen die Aufständischen auf Widerstand in den eigenen Reihen? Gab es Gruppierungen, die romfreundlich waren? Welchen Einfluss hatte das auf den Krieg in Jerusalem und die Tempelzerstörung? Außerdem soll geklärt werden, welchen Stellenwert politische Macht innerhalb der Gruppe der Zeloten hatte. Sorgte sie für Konflikte innerhalb der radikalen Aufständischen?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1 Zielsetzung und Methodik
- 0.2 Zu Josephus als Hauptquelle
- I. Jerusalems Eingliederung ins Imperium Romanum
- II. Konfliktherde in Jerusalem ab 6 n. Chr.
- II.1 Politische Konfliktherde in Jerusalem
- II.1.1 Erdrückende Steuerlast? Rom und die Prokuratoren als Plünderer
- II.1.2 Provokateure in Uniform: Römische Soldaten und Militärpräsenz als Unruhestifter
- II.2 Religiöse Konfliktherde in Jerusalem
- II.2.1 Ein Konkurrent für Jahwe? Jüdischer Monotheismus wider römischen Kaiserkult
- II.2.1.1 Das Kaiseropfer im Jerusalemer Tempel
- II.2.1.2 Pilatus und die Feldzeichen in Jerusalem
- II.2.1.3 Die Caligula-Krise
- II.2.2 Auri sacra fames: Plünderungen des Jerusalemer Tempelschatz durch Rom
- II.2.2.1 Pilatus' Griff in den Tempelschatz
- II.2.2.2 Im Auftrag des Kaisers? Florus plündert den Tempelschatz
- II.2.1 Ein Konkurrent für Jahwe? Jüdischer Monotheismus wider römischen Kaiserkult
- II.1 Politische Konfliktherde in Jerusalem
- III. Der Weg zur Zerstörung des Tempels
- III.1 Gewollter Krieg? Florus: Ein Prokurator als Auslöser des Aufstandes
- III.2 Krieg gegen Rom?! Die Zeloten als kriegstreibende Kraft: politisch-nationalistisch oder religiös motiviert?
- III.3 Für oder gegen Rom? Bürgerkrieg statt Befreiung in Jerusalem
- III.3.1 Kampf der Zeloten gegen die Romtreuen
- III.3.2 Die Spaltung der Zeloten und ihre Folgen für Jerusalem
- III.3.3 „Jüdischer Krieg“? Kampf um die (politische) Macht in Jerusalem
- III.4 Titus und die Zerstörung des Tempels: Unfall oder Absicht?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. Sie hinterfragt die gängige Praxis, die Katastrophe auf einen einzigen Faktor zurückzuführen, und analysiert stattdessen politische und religiöse Konfliktherde in Jerusalem ab 6 n. Chr. Das Ziel ist es, zu klären, ob der Konflikt primär politischer oder religiöser Natur war.
- Politische Konflikte zwischen Juden und Römern (Steuerlast, Militärpräsenz).
- Religiöse Konflikte im Kontext des römischen Kaiserkults und des jüdischen Monotheismus.
- Die Rolle der Prokuratoren bei der Eskalation des Konflikts.
- Die Rolle der Zeloten und der innere Konflikt innerhalb der jüdischen Bevölkerung.
- Analyse der Ereignisse, die zum Krieg und der Zerstörung des Tempels führten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die methodische Vorgehensweise. Kapitel I behandelt die Eingliederung Jerusalems ins Römische Reich. Kapitel II beleuchtet politische und religiöse Konfliktherde in Jerusalem ab 6 n. Chr., einschliesslich der römischen Steuerpolitik, der Militärpräsenz und des Spannungsfeldes zwischen römischem Kaiserkult und jüdischem Monotheismus. Kapitel III beschreibt den Weg zur Zerstörung des Tempels, indem es den Konflikt zwischen den Zeloten und den Romtreuen sowie die Rolle von Prokuratoren wie Florus analysiert.
Schlüsselwörter
Jerusalemer Tempel, Zerstörung des Tempels, Römisches Reich, Judäa, Kaiserkult, jüdischer Monotheismus, Zeloten, Prokuratoren, politische Konflikte, religiöse Konflikte, Römische Steuerpolitik, militärische Besatzung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch Titus. Resultat eines politischen oder religiösen Konflikts?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1502574