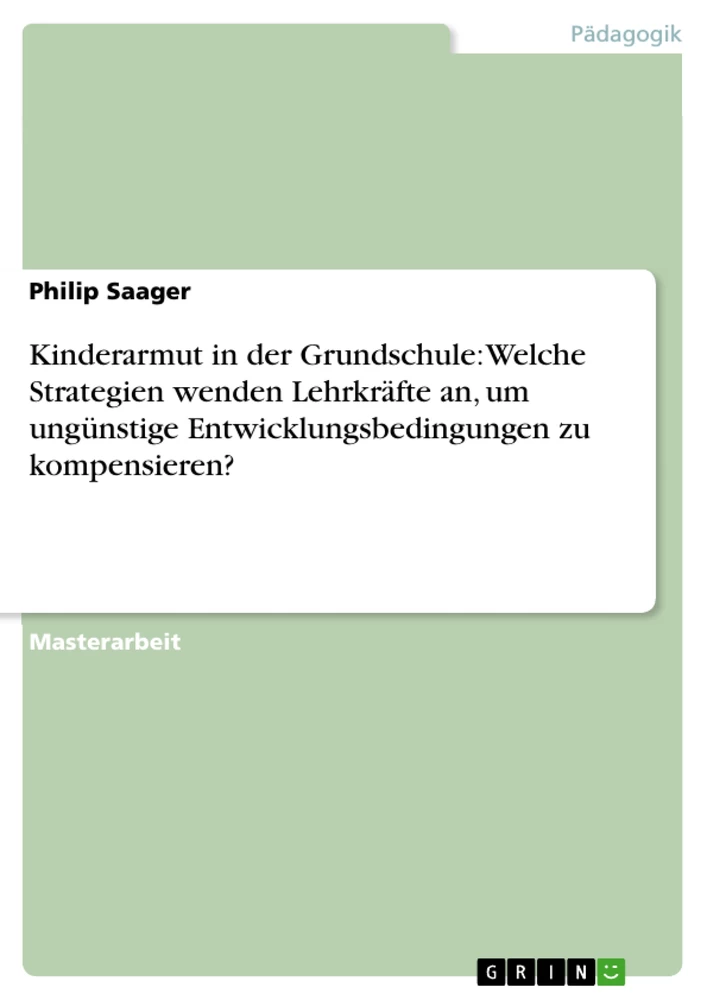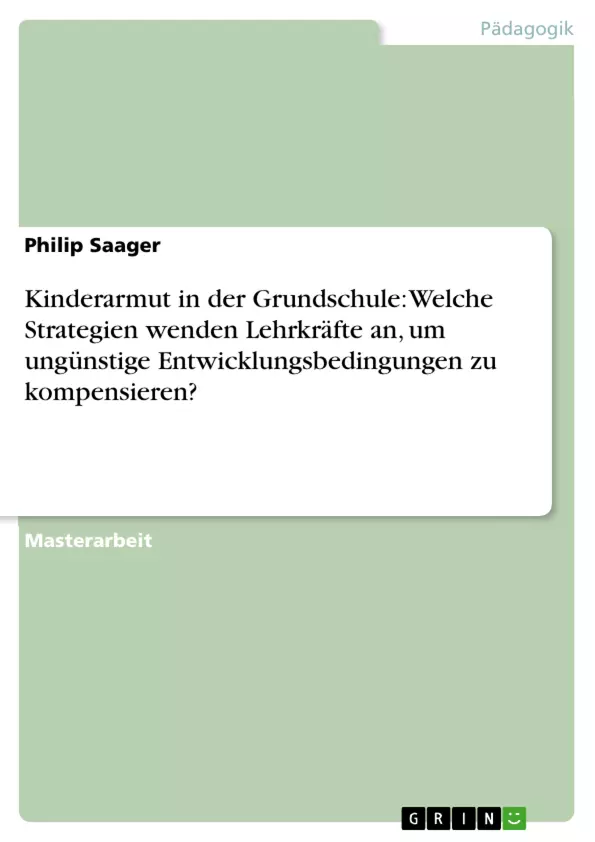„Above all, we need to focus on young children who are poor” (Werner, 2000, S. 129)
Mit diesen Worten wird ganz klar deutlich gemacht, dass es längst an der Zeit ist, sich mit dem Phänomen Kinderarmut in Deutschland auseinanderzusetzen. Diese Erkenntnis, und die sich daraus ergebenden Handlungsnöte sind nicht zuletzt ausschlaggebend für die Wahl des Themas der vorliegenden Ausarbeitung, die sich aus einem theoretischen und einem empirischen Teil zusammensetzt. In dem ersten Teil der Arbeit geht es darum, ein fundiertes, theoretisches Grundwissen herauszuarbeiten. Dabei erscheint es zunächst unumgänglich zu definieren, was mit dem Begriff Armut gemeint ist, in welcher Art und Weise Armut in Deutschland überhaupt eine Rolle spielt, und wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Es stellt sich hierbei die Frage, ob sich Armut „nur“ auf monetäre Ressourcen bezieht, oder welche weiteren Faktoren relevant sind. Nach der Definitionsbestimmung des Begriffs Armut geht es darum aufzuzeigen, welche Auswirkungen Armut auf das kindliche Leben haben kann, und wie die Politik agiert, um den daraus resultierenden Problemen entgegenzuwirken. Exemplarisch ist an dieser Stelle dann auf die Risikogruppen einzugehen, die laut verschiedenster Statistiken am gefährdetsten sind, längerfristig in den so genannten Teufelskreis der Armut hineingezogen zu werden.
„Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf, und dies ist der Anfang eines Teufelskreises von schlechter Gesundheit, schlechten Bildungschancen und kaum Aussichten auf einen zukünftigen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Die Diskriminierung sozial benachteiligter Kinder verstärkt diese Tendenz auch in der Selbstzuschreibung: ein glückliches und gesundes Leben scheint ihnen oft gar nicht mehr denkbar“ (Geene & Gold, 2009, S. 7).
Dabei werden Kinder von alleinerziehenden Eltern, Kinder mit vielen Geschwistern und Migrantenkinder in den Fokus gerückt. Es geht hier also um Chancen(-un)gleichheit in Bezug auf den familiären sozialen Status.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Absolute Armut
- Relative Armut
- Der Ressourcenansatz
- Der Lebenslagenansatz
- Auswirkungen von Armut auf Kinder und politische Intervention
- Risikogruppen
- Ein-Eltern-Kinder
- Kinderreiche Familien
- Familien mit Migrationshintergrund
- Momentane Situation in Deutschland/Forschungsstand
- Theoriekonzepte
- Identitätskonzept
- Konzept der Lebensbewältigung
- Konzept der Resilienz
- Die Kauai-Studie
- Die Mannheimer- Risikokinder- Studie
- Handlungskonzepte zur Resilienzförderung
- Kindzentriertes Konzept
- Schule als Schutzfaktor
- Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Problematik von Kinderarmut in der Grundschule und analysiert, welche Strategien Lehrkräfte anwenden, um ungünstige Entwicklungsbedingungen zu kompensieren.
- Definitionen und Auswirkungen von Kinderarmut
- Risikogruppen und ihre spezifischen Herausforderungen
- Theoriekonzepte zur Erklärung von Armutsfolgen und Resilienz
- Empirische Untersuchung von Lehrkräfte-Strategien
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Kinderarmut in der Grundschule hervorhebt und die Forschungsfrage formuliert. Im Anschluss werden zentrale Begriffe wie Armut, Ressourcenansatz und Lebenslagenansatz definiert. Es werden die Auswirkungen von Armut auf Kinder und die wichtigsten Risikogruppen beschrieben. Anschließend wird die aktuelle Situation in Deutschland und der Forschungsstand zum Thema Kinderarmut beleuchtet.
Im Theorieteil werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die die Folgen von Armut für Kinder und die Entstehung von Resilienz erklären. Dazu gehören das Identitätskonzept, das Konzept der Lebensbewältigung und das Konzept der Resilienz. Die Arbeit analysiert verschiedene Studien, darunter die Kauai-Studie und die Mannheimer-Risikokinder-Studie, um die Bedeutung von Schutzfaktoren und Handlungskonzepte zur Resilienzförderung zu beleuchten.
Der Empirieteil der Arbeit untersucht anhand von Interviews mit Lehrkräften, welche Strategien diese anwenden, um Kinder aus armutsgefährdeten Familien zu unterstützen. Es werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Grundschule, Lehrkräfte, Strategien, Kompensation, Risikogruppen, Resilienz, Schutzfaktoren, Handlungskonzepte, Empirische Forschung, Qualitative Methoden.
- Citation du texte
- Philip Saager (Auteur), 2010, Kinderarmut in der Grundschule: Welche Strategien wenden Lehrkräfte an, um ungünstige Entwicklungsbedingungen zu kompensieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150264