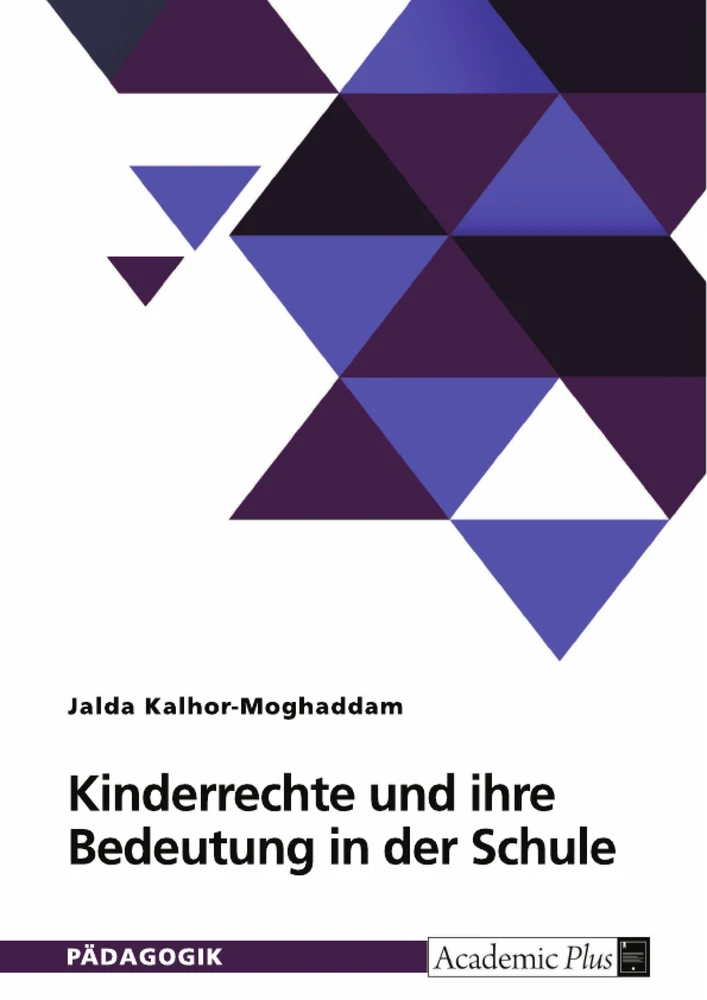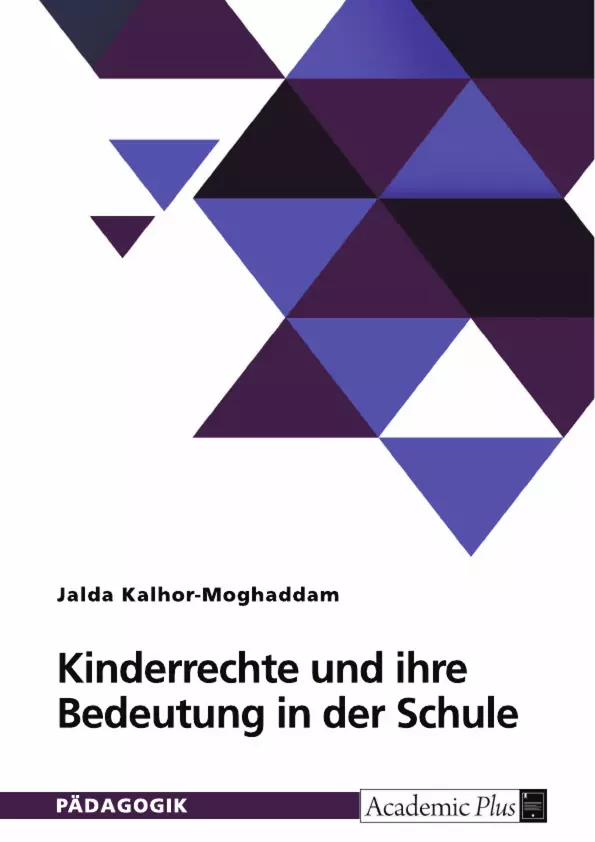In Zeiten der COVID-19-Pandemie sind die negativen gesellschaftlichen Phänomene, wie Gewalt an Schulen, Rassismus und Politikverdrossenheit, verstärkt hervorgetreten. Die Schulen haben den Auftrag, die Kinder freiheitlich-demokratisch zu erziehen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Bildungsarbeit an Grundschulen im Lichte der UN-Kinderrechtskonvention dazu beitragen kann, Kinder zu Toleranz und gegenseitigem Respekt zu erziehen.
Am Beispiel der XY-Schule soll untersucht werden, wie eine kinderrechtsbasierte Bildung aussieht und welchen Effekt diese auf die Schüler*innen hat. Die Annahme ist, dass genügend Umsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und die Maßnahmen eine positive Auswirkung auf das Leben aller am Schulleben Beteiligten hat. Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde zuerst eine Literaturrecherche durchgeführt, die sich im Schwerpunkt auf die kinderrechtsbasierte Bildung und Demokratiepädagogik konzentriert. Danach fand ein Mixed-Methods Ansatz Anwendung. Hierbei wurde eine qualitative Teilstudie, die die Sichtweise der Lehrkräfte zum Gegenstand hat, sowie eine quantitative Teilstudie, die die Sichtweise der Schüler*innen zeigt, durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Teilstudien wurden dargestellt, ausgewertet und interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Forschungsfragen, Ziel und Methodik der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Grundlagen der Kinderrechte
- 2.1 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989)
- 2.1.1 Leitgedanken und Aufbau der UN-KRK
- 2.1.2 Wesentlicher Inhalt der UN-KRK
- 2.1.2.1 Schutzrechte
- 2.1.2.2 Förderrechte
- 2.1.2.3 Beteiligungsrechte
- 2.1.2.4 Gebäude der Kinderrechte
- 2.1.2.5 Die zehn wichtigsten Kinderrechte
- 2.2 Aktueller Forschungsstand
- 2.2.1 Gelingensbedingungen einer nachhaltigen Verankerung von Kinderrechten in der Grundschule (2021)
- 2.2.2 Landesbausparkassen-Kinderbarometer (2020)
- 2.2.3 Kinderrechte-Index (2019)
- 2.2.4 UNICEF Kinderrechte-Umfrage (2019)
- 2.2.5 World Vision Kinderstudie (2018)
- 2.3 Historische Perspektive
- 2.3.1 Geschichte der Kindheit
- 2.3.1.1 Kindsein
- 2.3.1.2 Kindheit im Wandel
- 2.3.2 Bedeutende Persönlichkeiten im Lichte der UN-KRK
- 2.3.2.1 Ellen Key (1849–1926)
- 2.3.2.2 Eglantyne Jebb (1876–1928)
- 2.3.2.3 Janusz Korczak (1878/1879–1942)
- 2.3.3 Geschichte der Menschenrechte
- 2.3.3.1 Entwicklungslinien ab dem 17. Jahrhundert
- 2.3.3.2 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)
- 2.3.3.3 Erste umfassende Menschenrechtsverträge
- 2.3.3.4 Behindertenrechtskonvention (2006)
- 2.3.4 Geschichte der Kinderrechte
- 2.3.4.1 Die drei Grundrechte des Kindes nach Korczak (1919)
- 2.3.4.2 Genfer Erklärung (1924)
- 2.3.4.3 Erklärung der Rechte des Kindes (1959)
- 2.3.4.4 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989)
- 2.4 Rechtliche Perspektive
- 2.4.1 Begriff und Funktion des Rechts
- 2.4.2 Begriff und Struktur der Demokratie
- 2.4.3 System der Rechtsquellen
- 2.4.3.1 Völkerrecht
- 2.4.3.2 Europarecht
- 2.4.3.3 Verfassungsrecht
- 2.5 Gesellschaftspolitische Perspektive
- 2.5.1 Gegenwärtige Rechte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland
- 2.5.1.1 Rechte der Kinder im Völkerrecht
- 2.5.1.2 Rechte der Kinder im Europarecht
- 2.5.1.3 Rechte der Kinder im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- 2.5.1.4 Rechte der Kinder in den Landesverfassungen
- 2.5.2 Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz
- 2.5.2.1 Inhalte des damaligen Koalitionsvertrages
- 2.5.2.2 Erwartungen der expliziten Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz
- 2.5.2.3 Bedeutung der UN-KRK für das Vorhaben
- 2.5.2.4 Folgen einer Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz
- 3 Pädagogische Perspektive
- 3.1 Kinderrechte und die Grundschule
- 3.2 Demokratiepädagogik
- 3.2.1 Demokratiepädagogik
- 3.2.1.1 Partizipation
- 3.2.1.2 Resilienz und Selbstwirksamkeit
- 3.2.2 Die Rolle der Lehrkraft
- 3.2.3 Klassenrat als demokratisches Gremium
- 3.2.3.1 Merkmale und Elemente des Klassenrates
- 3.3 Kinderrechtsbasierte Bildung
- 3.3.2 Kindergerechte Schulentwicklung
- 4 Empirische Untersuchung
- 4.1 Qualitative Teilstudie
- 4.1.1 Auswahl und Beschreibung der Methode: Expert*inneninterview
- 4.1.2 Auswertungsmethode
- 4.1.3 Interviewleitfaden
- 4.1.3.1 Fragetypen
- 4.1.3.2 Anfertigung des Interviewleitfadens
- 4.1.4 Durchführung
- 4.2 Quantitative Teilstudie
- 4.2.1 Auswahl und Beschreibung der Methode: Online-Befragung
- 4.2.2 Auswertungsmethode
- 4.2.3 Fragebogendesign
- 4.2.3.1 Ablauf der Fragebeantwortung
- 4.2.3.2 Konstruktion des Fragebogens
- 4.2.3.3 Forschungsethik und Datenschutz
- 4.2.3.4 Technische Überprüfung und Pretest
- 4.2.4 Durchführung
- 5 Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Qualitative Teilstudie
- 5.2 Quantitative Teilstudie
- 5.2.1 Individuelle Bezüge zum Thema „Kinderrechte“
- 6 Diskussion der Ergebnisse
- 7 Fazit und Ausblick
- Umsetzung der UN-KRK in der Grundschule
- Partizipation von Kindern im Schulalltag
- Auswirkungen der Kinderrechte-Umsetzung auf das Schulklima
- Demokratiepädagogik im Kontext von Kinderrechten
- Zusammenhang zwischen Kinderrechten und Wohlbefinden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) im Kontext der Grundschule. Das Hauptziel ist es herauszufinden, ob und wie Kinderrechte im Schulalltag umsetzbar sind und welche Auswirkungen dies auf die Schulgemeinschaft hat. Besonderes Augenmerk liegt auf der Partizipation und Verantwortungsübernahme der Schüler*innen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfragen, das Ziel und die Methodik der Arbeit. Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der Kinderrechte, basierend auf der UN-KRK und aktuellem Forschungsstand. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die die Umsetzung von Kinderrechten an Grundschulen untersuchen. Kapitel 3 beleuchtet die pädagogische Perspektive und thematisiert kinderrechtsbasierte Bildung und kindergerechte Schulentwicklung.
Kapitel 4 beschreibt die empirische Untersuchung mit ihren qualitativen und quantitativen Methoden (Expert*inneninterviews und Online-Befragung). Kapitel 5 fasst die Ergebnisse beider Teilstudien zusammen, und Kapitel 6 diskutiert diese Ergebnisse. Der Schluss (Kapitel 7) und der Ausblick wurden ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Kinderrechte, UN-Kinderrechtskonvention, Grundschule, Demokratiepädagogik, Partizipation, Schulklima, Wohlbefinden, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Resilienz, Selbstwirksamkeit, Partizipative Lernarrangements.
- Citar trabajo
- Jalda Kalhor-Moghaddam (Autor), 2022, Kinderrechte und ihre Bedeutung in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1502897