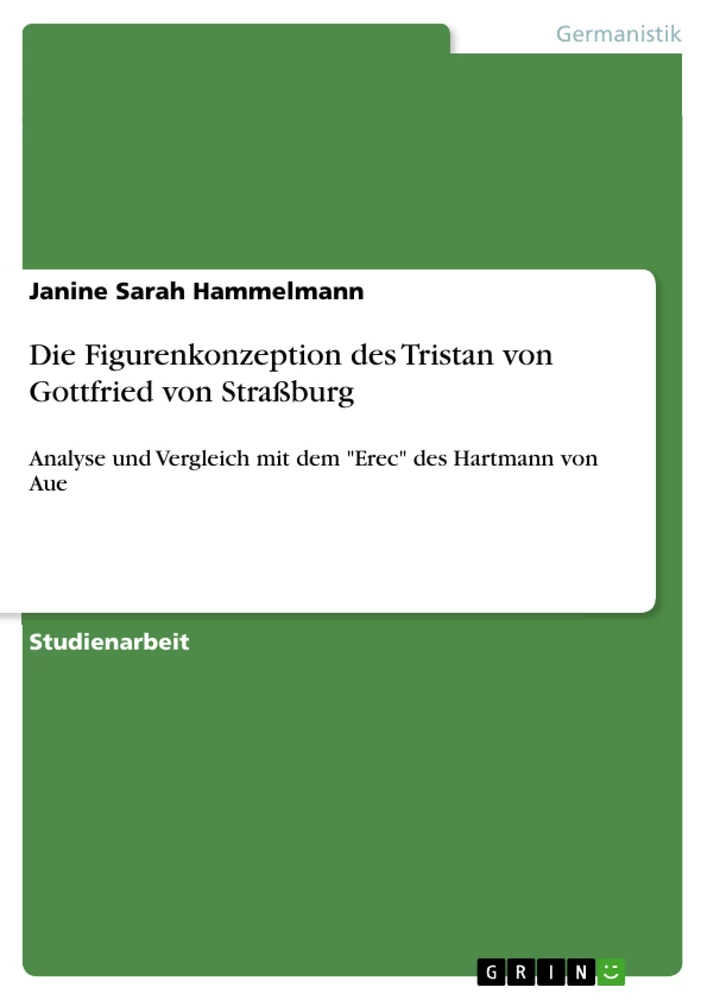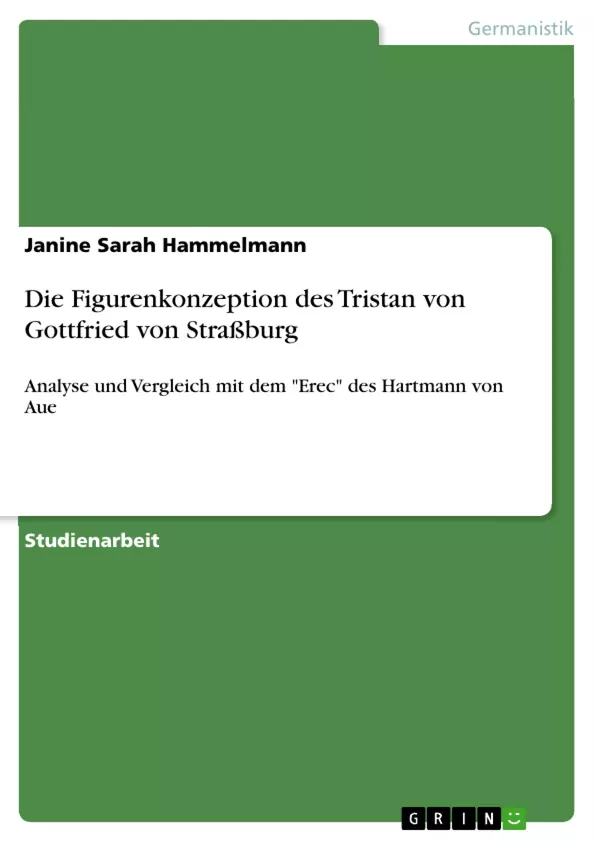Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit mit der Figurenkonzeption des
Tristan von Gottfried von Straßburg befassen. Ich habe dieses Thema
gewählt, da mich die Ideale, denen ein Held im höfischen Roman zu
entsprechen hatte, interessieren und weil ich Tristan in diesem
Zusammenhang für eine herausragende Figur halte, die weiterer
Beschäftigung wert ist. Die Untersuchung der Figurenkonzeption in
höfischen Romanen kommt meistens viel zu kurz und hat in diesem Fall
zudem noch einen besonderen Reiz für mich, da die Figur Tristan mich
bereits seit längerer Zeit fasziniert.
Ich werde so vorgehen, dass ich zunächst einiges zur Figurenkonzeption
höfischer Romane schreibe. Anschließend werde ich die Figur des
Tristans analysieren. Das darauf folgende Kapitel wird die Konzeption
Tristans mit der Konzeption des Erecs vergleichen. In einem
abschließenden Kapitel werde ich meine Folgerungen aus der Analyse
festhalten und schließlich meine Ergebnisse im Schlussteil noch einmal
zusammenfassen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zur Figurenkonzeption höfischer Romane
- Historischer Hintergrund
- Analyse der Konzeption Tristans
- Konzeption Tristans im Vergleich mit der Konzeption Erecs
- Folgerung aus der Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Figurenkonzeption des Tristan von Gottfried von Straßburg. Sie untersucht die Ideale, die ein Held im höfischen Roman erfüllen musste, und analysiert Tristan als eine herausragende Figur, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Arbeit beleuchtet die Figurenkonzeption in höfischen Romanen und untersucht, wie Tristan in diesem Kontext besonders interessant ist.
- Analyse der Figurenkonzeption in höfischen Romanen
- Untersuchung der Ideale, die ein Held im höfischen Roman erfüllen musste
- Analyse der Figur Tristans im Kontext dieser Ideale
- Vergleich der Konzeption Tristans mit der Konzeption des Erecs
- Folgerungen aus der Analyse der Figurenkonzeption Tristans
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Motivation des Autors vor. Es wird erläutert, warum die Figurenkonzeption des Tristans von Gottfried von Straßburg ein interessantes Thema ist und welche Aspekte im Fokus der Arbeit stehen.
- Allgemeines zur Figurenkonzeption höfischer Romane: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Ideale, die Helden in höfischen Romanen erfüllen mussten. Es wird auf die typischen Eigenschaften von Helden und Heldinnen in dieser Gattung eingegangen.
- Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext, in dem Gottfried von Straßburgs Tristan entstand. Es werden Informationen zur Entstehung des Romans, zur Person des Autors und zu den Einflüssen aus der Zeit gegeben.
- Analyse der Konzeption Tristans: Dieses Kapitel analysiert die Figur des Tristans anhand des Textes. Es wird auf seine besonderen Eigenschaften, seine Rolle im Roman und seine Beziehung zu anderen Figuren eingegangen.
- Konzeption Tristans im Vergleich mit der Konzeption Erecs: Dieses Kapitel vergleicht die Figurenkonzeption Tristans mit der des Erecs, einem weiteren bekannten Helden aus der höfischen Literatur. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Figuren herausgestellt.
Schlüsselwörter
Höfischer Roman, Figurenkonzeption, Tristan, Gottfried von Straßburg, Ideale, Held, Heldin, mittelalterliche Literatur, Rittertum, Minne, Kunst, Kultur, Geschichte, Frankreich, Vergleich, Erecs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Figur Tristan bei Gottfried von Straßburg?
Tristan gilt als herausragende Figur, die die traditionellen Ideale eines Helden im höfischen Roman auf komplexe Weise verkörpert und teilweise neu definiert.
Welche Ideale musste ein Held im höfischen Roman erfüllen?
Zu den Idealen gehören Ritterlichkeit, höfische Erziehung, Mut, Treue sowie die Fähigkeit zur Minne (höfische Liebe) und Kunstfertigkeit.
Wie wird Tristan mit der Figur Erec verglichen?
Die Arbeit zieht einen Vergleich zwischen Tristans Konzeption und der des Erecs (von Hartmann von Aue), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede ritterlicher Heldenmodelle aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt der historische Hintergrund für den Roman?
Die Entstehung des Romans ist eng mit der höfischen Kultur des Mittelalters und den literarischen Einflüssen aus Frankreich verknüpft, die Gottfried von Straßburg adaptierte.
Was thematisiert die Figurenkonzeption im Hinblick auf die Minne?
Die Analyse untersucht, wie Tristans Liebe zu Isolde sein ritterliches Handeln beeinflusst und ihn in Konflikt mit gesellschaftlichen Normen bringt.
- Quote paper
- B.A. Janine Sarah Hammelmann (Author), 2006, Die Figurenkonzeption des Tristan von Gottfried von Straßburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150350