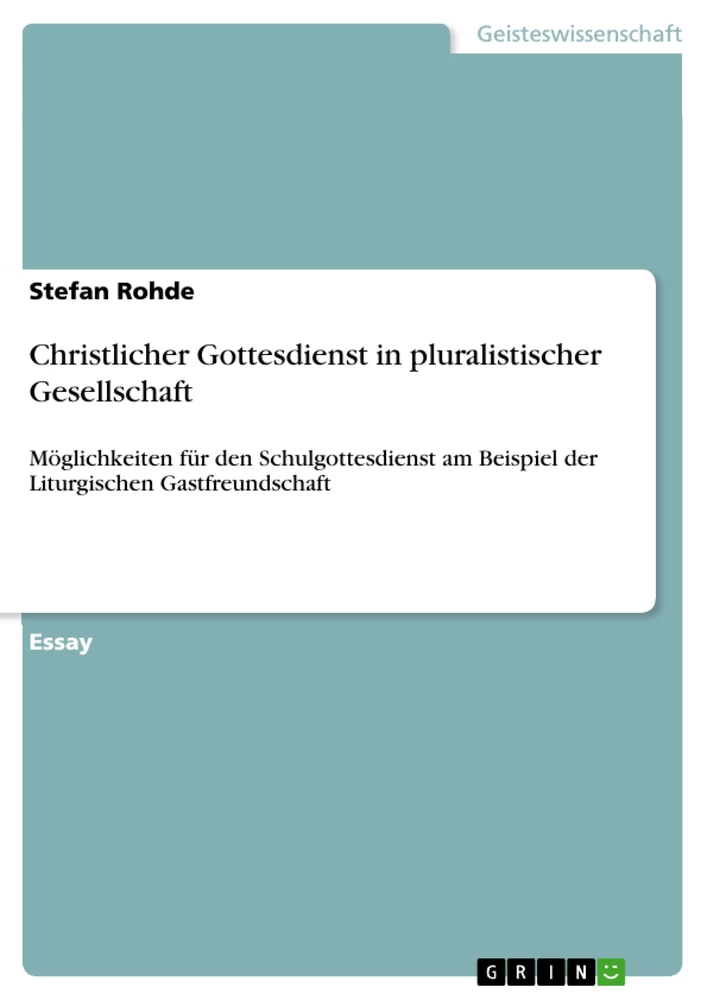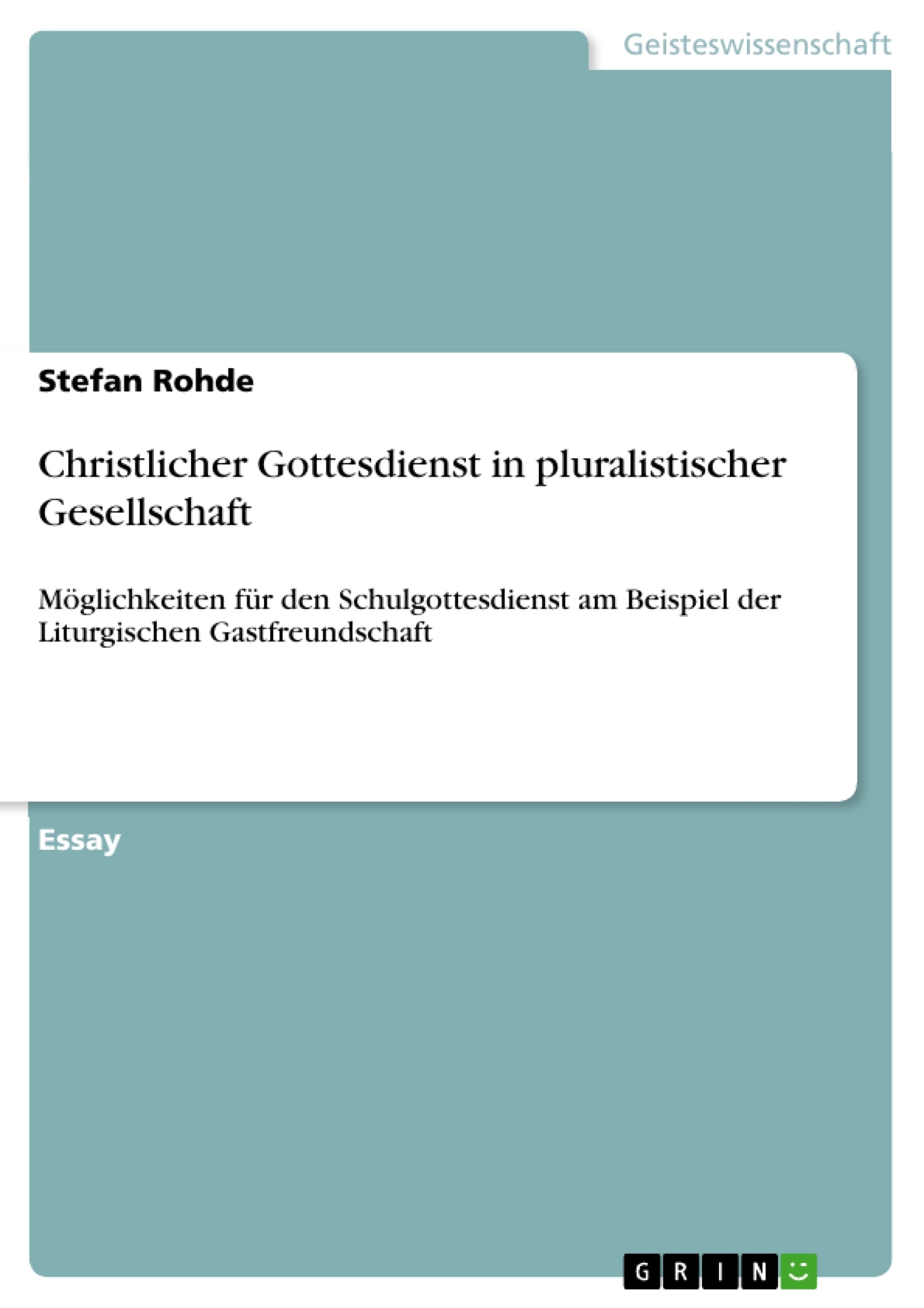Besonders als Religionslehrer ist die Situation des religiösen Pluralismus schwierig zu handhaben, weil Schüler, die verschiedenen Religionen angehören, in (schul-)gottesdienstlichen Situationen gleichermaßen geachtet und angesprochen werden sollen. Um Anhaltspunkte für ein Verhalten in der Vorbereitung von Feiern mit Menschen verschiedener Religionen zu geben, soll in diesem Essay zunächst geklärt werden, wie man aus liturgiewissenschaftlicher Sicht den Pluralismus differenzieren kann, indem die Kennzeichen des religiösen und rituellen Pluralismus aufgezeigt werden, um danach die Frage danach zu stellen, wie diese beiden Formen zusammenhängen. Anschließend sind die Herausforderungen und Aufgaben an das liturgische Leben der Kirche darzustellen. Hieraus entwickeln sich Problemfelder, die es an meinem Beispiel für ein liturgisches Projekt, das sich dem Pluralismus stellt, auszuführen gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Liturgie und Kultur
- Religiöser und ritueller Pluralismus
- Der Begriff des Pluralismus
- Religiöser Pluralismus
- Ritueller Pluralismus
- Kernprobleme
- Feiertypen
- Liturgische Gastfreundschaft
- Multireligiöse Feiern
- Interreligiöse Feiern
- Religiöse Feiern für alle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit den Herausforderungen des christlichen Gottesdienstes in einer pluralistischen Gesellschaft, insbesondere im Kontext des Schulgottesdienstes. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs zwischen Religionen im liturgischen Leben aufzuzeigen, wobei der Fokus auf dem Konzept der Liturgischen Gastfreundschaft liegt.
- Differenzierung zwischen religiösem und rituellem Pluralismus
- Herausforderungen und Aufgaben des liturgischen Lebens in einer pluralistischen Gesellschaft
- Das Spannungsverhältnis zwischen Liturgie und Kultur
- Die Bedeutung von Respekt und Toleranz im Umgang mit verschiedenen Religionen
- Die Analyse verschiedener Feiertypen im Kontext des interreligiösen Dialogs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des christlichen Gottesdienstes in einer pluralistischen Gesellschaft ein und stellt die Problematik des Umgangs mit Schülern verschiedener Religionen im Kontext des Schulgottesdienstes dar.
Das Kapitel "Liturgie und Kultur" beleuchtet die enge Beziehung zwischen Liturgie und Kultur und beschreibt den Gottesdienst als Dialog zwischen Gott und Mensch, eingebettet in ein kulturelles Umfeld.
Das Kapitel "Religiöser und ritueller Pluralismus" differenziert zwischen den beiden Arten von Pluralismus und erläutert den Begriff des Pluralismus im Kontext der Koexistenz von Kulturen und Religionen. Es werden die Kennzeichen des religiösen und des rituellen Pluralismus aufgezeigt und deren Zusammenhänge erläutert.
Das Kapitel "Kernprobleme" beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Feier des Glaubens mit Menschen verschiedener Religionen ergeben, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und die Notwendigkeit des Respekts gegenüber den jeweiligen Glaubensgeheimnissen.
Das Kapitel "Feiertypen" stellt verschiedene Arten von Feiern vor, an denen Menschen verschiedener Religionen teilnehmen können, und analysiert die Vor- und Nachteile der einzelnen Feiertypen.
Schlüsselwörter
Religiöser Pluralismus, ritueller Pluralismus, Liturgische Gastfreundschaft, interreligiöser Dialog, Schulgottesdienst, Glaubensüberzeugungen, Respekt, Toleranz, Feiertypen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'Liturgische Gastfreundschaft'?
Es ist ein Konzept, bei dem Menschen anderer Konfessionen oder Religionen zu einem christlichen Gottesdienst eingeladen werden, ohne ihre eigene Identität aufgeben zu müssen.
Wie unterscheiden sich multireligiöse von interreligiösen Feiern?
Multireligiöse Feiern finden oft nebeneinander statt (jeder betet für sich), während interreligiöse Feiern einen tieferen Dialog und gemeinsame Elemente anstreben.
Welche Herausforderungen gibt es bei Schulgottesdiensten?
Schüler verschiedener Religionen sollen gleichermaßen geachtet und angesprochen werden, ohne die christliche Identität der Feier zu verleugnen.
Was ist der Unterschied zwischen religiösem und rituellem Pluralismus?
Religiöser Pluralismus bezieht sich auf die Vielfalt der Glaubensüberzeugungen; ritueller Pluralismus auf die verschiedenen Formen der praktischen Ausübung und Feier.
Wie hängen Liturgie und Kultur zusammen?
Liturgie ist immer in einen kulturellen Kontext eingebettet; der Gottesdienst ist ein Dialog zwischen Gott und Mensch, der kulturelle Ausdrucksformen nutzt.
- Citation du texte
- Stefan Rohde (Auteur), 2010, Christlicher Gottesdienst in pluralistischer Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150355