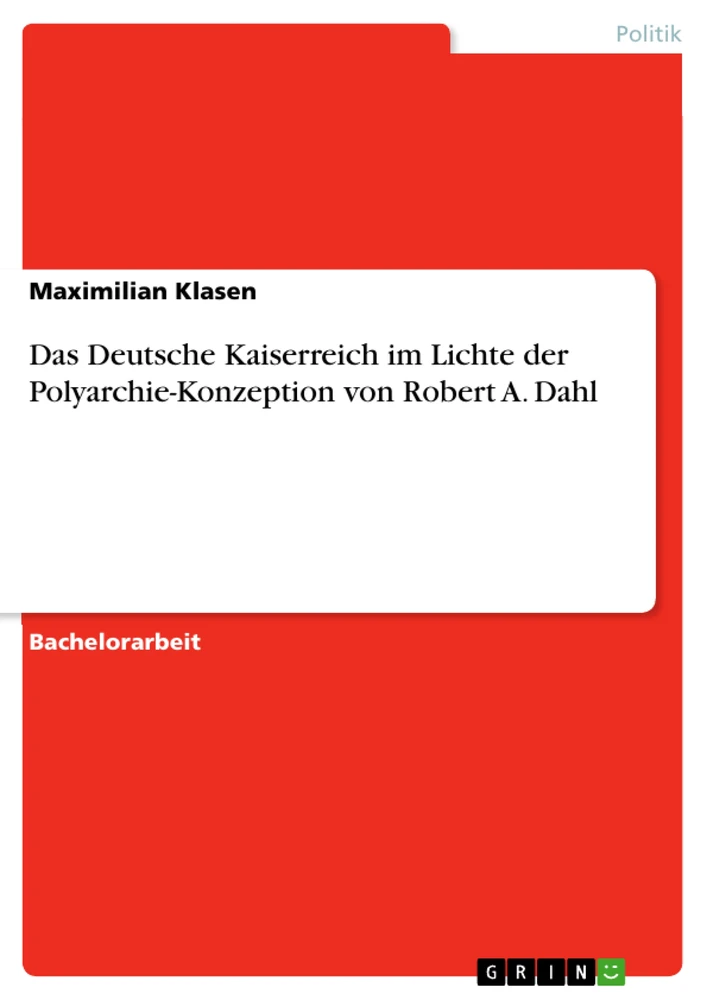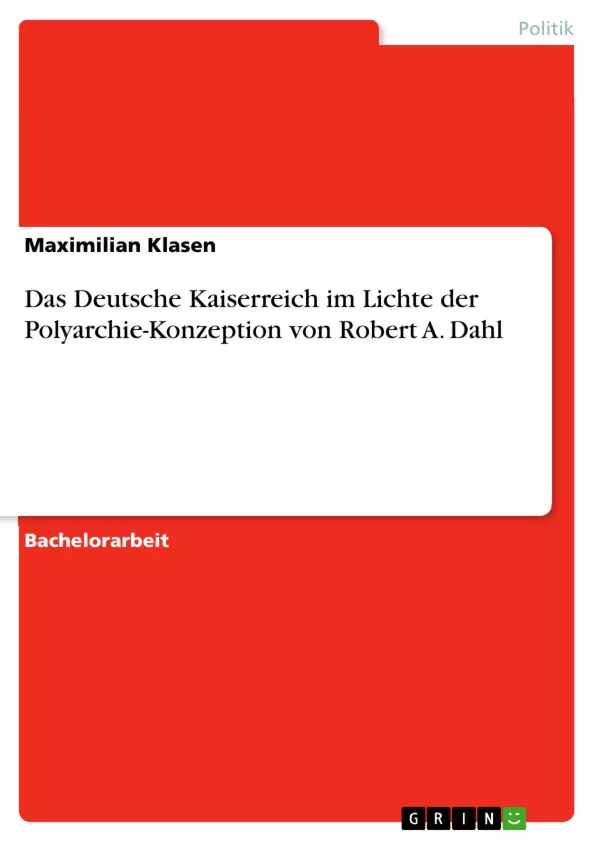Dieses Werk ordnet das Deutsche Kaiserreich mit seiner vergleichsweise fortschrittlichen Bismarckschen Verfassung von 1871 in die Demokratietheorie des bedeutenden US-Amerikanischen Politikwissenschaftlers Robert A. Dahl ein. 1971 versuchte dieser, mit dem Begriff Polyarchy die realexistierenden repräsentativen Demokratien der westlichen Hemisphäre neu zu definieren, indem er sie vom klassischen Ideal der Demokratie abgrenzte. In der Demokratieforschung war dieser Ansatz zwar wirkmächtig, doch der Begriff Polyarchie konnte sich langfristig nicht durchsetzen. Seine Maßstäbe für realexistierende Demokratien, auch Polyarchien genannt, werden auf das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1914 angewendet, wobei auch ein zeitgenössischer Vergleich stattfindet, etwa mit den damaligen "Vorbildern" Großbritannien oder den USA, aber auch mit Preußen. Zentrale Faktoren sind unter anderem die Freiheit der Reichstagswahlen, die Meinungs- und Pressefreiheit, besonders mit Blick auf den Kulturkampf und die Sozialistengesetze, welche Bestrebungen der Reichsleitung es gab um die Opposition, namentlich Zentrum und SPD zu unterdrücken, und letztlich welche Chancen zur Einflussnahme oder gar Regierungsübernahme effektiv für die Reichstagsparteien bestand.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Dahls Konzeption der Polyarchie
- 3 Das Kaiserreich im Lichte Dahls Polyarchie-Konzeption
- 3.1 Partizipation und Wahlen
- 3.2 Opposition und Freiheitsrechte
- 3.3 Partizipation vor Parlamentarisierung
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Deutsche Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg anhand von Robert A. Dahls Polyarchie-Konzeption. Ziel ist es, die Reichserfahrung im Lichte Dahls empirischer Demokratietheorie einzuordnen und zu analysieren, inwieweit die von Dahl aufgestellten Bedingungen für eine Polyarchie im Kaiserreich erfüllt waren.
- Dahls Polyarchie-Konzeption und ihre Kriterien
- Partizipation und Wahlen im Deutschen Kaiserreich
- Opposition und Freiheitsrechte unter Kaiser Wilhelm II.
- Die Rolle des Parlaments und die Grenzen der politischen Partizipation
- Einordnung des Kaiserreichs auf dem Spektrum zwischen Autokratie und Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beleuchtet gegensätzliche Sichtweisen auf das Deutsche Kaiserreich und führt in die Thematik ein. Sie begründet die Verwendung von Dahls Polyarchie-Konzeption für die Analyse und nennt zentrale Forschungsliteratur.
Kapitel 2 (Dahls Konzeption der Polyarchie): Dieses Kapitel beschreibt Dahls einflussreiche empirische Demokratietheorie und seine Definition von Polyarchie im Vergleich zum Ideal der Demokratie. Es skizziert Dahls acht Bedingungen für eine Polyarchie und differenziert seine Theorie von aristotelischen Ansätzen.
Kapitel 3 (Das Kaiserreich im Lichte Dahls Polyarchie-Konzeption): Dieser Abschnitt analysiert das Deutsche Kaiserreich anhand der von Dahl aufgestellten Kriterien. Die Unterkapitel befassen sich mit Partizipation und Wahlen, Opposition und Freiheitsrechten sowie der Partizipation vor der vollständigen Parlamentarisierung.
Schlüsselwörter
Deutsches Kaiserreich, Polyarchie, Robert A. Dahl, Demokratie, Partizipation, Wahlen, Opposition, Freiheitsrechte, Parlament, Autokratie, empirische Demokratietheorie, historische Entwicklung.
- Citar trabajo
- Maximilian Klasen (Autor), 2021, Das Deutsche Kaiserreich im Lichte der Polyarchie-Konzeption von Robert A. Dahl, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1503640