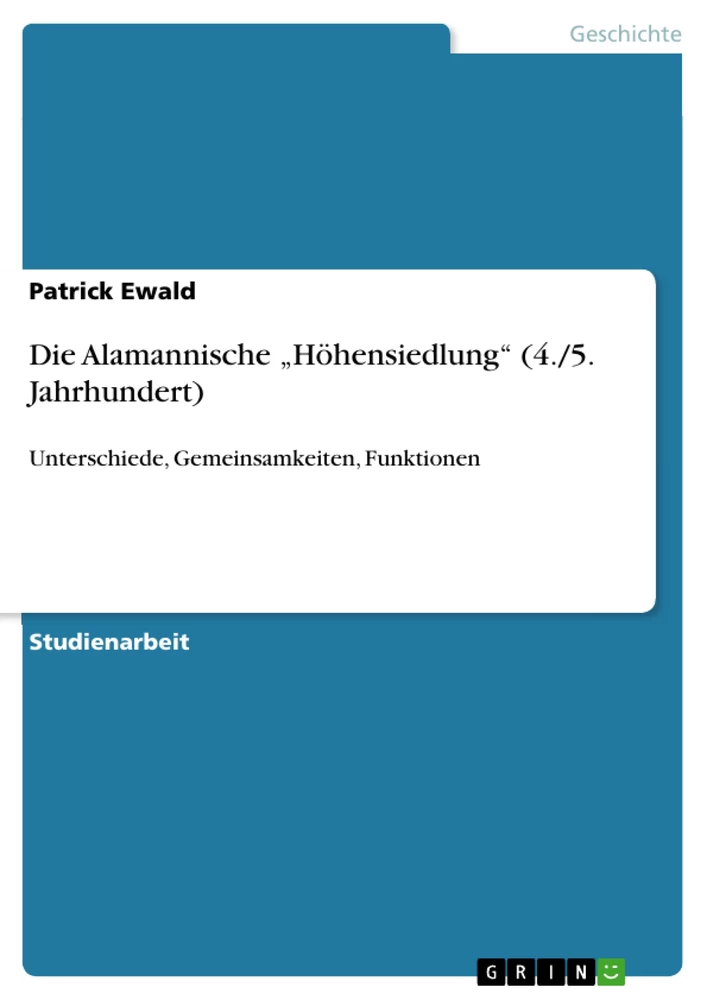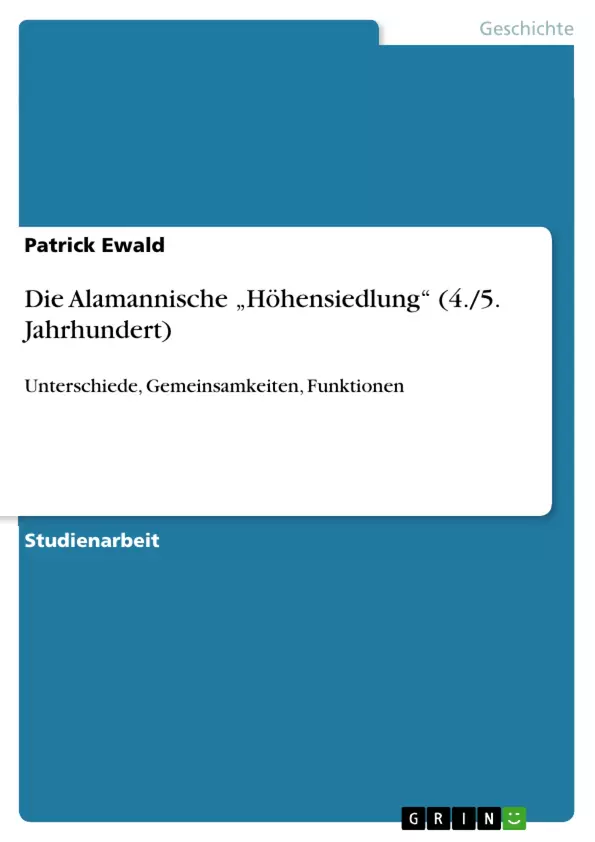Bei den Alamannischen Höhenstationen handelt es sich um eine Sonderform der germanischen Besiedlung. Es ist insbesondere deswegen eine Sonderform, weil sich, abgesehen von der exponierten Lage, die Funde deutlich zu jenen unterscheiden, die für ländliche Siedlungen gemacht wurden. Es handelt sich meist um Funde von Edelmetallen, Waffen und von römischen Gebrauchsgegenständen. Diese sind für ländliche Siedlungen bisher so nicht fassbar. Man kann also nicht nur eine außergewöhnliche Art der Besiedlung auf den Bergen annehmen, sondern auch eine bestimmte Gesellschaftsform und -klasse.
Vorbilder könnten Römische Fluchtburgen, reguläre Siedlungen auf Anhöhen oder Militärstationen gewesen sein. Sie entstanden seit der Mitte des dritten Jahrhunderts bis ins vierte Jahrhundert. Das geschah ohne Anknüpfung an vorher bestehende Siedlungen, was nicht heißen soll, dass diese Orte noch nie zuvor besiedelt waren.
Lediglich auf archäologische Funde angewiesen, durchlief die Deutung der Funktion dieser Stationen einen großen Wandel, der sich am deutlichsten im Wechsel der Bezeichnungen für diese Plätze deutlich macht. So ist Werner aufgrund der entdeckten Funde auf dem Runden Berg bei Urach (1965) noch davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine „Alamannische Gauburg“ handele. Diese Darstellung und die dürftigen weiteren Funde prägten das Bild dieser Orte. So schlugen spätere Autoren die Begriffe „Höhenburg“ oder „Höhensiedlung“ für alle weiteren entdeckten Höhensationen vor. Stets ist man davon ausgegangen, dass es sich um Aufenthaltsorte von Königen oder zumindest einer arrivierten Gesellschaft handele.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Alamannischen Höhenstationen
- Allgemeine Betrachtung
- Lage und Beziehungen zum Imperium Romanum
- Exemplarische Betrachtungen
- Der Runde Berg bei Urach
- Zähringer Burgberg
- Der Geißkopf
- Schlusswort und Zusammenfassung
- Informationsgrundlagen
- Literaturverzeichnis
- Verwendete Literatur
- Weitere Literatur
- Internetquellen
- Literaturverzeichnis
- Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Alamannischen Höhenstationen, die seit den 1960er Jahren untersucht werden. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ihrer Funktion und den Beziehungen der Alamannen zu den Römern auf der linken Rheinseite. Die Untersuchung basiert ausschließlich auf nichtliterarischen Quellen.
- Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Alamannischen Höhenstationen
- Bestimmung der Funktion dieser Orte
- Untersuchung der Beziehungen zwischen den Alamannen und den Römern
- Bewertung der Bedeutung der Höhenstationen im Kontext der alamannischen Besiedlung
- Rekonstruktion der Lebensweise der Alamannen in den Höhenstationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Alamannischen Höhenstationen ein und erläutert den Forschungsstand. Kapitel 2.1 widmet sich einer allgemeinen Betrachtung der Höhenstationen, während Kapitel 2.2 ihre Lage und Beziehung zum römischen Imperium beleuchtet. Kapitel 2.3 präsentiert anhand von drei Beispielen (Runder Berg bei Urach, Zähringer Burgberg, Geißkopf) die gewonnenen Erkenntnisse. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine abschließende Betrachtung der Thematik.
Schlüsselwörter
Alamannische Höhenstationen, Höhensiedlung, germanische Besiedlung, Beziehungen zu den Römern, archäologische Funde, Funktion der Höhenstationen, Phosphatanalysen, numismatische Funde, Vergleichende Analyse, Sekundärliteratur, Drinkwater, Fingerlin, Hoeper, Steuer, Theune
Häufig gestellte Fragen
Was sind Alamannische Höhenstationen?
Dabei handelt es sich um eine Sonderform der germanischen Besiedlung auf exponierten Bergkuppen im 4. und 5. Jahrhundert.
Wie unterscheiden sich die Funde von normalen ländlichen Siedlungen?
Man fand dort überdurchschnittlich viele Edelmetalle, Waffen und römische Gebrauchsgegenstände, was auf eine soziale Oberschicht hindeutet.
Was war die Funktion dieser Höhensiedlungen?
Die Deutung wandelte sich von „Gauburgen“ hin zu Sitzen alamannischer Kleinkönige oder Adelsfamilien mit strategischer Bedeutung.
Welche Orte werden als Beispiele genannt?
Die Arbeit betrachtet exemplarisch den Runden Berg bei Urach, den Zähringer Burgberg und den Geißkopf.
Welche Beziehung hatten diese Siedler zum Römischen Reich?
Die Funde römischer Waren belegen einen regen Austausch und möglicherweise auch militärische oder politische Beziehungen zum Imperium Romanum.
- Arbeit zitieren
- Patrick Ewald (Autor:in), 2009, Die Alamannische „Höhensiedlung“ (4./5. Jahrhundert), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150400