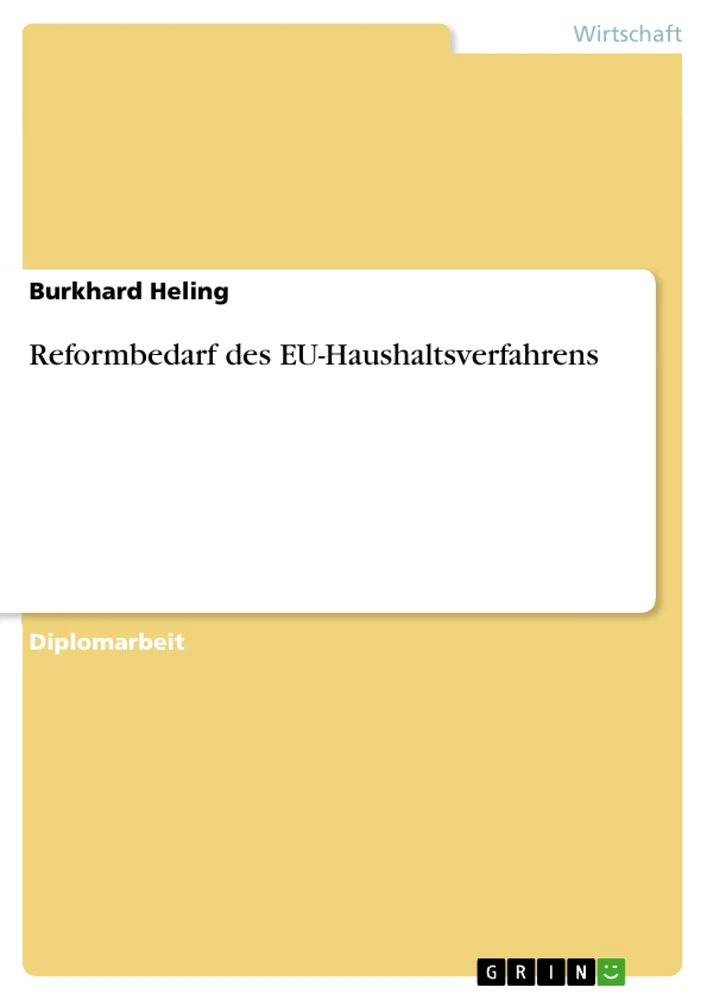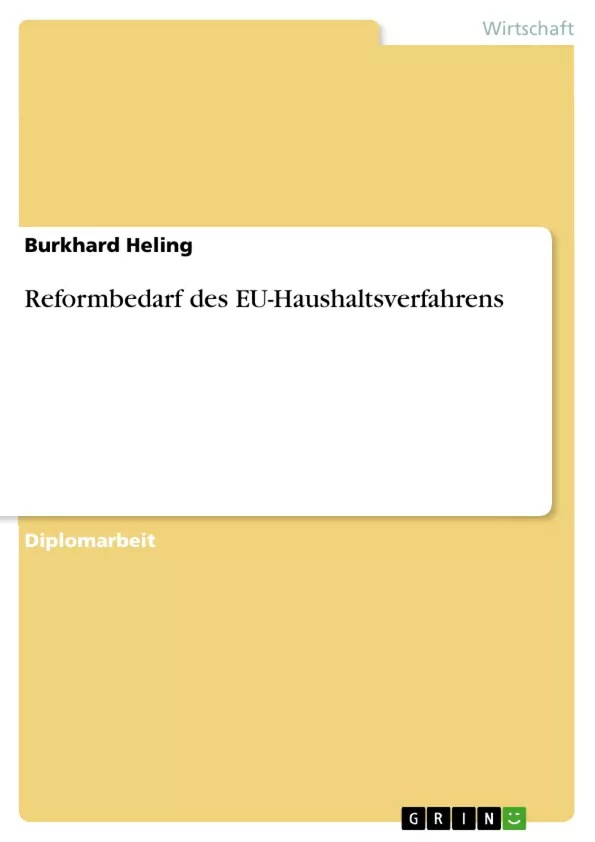Der europäische Einigungs- und Integrationsprozess hat seit seinem Beginn vor 50 Jahren mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ursprünglich initiiert, um die Sicherheit in Europa langfristig zu stabilisieren, trat zunehmend der Aspekt wirtschaftlicher Vorteile in den Fokus der Integrationsbemühungen. Die wirtschaftliche Prosperität der Gründerstaaten und der Wunsch, daran teilzuhaben, sind Gründe für viele Staaten, sich der Gemeinschaft anzuschließen.
Jedoch sind bis heute Skepsis und Angst vor Übervorteilung und Verlust nationaler Souveränität und Identität latent in den Köpfen vieler Europäer verankert. Überbürokratisierung, unmäßige Verwaltungskosten, Demokratiedefizite und ungerechte Machtverhältnisse werden den Institutionen und der formalen Ausgestaltung des gemeinsamen Europa vorgeworfen.
Besonders deutlich werden die vorhandenen Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten aber auch den europäischen Institutionen untereinander am Budgetprozess, der in seinem Ergebnis festlegt, wie einerseits die finanziellen Mittel aufgebracht und andererseits verwendet werden sollen. Die Frage, wer wie viel und warum bekommt und wer dafür wie viel bezahlen soll, war Auslöser heftiger Diskussionen und Auseinandersetzungen, die Anfang der 80er Jahre ihren Höhepunkt fanden. Finanzielle Aspekte polarisieren und lassen Kompromisse schwieriger werden. Ressentiments und Vorbehalte den Nachbarn und Partnern gegenüber spiegeln die überwiegend nationalstaatlich orientierte Ausrichtung der Europäer, insbesondere in der Konzentration auf das Verhältnis von Zahlungen und zurückfließenden Mittel, wider.
Viele positive Effekte, die sich aus der Gemeinschaft ergeben, treten in einer verzerrten Wahrnehmung der Individuen in den Hintergrund.
Mitgliedstaaten fürchten um ihre Souveränität, und weite Teile der Bevölkerung sehen die EU Entscheidungen nicht ausreichend legitimiert, da der Einfluss der nationalen Parlamente gering ist.
Viele Verfahrensbedingungen begünstigen den Erhalt des Status-Quo. Eine Lösung oberhalb des kleinsten gemeinsamen Nenners wird, nicht zuletzt wegen immer vielfältigerer Interessen (z.B. durch Erweiterung), immer seltener. Dies äußert sich häufig in den Verhandlungen zur einstimmigen Beschlussfassung. „Die Institutionellen Strukturen der Europäischen Gemeinschaft [würden] suboptimale Politikergebnisse systematisch begünstigen und wenn nicht zum Stillstand, so doch zum Stagnieren des Integrationsprozesses führen.“ (Scharpf, 2009, S. 260)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bewertungskriterien des Budgetverfahrens
- 3. Deskriptiver Überblick
- 3.1 Beteiligte Institutionen
- 3.1.1 Der Europäische Rat
- 3.1.2 Der Rat der Europäischen Union
- 3.1.3 Das Europäische Parlament
- 3.1.4 Die Europäische Kommission
- 3.2 Aufstellung des Haushaltes
- 3.3 Konfliktpotential der beteiligten Organe und Institutionen
- 3.4 Historische Entwicklung des Haushaltsverfahrens
- 3.4 Spieltheoretische Betrachtung
- 3.1 Beteiligte Institutionen
- 4. Herausforderungen des Budgetverfahrens
- 4.1 Allgemeine Probleme
- 4.1.1 Ausgabenseite
- 4.1.2 Einnahmeseite
- 4.1.3 Machtverteilung als Einflussfaktor auf das Budgetverfahren
- 4.1.4 Zusammenfassung der allgemeinen Problematik
- 4.2 Mehrjähriger Planungsprozess
- 4.3 Reformvorschläge
- 4.1 Allgemeine Probleme
- 5. Vertrag von Lissabon
- 5.1 Veränderungen im Budgetverfahren
- 5.2 Das Mitentscheidungsverfahren (Kodezisionsverfahren)
- 6. Fazit Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Reformbedarf des EU-Haushaltsverfahrens, der in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der politischen Debatte gerückt ist. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen des bestehenden Verfahrens, insbesondere mit den Interessenkonflikten zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen.
- Bewertungskriterien des Budgetverfahrens
- Historische Entwicklung des Haushaltsverfahrens
- Herausforderungen des Budgetverfahrens: Ausgabenseite, Einnahmeseite, Machtverteilung
- Mehrjähriger Planungsprozess und Reformvorschläge
- Veränderungen im Budgetverfahren durch den Vertrag von Lissabon
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des EU-Haushaltsverfahrens für die europäische Integration beleuchtet. In Kapitel 2 werden wichtige Bewertungskriterien für das Budgetverfahren vorgestellt. Kapitel 3 bietet einen deskriptiven Überblick über die beteiligten Institutionen, die Aufstellung des Haushaltes, die Konflikte zwischen den Organen und Institutionen sowie die historische Entwicklung des Verfahrens. Kapitel 4 analysiert die Herausforderungen des Budgetverfahrens, insbesondere die Probleme auf der Ausgabenseite, der Einnahmeseite und die Auswirkungen der Machtverteilung auf den Prozess.
Kapitel 5 befasst sich mit den Veränderungen im Budgetverfahren durch den Vertrag von Lissabon. Im Fokus steht dabei das neue Mitentscheidungsverfahren (Kodezisionsverfahren). Der letzte Teil der Arbeit enthält ein Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des EU-Haushaltsverfahrens. Dabei stehen die folgenden Schlüsselwörter im Vordergrund: Budgetverfahren, Europäische Union, Mitgliedstaaten, Institutionen, Interessenkonflikte, Machtverteilung, Mehrjähriger Planungsprozess, Reformvorschläge, Vertrag von Lissabon, Mitentscheidungsverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das EU-Haushaltsverfahren reformbedürftig?
Interessenkonflikte zwischen Nettozahlern und Empfängern, mangelnde Legitimation durch nationale Parlamente und langwierige Einstimmigkeitsregeln führen oft zu suboptimalen Ergebnissen.
Welche Rolle spielen die EU-Institutionen im Budgetprozess?
Der Europäische Rat, der Rat der EU, das Europäische Parlament und die Kommission interagieren in einem komplexen Gefüge, um über die Verteilung finanzieller Mittel zu entscheiden.
Was änderte der Vertrag von Lissabon am Haushaltsverfahren?
Der Vertrag führte das Mitentscheidungsverfahren (Kodezisionsverfahren) ein, wodurch die Machtbefugnisse des Europäischen Parlaments im Budgetprozess gestärkt wurden.
Was ist der mehrjährige Finanzrahmen?
Es ist ein Planungsinstrument, das die Ausgabenprioritäten der EU über mehrere Jahre festlegt, um Planungssicherheit zu schaffen, aber auch Konflikte um die Einnahmen polarisiert.
Welche Kritikpunkte gibt es an der Einnahmeseite der EU?
Kritisiert werden vor allem die mangelnde Transparenz, die Abhängigkeit von nationalen Beiträgen und die Angst vor Souveränitätsverlust durch eigene EU-Steuern.
- Quote paper
- Burkhard Heling (Author), 2009, Reformbedarf des EU-Haushaltsverfahrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150423